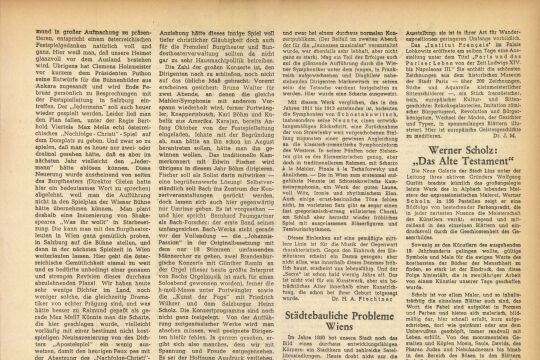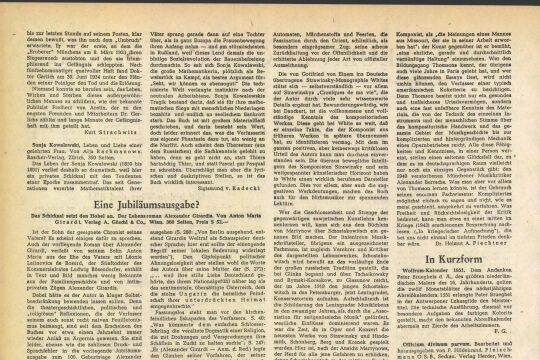Der Dirigent Ingo Metzmacher über die nächste Staatsopernpremiere, Dmitri Schostakowitschs „Lady Macbeth von Mzensk“, Politik und Musik und musikalische Facetten von Versuchung. Das Gespräch führte Walter Dobner
Es ist die erste Premiere der Abschiedssaison von Staatsoperndirektor Holender. Statt des ursprünglich vorgesehenen Kirill Petrenko, der krankheitshalber absagte, konnte Ingo Metzmacher für die musikalische Leitung gewonnen werden.
Die Furche: Herr Metzmacher, waren Sie überrascht über die Einladung der Staatsoper, die Neuproduktion von Dmitri Schostakowitschs „Lady Macbeth von Mzensk“ zu übernehmen?
Ingo Metzmacher: Ich war freudigst überrascht, denn es ist ein Traum für mich, einmal an der Wiener Staatsoper zu dirigieren. Schon oft bin ich um dieses Haus herumgelaufen. Im Sommer habe ich im Orchestergraben Instrumente ausprobiert, und wie ich nach oben schaute, dachte ich mir, das möchtest du noch einmal erleben.
Die Furche: Wann haben Sie sich mit diesem Schostakowitsch erstmals beschäftigt, wo haben Sie diese Oper schon dirigiert?
Metzmacher: Das war 1992 in Stuttgart, Regie führte Johannes Schaaf. Es war sehr erfolgreich, und es gab auch eine Wiederaufnahme. Dann habe ich mich mit dem Stück wieder beschäftigt, als ich mein zweites Buch geschrieben habe, denn die Oper kommt darin vor.
Die Furche: Drei Akte grotesk, im vierten Akt dramatisch: So wird diese „Lady Macbeth von Mzensk“ oft charakterisiert. Teilen Sie dieses Urteil, finden sie es zu plakativ?
Metzmacher: Es greift ein bisschen zu kurz. Die Passacaglia ist ein hoch dramatisches Stück Musik und extrem gesetzt gegen den Popen, der vorher in C-Dur schunkelt. Die Fallhöhe zwischen Groteske und tiefem Ernst gibt es bei Schostakowitsch immer. Aber natürlich hat der letzte Teil einen anderen Ton. In Stuttgart haben wir drei Akte gespielt, dann Pause und den vierten Akt. In Wien gibt es ein anderes Konzept: Hier war ich bald mit dem Wunsch konfrontiert, zwischen dem dritten und vierten Akt noch eine Musik zu spielen, da sonst der Umbau zu lange dauert. Es gab verschiedene Ideen. Wir werden den ersten Satz des achten Streichquartetts in der Streichorchesterfassung spielen. Das heißt, in Wien kommt die Pause nach dem zweiten Akt.
Die Furche: „Ich versuchte, eine psychologische Charakterisierung der hauptsächlich handelnden Personen der Tragödie zu geben und gleichzeitig in einer Reihe von Massenszenen den sozialen Hintergrund des Russland jener Zeit zu zeichnen“, beschreibt Schostakowitsch sein inhaltliches Anliegen, das er auch sehr symphonisch realisiert. Manche sehen in der Oper deshalb eine großangelegte viersätzige Symphonie.
Metzmacher: Ich finde die Großanlage des Stücks sehr interessant. Mich hat an den Symphonien immer interessiert, dass Schostakowitsch eine eigene Art zu denken hat, was eine symphonische Form ergeben kann. Etwa in der Sechsten, mit dem großen symphonischen Satz am Anfang. Das fasziniert mich auch in der Oper, dass das Finale so anders ist.
Die Furche: Wie erklären Sie sich das?
Metzmacher: Die tragische Handlung zwischen Katerina und Sergej kulminiert in diesem Akt. Katerina kommt in ihren beiden Arien gewissermaßen zum Endpunkt ihrer Entwicklung, der sie dann dazu führt, nicht nur ihre Rivalin, sondern auch sich selbst in den Fluss zu werfen.
Die Furche: „Lady Macbeth von Mzensk“ ist auch ein Beispiel für das Wechselspiel von Kunst und Politik. Teile der offiziellen sowjetischen Kulturpolitik nahmen das Werk zum Anlass, um Schostakowitsch zu ächten. Schwingen solche außermusikalischen Ereignisse mit, wenn man sich heute mit dieser Oper auseinandersetzt?
Metzmacher: Ich habe immer im Hinterkopf, dass Schostakowitsch mit der Komposition dieser Oper sein Leben riskiert hat. Das wusste er nicht, aber er hat ’s getan. Es wirkte sich auf die Stücke, die er danach geschrieben hat, aus, denn dieser Schock war für ihn riesig. Dieser unbeschwerte, sehr direkte Zugang zur Musik in den Stücken davor, auch diese drastische Überzeichnung in den ersten drei Akten der Oper hat, dagegen etwas Kindliches: Man glaubt, man kann alles tun.
Die Furche: Was interessiert Sie an der Oper am meisten: die vom Libretto verschiedene musikalische Dramaturgie, das Orchesterpathos, die selbst in den größten Ausbrüchen immer noch vorhandene vokale Kantabilität?
Metzmacher: Mich interessieren alle diese Versatzstücke. Aus Gründen des Zusammenspiels und weil die einzelnen Gruppen verschiedene Aufgaben haben – die lyrisch-expressive Seite wird eher von den Streichern getragen – werden wir die Streicher im linken Teil des Grabens platzieren und die Bläser, die eher das Groteske und Grelle unterstreichen, im rechten Teil. Deswegen, glaube ich, liegt mir auch dieses Stück – weil ich immer gerne die Extreme in der Musik suche. Das Interessante an diesem Stück ist, dass es nicht wie üblich in der Geschichte der Oper die Gefühle der Menschen so überhöht und besonders groß macht, sondern lebensecht und sehr wahr.
Die Furche: 2005 haben Sie Ihr erstes Buch herausgebracht, „Keine Angst vor neuen Tönen“, vor wenigen Wochen ist Ihr zweites erschienen: „Vorhang auf. Oper entdecken und erleben“. Worum geht es hier?
Metzmacher: Ich erzähle 15 verschiedene Opern, von Monteverdis „Orfeo“ bis zu einem Stück, das es noch nicht gibt, „Dionysos“ von Wolfgang Rihm. Das Buch hat die Form einer ganz bestimmten Oper, nämlich von Alban Bergs „Wozzeck“: drei Akte, 15 Szenen, zwölf Verwandlungsmusiken. Es gibt zwei Ebenen in diesem Buch: die 15 Szenen, die jeweils eine Oper beschreiben. In den Verwandlungsmusiken schildere ich die Entstehung und die Durchführung der Inszenierung „Wozzeck“, die ich in Hamburg mit Peter Konwitschny gemacht habe, um einmal zu zeigen, was alles passiert, bevor eine Premiere herauskommt. Auf diese Weise erzähle ich auch die Geschichte von „Wozzeck“.
Die Furche: Diese neue Oper von Rihm werden Sie im Sommer bei den Salzburger Festspielen uraufführen. Was wird uns hier erwarten?
Metzmacher: Es geht nicht um die Legende und den Mythos des Dionysos, sondern um das Leben von Nietzsche, der sich für Dionysos gehalten hat. Aus dessen Dithyramben stammt zum Teil der Text. Alles andere müssen Sie den Komponisten fragen, was er mir erzählt hat, findet sich in meinem Buch.
Die Furche: Ihr Hauptstandbein ist zurzeit das Deutsche Sinfonieorchester Berlin. Hier haben Sie sich für diese Saison ein besonderes Motto für die Konzerte ausgesucht: Versuchung. Was verstehen Sie darunter?
Metzmacher: Das Thema hat die Musik schon immer gereizt. Selbst bei Schostakowitsch ist die Versuchung sehr stark für Katerina und Sergej. Es dauert auch nicht lange, bis es knallt. Schostakowitsch beschreibt das eher handfest, wie es im Leben wirklich ist. Andere Komponisten wie Wagner oder Alban Berg haben das mehr verschlüsselt oder auf die Spitze getrieben – diese unerfüllte Sehnsucht, die sich nur Luft verschaffen kann, indem man Stücke wie „Tristan“ oder „Lulu“ komponiert. Wir haben vor einigen Wochen mit einem reinen Berg-Programm begonnen – ich finde, in der ganzen „Lulu“ ist ein Ton wie eine Art Gift drinnen. Im Dezember kommt Salomes Schlussgesang und der Tanz der sieben Schleier, Debussy und Hindemiths „Mathis der Maler“. Es folgen die „Faust-Szenen“ von Schumann und ein Programm mit Schreker, Vorspiel zu den „Gezeichneten“, „Pelleas und Melisande“ von Schönberg und das „Hexenlied“ von Max von Schillings, das wird Klaus Maria Brandauer rezitieren. Schließlich kommt noch ein Mozart-Programm, das wir mit Werken eines jung verstorbenen kanadischen Komponisten kombinieren.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!