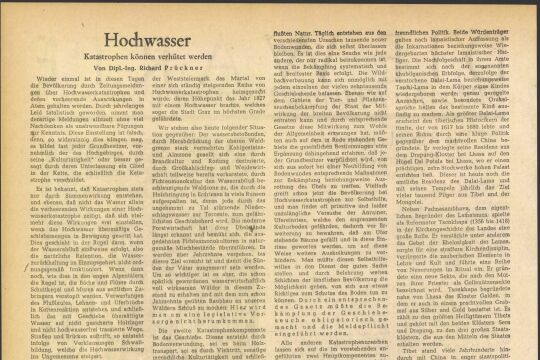"Die Tibeter sind die Indianer des 21. Jahrhunderts", sagt Kelsang Gyaltsen, der Sondergesandte des Dalai Lama, denn "was in Tibet geschieht, ist im Grunde ein stiller Völkermord". Gyaltsen berichtet im Furche-Interview aber auch über positive Veränderungen in der chinesischen Einstellung gegenüber Tibet. Ein Prozess, den auch Hermine Schreiberhuber beobachtet hat: "Tibet ist ,in' bei Chinesen!" Tibet ist derzeit aber auch in Österreich ein kontrovers diskutiertes Thema - auch darüber mehr in diesem Dossier. Redaktion: Wolfgang Machreich"Mit den Augen des Herzens schauen", hat der Dalai Lama Tibet-Reisenden geraten. Hermine Schreiberhuber hat das versucht.
Shangri-La, "Schneeland", heißt Tibet in der Sprache der Einheimischen. Als Xizang, "Schatzhaus des Westens", bezeichnen die Chinesen das Land am Dach der Welt, in dem sie seit Jahrzehnten vollendete Tatsachen geschaffen haben.
Nach chinesischer Diktion hat die Volksrepublik China den Mönchsstaat 1951 von Theokratie und Ausbeutung befreit und vom Mittelalter in die Neuzeit geführt. Freilich, wirtschaftlicher Fortschritt und sozialer Umbau gingen mit unermesslichem Leid für das tapfere Bergvolk einher. "Die Bauern waren praktisch Leibeigene. Daher sagen wir: Tibet wurde befreit", bringt uns der chinesische Reiseleiter die offizielle Formel nahe. Gut 50 Jahre nach der "Befreiung" durch die chinesische Volksarmee hat die Sinisierung tiefe Spuren gegraben. Der Identitätsverlust ist unübersehbar und treibt immer noch Tibeter in die oft tödliche Flucht über die Berge.
Lange versteckter Gulag
Jahrzehntelang war Tibet hinter einem Bambusvorhang versteckt. Menschenrechtler sprachen von einem Gulag. Doch die Welt erfuhr nur wenig über das, was sich dort abspielte. Auf die chinesische Invasion von 1950, den blutigen Volksaufstand und die abenteuerliche Flucht des Dalai Lama von 1959 waren unzählige menschliche Tragödien gefolgt. Eine Fluchtbewegung setzte ein, die bis heute nicht versiegt ist, Zerstörung von Klöstern, Zwangsarbeit, Deportationen, Denunzierungsrituale, Umerziehung. Es kam zu Revolten und Hungersnot.
Dann aber zeichnete sich in der Haltung der Pekinger Führung eine Wende ab. In den 1980er Jahren ließ das kommunistische Regime eine vorsichtige Öffnung der abgeschotteten Hochlandregion zu. Mittlerweile ist der Tourismus eine höchst einträgliche Devisenquelle für die Volksrepublik geworden. Reisegruppen aus aller Welt drängen sich vor dem Potala-Palast in Lhasa ebenso wie in den wieder hergestellten Klöstern. "Teile von Zentraltibet wurden in ein devisenbringendes Freilichtmuseum verwandelt", schreibt Hans Mäder in seinem Tibet-Buch.
"Schatz des Westens" ist aus chinesischer Perspektive in der Tat eine passende Bezeichnung. Tibet bietet überwältigende Landschaften und einzigartige Kulturgüter. Und es birgt große Ressourcen - reiche Wälder, viel Wasser, gefragte Bodenschätze wie Uran, Mangan, Magnesium, Borax, abgesehen von Öl, Gold und Jade. Die Volksrepublik erbrachte zweifellos beachtliche Leistungen in Verkehrserschließung und Ausbau der Infrastruktur. Prachtstraßen, Flugplätze und neuerdings eine spektakuläre Bahnverbindung dienen dem Transport von Ressourcen und Touristen.
Mehr Chinesen als Tibeter
Das Terrain, um Tibet auf den Präsentierteller zu heben, hatte Peking inzwischen längst vorbereitet. China verfolgte von Anbeginn eine gezielte Ansiedlungspolitik, und heute macht die Zahl der zugewanderten Han-Chinesen mehr als die Hälfte aus. Sieben Millionen Tibetern sollen acht Millionen Chinesen gegenüberstehen. Peking stellt diese Angaben in Abrede und spricht von lediglich fünf Prozent Chinesen. Denn China versteht unter Tibet heute die 1961 geschaffene Autonome Region Tibet (ART), ein Gebiet, das nur mehr die Hälfte des eigentlichen tibetischen Siedlungsgebietes umfasst. Durch den Zuzug ist jedenfalls der "point of no return" erreicht.
Den Durchschnittstouristen stellt sich die ART - denn nur dorthin reisen die meisten - als Land im wirtschaftlichen Umbruch und Aufschwung vor. Dass alle größeren Städte einen chinesischen Anstrich haben, verwundert die Besucher nicht sonderlich, denn die Mehrzahl der Ausländer hat ja zuvor kein anderes Tibet kennen gelernt. Man muss wissen, dass etwa in Lhasa seit Umsetzung des Entwicklungsplans der 1980er Jahre nur mehr rund ein Quadratkilometer der Altstadt tibetischen Charakter hat.
Fürwahr, der Tibet-Reisende muss die Augen offen halten und darf nicht immer nur hektisch durch die Kameralinse blicken. Einfühlungsvermögen ist gefragt. Dann wird er merken, dass nicht alles Dargebotene authentisch ist. Hinter der Oberfläche entdeckt er dann so manche Ungereimtheit. "Mit den Augen des Herzens schauen", hat der Dalai Lama einmal einer Tibeterin im Exil geraten, als sie nach Jahren in die alte Heimat reiste. Wer dies tut, sieht ein wenig mehr als andere.
Nicht nur Lhasa ist heute eine chinesische Stadt. Alle größeren Städte Tibets tragen ein chinesisches Antlitz zur Schau. Von den renovierten Kultstätten abgesehen. Denn die Tempel und Klöster, wohin die bitterarmen Landbewohner pilgern, sind Teil des Bildes, das China der Welt zu vermitteln versucht. Die Menschen können ihre Religion frei ausüben, lautet die Botschaft. Was sich hinter den Kulissen abspielt, bekommt der Besucher nicht zu sehen. Laogai - Schweigen, das haben die Tibeter gelernt.
In Lhasas Altstadtviertel Barkhor herrscht geschäftiges Treiben auf dem Markt und vor dem Yokhang-Tempel. Khampas aus Osttibet mit ihren schwarzen Zöpfen und farbenfrohen Trachten, Frauen mit kunstvollen Haarkränzen und Babys auf den Rücken geschnürt, Greise am Stock wandern vorbei, rot gewandete Mönche schwatzen, Händler bieten Handarbeiten und Kultgegenstände feil, Hui-Moslems verkaufen Schleckereien. Pilger, Gebetsmühlen schwenkend oder in demütigen Niederwerfungen, umrunden im Uhrzeigersinn den Tempel.
Video-Überwachung überall
Die Zeit scheint stehen geblieben. Fast vergisst man, dass der Barkhor-Platz immer wieder Schauplatz von Tibeter-Protesten war, die auch Tote forderten - so 1998. Die Video-Kameras auf den Dächern erinnern daran, dass die chinesische Wachsamkeit omnipräsent ist. Wer das Glück hat, dem Abendgebet der Mönche im Yokhang-Tempel beizuwohnen, wird Zeuge einer berührenden Andacht. Der Tempel beherbergt wertvolle Buddha-Statuen in kostbaren Gewändern.
Der Potala-Palast, der hoch über der Stadt am Berghang thront, ist die größte Sehenswürdigkeit von Lhasa. Das grandiose Baujuwel, einst Residenz des Dalai Lama, des geistlichen und weltlichen Oberhauptes Tibets, wurde von China gänzlich restauriert. Doch den tibetischen Bezirk um den Potala hat man dem Erdboden gleich gemacht. Vorne erstreckt sich ein öder Platz mit einem Denkmal, der an eine Minikopie des Tiananmen-Platzes in Peking gemahnt. Der tibetische Markt hinter dem Palast musste einem Volkspark weichen.
Nur ein Bild im ganzen Land
Im Potala, heute UNESCO-Weltkulturerbe, herrscht strengstes Fotoverbot. Die Besucherströme sind zeitlich reglementiert. Ausländer sind einer genauen Kontrolle durch Soldaten unterworfen, die sogar Pässe und Visa verlangen. Ist diese Hürde geschafft, kann der Besucher den anstrengenden 117-Meter-Aufstieg in Angriff nehmen. Herzstücke des riesigen Komplexes sind der Rote und der Weiße Palast. Hier, in der Bildergalerie der Lamas, wird offenbar, dass der 14. Dalai Lama, Tenzing Gyatso, persona non grata ist. Die Serie endet mit dem 13. Dalai Lama.
Im Sommerpalast Norbulingka hängt noch das Bild des gegenwärtige Dalai Lama - das einzige offizielle im ganzen Land. Wohl nur deswegen, weil die heutigen Machthaber sonst die kostbare Lackmalerei in dem Empfangssalon hätten zerstören müssen. Sie zeigt den Dalai Lama im Kreise von Angehörigen und Lehrern - bei dem jungen abgebildeten Europäer dürfte es sich um Heinrich Harrer handeln.
Den Norbulingka umgibt eine prächtige Gartenanlage mit Teichen voll quakender Enten. Ein Bild des Friedens. 1959 lief hier eine Schlüsselszene des tibetischen Dramas ab. Vom Südtor des von 30.000 Tibetern und der chinesischen Armee belagerten Palastes hatte der junge Staatsmann, als tibetischer Soldat verkleidet, mit einem Teil seiner Familie und seiner Regierung die Flucht angetreten, die ihn über die Berge des Himalaya nach Nordindien und in ein lebenslanges Exil führte.
Die heutige politische Wirklichkeit holt uns ein, als wir einen Blick in das gegenüber liegende Tibetische Museum werfen, das die Chinesen errichteten und das zur Hälfte mit chinesischer Kunst angefüllt ist. Wer heute herrscht, tut uns auch die Erläuterung im Foyer kund: "Die Tibeter sind eine von Chinas Nationalitäten, mit einer langen Geschichte und einer außergewöhnlichen Kultur und Traditionen. Die traditionelle Kultur Tibets ist eine Perle im kulturellen Schatz der chinesischen Nation."
"Kulturelle Perle Chinas"
Zumindest eines der drei riesigen Gelugpa-Klöster Drepung, Sera und Ganden fehlt in keinem Reiseprogramm. Vor 1959 existierten in Tibet rund 6000 Klöster, von denen nur 13 die Invasion der Volksarmee und die Auswüchse der Kulturrevolution überlebten. Rund 250 Klöster wurden später wieder instand gesetzt. Der Drepung-Komplex, der sich einen Berghang hinaufzieht, ist eine Stadt für sich. Hier befand sich auch der Sitz des Dalai Lama vor dem Bau des Potala. Drepung entging der Zerstörung, weil es in kritischen Zeiten als Militärkaserne diente.
Das Kloster Sera wiederum ist bekannt für seine diskutierenden Mönche; im Frage-und Antwortspiel wird der Lehrstoff geübt. Was die Touristenschwärme zu sehen bekommen, wirkt aber nicht mehr ganz echt. In Zweier-oder Vierer-Gruppen stehen Mönche im Klosterhof beisammen, reden, schreien, klatschen, gestikulieren im Kung-Fu-Stil. Knipsende Touristen umkreisen sie - wie Geier bei der traditionellen Himmelsbestattung, meint ein Reiseführer.
Authentischer wirkt die Geschäftigkeit im Nonnenkloster Ani Shanghkhung mitten im Moslem-Viertel des alten Rest-Lhasa. In der kleinen Druckerei werden Gebetsstreifen zur Auslieferung an Tempel und Klöster verpackt, in der Klosterküche wird das Abendessen zubereitet. Freundliche Nonnen bedienen im zugehörigen Cafe oder im Souvenir-Geschäft. Eine Moschee der Hui-Minderheit verbirgt sich schräg gegenüber hinter einem blassgrünen Gitter.
Tibet ist bei Chinesen "in"
50.000 Mönche und Nonnen gibt es heutzutage nach offiziellen Angaben; davon sei nur ein Prozent Frauen. In allen Klöstern begegnen uns neben den stillen, freundlichen tibetischen Pilgern aller Altersklassen auch junge, chic gekleidete Chinesen. Die tibetische Kultur ist bei chinesischen Juppies offenbar "in". Junge Frauen stöckeln in modischen Stiefeln über die endlosen Stufen der Anlagen, ihre Begleiter fotografieren, was das Zeug hält.
Am nächsten Morgen geht es südwestwärts. Die Landschaft wechselt zwischen Steinwüste und hohen Felswänden, bis sich das Flusstal wieder weitet. Bauern, die mit archaischen Holzflegeln dreschen, mit bunten Girlanden geschmückte Yaks, die Felder pflügen, und mit riesigen Strohbündeln beladene Pferdchen laden zum Fotostopp ein. Vorbei geht es an einem der wenigen Klöster der vor-buddhistischen Bön-Religion, die vor allem noch in der Region des Heiligen Berges Kailash lebendig ist.
Shigatse heißt das Tagesziel. Die zweitgrößte Stadt Tibets mit dem Kloster Tashilhunpo ist der Sitz des Pantschen Lama, der als Kontrapunkt zum Dalai Lama in Peking hoch in der Gunst steht. Freilich lebt auch dieser nicht in Tibet, sondern in Peking. Der junge Pantschen Lama, nach dem mysteriösen Verschwinden seines Vorgängers, des 11., von Peking gekürt, ist nur selten zu Gast. Wenn, dann reist er mit großem Gefolge wie ein Staatsbesuch an.
Der junge Führer wird als Gegenpol zum Dalai Lama aufgebaut. "Weil er noch viel lernen muss, lebt er in Peking. Ein Teil der Tibeter akzeptiert ihn noch nicht", lässt uns der Reiseführer wissen. Welchen Einflüssen der Pantschen Lama in China ausgesetzt ist, sei dahin gestellt. Sein Amtssitz Tashilhunpo wird indessen gehegt und gepflegt. Die monumentale Anlage beherbergt die größte Buddha-Statue der Welt. Das kommunistische China ließ sogar eine pompöse Stupa für den 10. Pantschen Lama bauen. Einmalig, meint ein Chinese, der schon lange in Tibet lebt: "Wohl um den Dalai Lama klein und unwichtig erscheinen zu lassen."
Olympia am Dach der Welt
Nicht so gut erging es dem Kloster Kumbum in Gyantse, das in der Kulturrevolution stark beschädigt wurde. Es verbindet indische, nepalesische und tibetische Stilmerkmale. Reste zerstörter Klostermauern sind noch sichtbar. Die 4000 Meter hoch gelegene Stadt war früher ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt nach Nepal, Indien und Kaschmir. Ein Erlebnis ist die Straße hinter dem Kloster. Dort spaziert man am Vieh vorbei, das direkt vor dem Haus des jeweiligen Besitzers angebunden ist.
Wem bei Ausflügen rund um Lhasa Zeit bleibt, der sollte die Passstraße zum Yang-See hinauffahren. Die Fahrt auf fast 5.000 Meter Höhe ist zwar anstrengend - mit Höhenschwindel und Kopfweh sollte man rechnen - doch der imposante Ausblick entschädigt allemal für die Unbill. Chinesische Sprüche in großen blauen Lettern schmücken die Felswände. Auf den neuen Überlandstraßen sind es die Olympia-Reklamen, die ins Auge stechen. Auf "Bejing 2008" soll auch auf dem Dach der Welt nicht vergessen werden.
"Der Dalai Lama ist alt ..."
Dafür wäre es China recht, würde sich die Welt weniger um den 14. Dalai Lama kümmern. Ausländer werden gewarnt, weder Fotos von ihm noch tibetische Fahnen mitzuführen. Dass er im Ausland so hohes Ansehen genießt, ist Peking ein Dorn im Auge. Sein Charisma wirke auf sie gefährlich, so ein westlicher Diplomat. China spielt auf Zeit. Der Dalai Lama ist ein betagter Mann. Wird es einen Nachfolger für ihn geben? Die undurchsichtige Geschichte um den verschollenen 11. Pantschen Lama weist darauf hin, dass Peking eine Reinkarnation nicht dem Zufall überlassen wird. Und die Welt sieht den vollendeten chinesischen Tatsachen zu. Wie wäre sonst die Aussage eines EU-Diplomaten in Peking zu verstehen, der ohne Umschweife feststellte: "Die Europäische Union erkennt an, dass Tibet ein Teil Chinas ist."
Und doch ist das Andenken an den Dalai Lama auch in Tibet keineswegs verblasst. Die Menschen haben Angst und nehmen seinen Namen nicht in den Mund. Doch in ihren vier Wänden verehren so mache Tibeter ihr Exil-Oberhaupt, dem eine Rückkehr in die alte Heimat versagt ist. In einem Bauernhaus ziert ein großes Bildnis "Seiner Heiligkeit" den Hausaltar. Am letzten Abend komme ich in Lhasa noch mit einem jungen Tibeter ins Gespräch. Als ich gehe, raunt er mir ins Ohr: "Wir alle hier im Bezirk lieben den Dalai Lama."
Die Autorin ist stv. Außenpolitik-Ressortleiterin in der Austria Presse Agentur (APA).