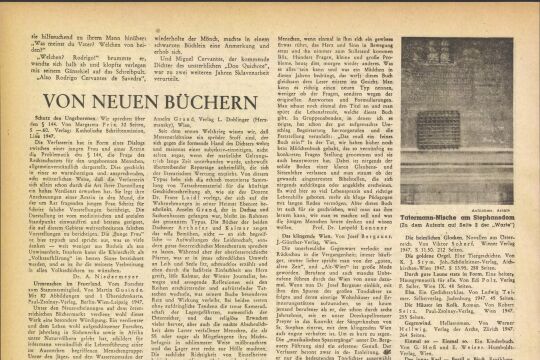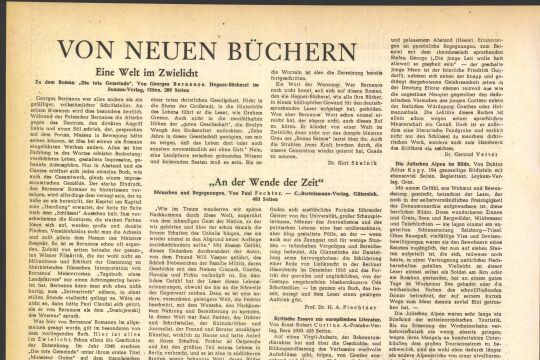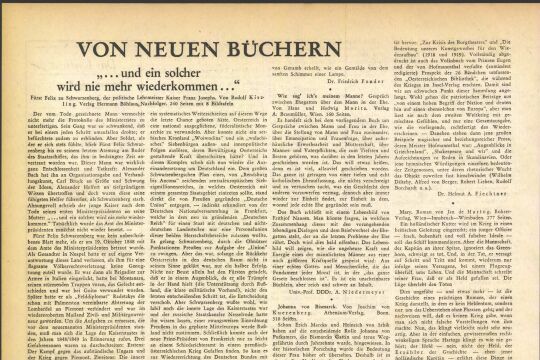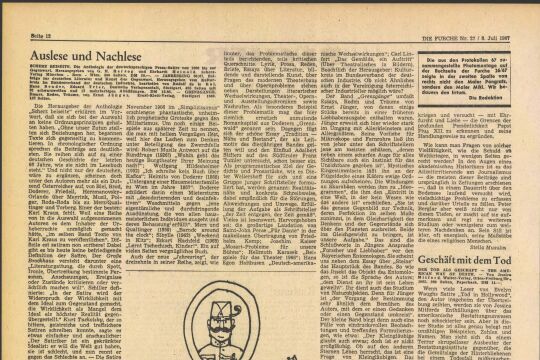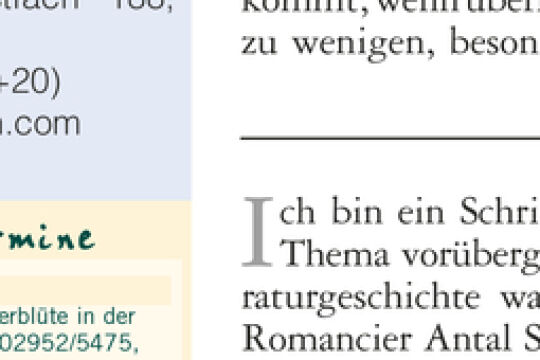Karl-Markus Gauß' neues Journal "Zu früh, zu spät".
Unlängst sagte André Heller, er habe erst spät entdeckt, dass man einfach glücklich sein könne und nicht andere verletzen müsse - wie Karl Kraus. Zu solcher Meeresstille der Seele hat Karl-Markus Gauß noch nicht gefunden, zum Glück für seine Leser.
Glossen wie jene über die irrtümliche Erschießung eines Autofahrers durch einen Wiener Polizisten lassen sich nicht schreiben ohne Wut im Bauch. Gauß attackiert nicht die Tat an sich, sondern ihre Beurteilung durch den Richter als "eine in keinster Weise rechtswidrige Vorgangsweise", ohne jeden Hinweis darauf, "dass das Verwenden der Waffe überschießend gewesen wäre". Wie Gauß dies als einen "vorsätzlichen Akt von Sprachschändung" entblößt, das ist von zwingender Brillanz, und dass er einen Zusammenhang herstellt zwischen dem Missbrauch des Worts und dem Missbrauch der Waffe, legitimiert ihn als Satiriker von Kraus'scher Façon.
Blick auf Familie
Das Pflücken und Zerpflücken solch fauliger Lesefrüchte ist aber nur eine Facette der Journale des Karl-Markus Gauß. Sie enthalten, kunstvoll ineinander verschränkt, genauso persönliche Anekdoten, historische Fundstücke, weltpolitische Analysen, Buchbesprechungen, Reiseskizzen, Nachrufe, Aphorismen.
In seinem neuen Buch lenkt der Autor den Blick auf seine Familiengeschichte, auf die Eltern, Donauschwaben, die nach dem Krieg als Flüchtlinge aus der Batschka nach Salzburg kamen, auf seine Frau, eine Lehrerin, und seine Kinder. Zu früh, zu spät wird so zu dem, was ein Tagebuch normalerweise ist: Preisgabe von Privatem. Deutlicher als in früheren Journalen stellt Gauß das eigene Leben in einen Zusammenhang. Als maßgeblich erweist sich dabei die gar nicht kleine Figur des Vaters, der als immens gebildeter Historiker keine adäquate Aufgabe fand und als Gymnasialprofessor und Redakteur eines Vertriebenenblattes an seiner Verachtung der Tüchtigen festhielt. Gauß porträtiert ihn, den konservativ-katholischen Anarchisten, den "Luftinspector", wie man im Kroatischen auf deutsch zu einem in höhere Sphären Entrückten sagt, mit liebevoller Ironie. Nicht zuletzt erklärt der Sohn den eigenen Ehrgeiz und Publikationsdrang mit der programmatischen Absichtslosigkeit des Vaters, der am Ende auch noch seinen mediokren Zeitungsposten verlor, weil er die Landsmannschaften verärgert hatte: Am Grab seines Vaters, der "großen Portalfigur des Scheiterns in meinem Leben", habe er sich (und dem Toten) geschworen, ihm würde es anders ergehen.
Bei aller Selbstentblößung ist auch Zu früh, zu spät alles andere als ein egozentrisches Werk. Jene "Zwei Jahre", die Gauß hier Revue passieren lässt, 2003/2004, sind geprägt von Vorkrieg und Krieg: Die US-Invasion in den Irak wird - medial - vorbereitet, irgendwann ist sie real. Gauß lehnt den Krieg ab wie die meisten hierzulande, aber er macht sich die Mühe einer differenzierten Argumentation und geht der transatlantischen Entfremdung (die er am Verhältnis zu den eigenen amerikanischen Verwandten augenfällig macht) auf den Grund: Amerika als "europäische Erfindung", die sich vom Mutterland abnabelt und dieses nach dem Desaster der Faschismen seinerseits neu erfindet, Europa, das seinen Neidkomplex in Verachtung und Nationalstolz umwandelt.
Uneingeschränkten Beifall bekommt nur der Delphin Tacoma, der für die US-Marine irakische Minen suchen soll und davonschwimmend desertiert: "Die Kreatur rettet die Ehre der Menschheit." Es ist das Gift eines Bewusstseins von Unausweichlichkeit, das Gauß auch in weniger dramatischen Prozessen nachweist, bis hin zur Privatisierung der österreichischen Post: Ökonomische Vorgänge als Naturgewalten zu beschreiben, besorgt allemal das Geschäft der Profiteure.
Bei aller Empörungsfähigkeit und-fertigkeit weiß der Autor nur zu gut, wie unfruchtbar reine Negativität ist. So ist er irgendwann aus der Riege der Österreich-Verdammer ausgeschert, um seine Kritik auf dem Fundament rotweißroter Rebellentradition zu formulieren, und das durchaus scharf: an den "Besitzstandmehrern", die die Verfechter des Sozialstaats als "Besitzstandswahrer" diffamieren, am "Amüsierfaschismus" (das Wort verkneift er sich nur halb), wie er sich im Red Bull-Hubschrauberspektakel in Salzburg zeige, das er mit Ernst Jüngers Verklärung der Luftschlacht assoziiert.
"Läppisches Brunzmandl"
Wenn es um das Verräterische von Dummheit und Borniertheit geht, entwickelt Gauß einen bärbeißigen Witz: bei der Verwechslung von "Schintoismus" und "Schitourismus" in einem seriösen deutschen Blatt, bei der Inszenierung von Skandalen - die sommerliche Aufregung um eine Salzburger "Gelatin"-Skulptur ist für ihn eine "Posse um ein läppisches Brunzmandl". Stets auf der Hut vor dem "Dünkel der Überlegenheit", versteigt er sich auch, schäumt gegen den Aktionismus oder mag das "Superwort" nicht, das Deutschland sucht. "Ich wollte lieber das Wort superklug gemacht haben als irgendeines", gestand einst Georg Christoph Lichtenberg.
Als Tagebuchschreiber sui generis sieht Gauß sich im Spiegel der Aufzeichnungen anderer: von Montesquieu und Henri-Frédéric Amiel, der seine Durchschnittsexistenz auf 17.000 Seiten festhielt, von Rudi Dutschke und Reinhold Schneider, von Aleksandar Tišma und Elias Canetti (Party im Blitz): "Der Haß war das Sprungbrett, von dem er weit und hoch abfederte."
Nicht zitiert Gauß die "Sudelbücher" Lichtenbergs, dessen "Schmierbuchmethode" ihm gefallen müsste. Dagegen bekennt er eine Seelenverwandtschaft mit Jean Améry, nicht zuletzt im Stachel des Verkanntwerdens, der Kränkung, weniger als Literat geschätzt zu werden denn als "Essayist", was immer das ist. Als Leserin begreift man das kaum, war Gauß doch seit seinem ersten Buch Tinte ist bitter, den "literarischen Porträts aus Barbaropa", unverkennbar eigen, auch als Stilist von kristalliner Prägnanz.
Leser und Aufleser
Das Eigene schließt Aneignung nicht aus, irgendwann entdeckt der Journalschreiber, einen vermeintlich originalen Gedanken von Manès Sperber entlehnt zu haben. "Lesen heißt borgen, daraus erfinden, abtragen", sagt Lichtenberg. So ist auch dieser Schreiber ein manischer Leser und Aufleser - und Fernseher, der sich selbst aufträgt: "Ein Hinschauer sein, kein Zuschauer!" Hinschauen bedeutet Anstrengung, statt Konsum, bedeutet Verstehenwollen, auch Überwindung: Schaurig genau beschreibt Gauß den filmisch dokumentierten Mord an einer Kollaborateurin im befreiten Frankreich, macht uns mit ihm zu dessen Augenzeugen.
Anders ergreifend das letzte Kapitel über die Mutter, die sich bis zuletzt schreibend gegen den Tod wehrte. "Als meine Mutter so lange starb, begann ich nach Jahren wieder von meinem Vater zu träumen." Dieser letzte Satz mutet eher wie ein Anfang an. Er passt zu jener diesseitigen Hoffnung des Jannis Ritsos, den Gauß in einer schönen Passage über die Insel Patmos zitiert: "Und doch - wir kommen nicht auf die Welt,/nur um zu sterben."
Zu früh, zu spät
Zwei Jahre
Von Karl-Markus Gauß
Paul Zsolnay Verlag, Wien 2007
409 Seiten, geb., € 25,60
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!