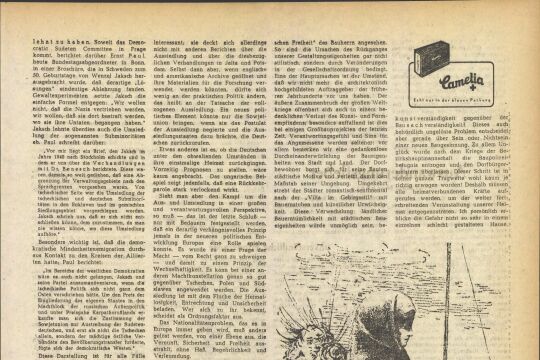Kritik ohne Kriterien: Von der Schwierigkeit, Urteile zu begründen und Argumente auszutauschen.
Wem hat der stolze Männerchor der Wissenden nicht schon das graue Lied vom Ende gesungen: der Religion, dem Abendland, Geschichte und Metaphysik, Manieren, Kunst, Erziehung, Pop, Sozialstaat, Wirklichkeit - das einzig Endlose ist offenbar die Litanei vom Ende. Eine derart ausgreifende Untergangsseligkeit macht misstrauisch. Dabei geht es wohlgemerkt weniger darum, dass man den gerade noch mit großem Pomp zu Grabe Getragenen in aller Regel schon kurz darauf wieder begegnet - besonders im Kulturbereich ist Scheinlebendigkeit ja durchaus keine Seltenheit. Entscheidend ist vielmehr, dass eine Formel, die die unterschiedlichsten Phämomene und Sachverhalte scheinbar mühelos in ein und derselben Metapher zusammenspannt, diese erstaunliche Fähigkeit vermutlich eher der suggestiven Macht des Bildhaften verdanken dürfte als konzentrierter Analyse. Wenn im Folgenden vom Ende der Kritik, oder genauer: der Kunstkritik die Rede ist, so geht es nicht um eine weitere feierliche Grablegung, sondern eher um einen nüchternen Kassensturz. Dabei kann es nicht schaden, zunächst einmal zu klären: Was genau ist mit Kritik gemeint und was mit deren Ende?
Welche Kritik ist gemeint?
Das Wort Kritik hat im Deutschen zwei Bedeutungen. Alltagssprachlich bezeichnet es ein absprechendes Werturteil, beinhaltet also einen Tadel. Man übt Kritik an etwas, mit dem man nicht einverstanden ist bzw. das einem nicht gefällt. Die These vom Ende der Kritik wäre dann gleichbedeutend mit der Behauptung, Kunst werde im Allgemeinen nicht kritisiert. Das ist, auch wenn man die Einschränkung "im Allgemeinen" sehr weit auslegt, offenbar unhaltbar. Kunst, gleich welcher Epoche, ist vor kritischen Urteilen niemals gefeit. Wie groß der gesellschaftliche Konsens über den herausragenden Wert eines beliebigen Werks, ob klassisch, ob modern, ob gefeiert oder unbekannt, im einzelnen auch immer sein mag, es wird sich stets jemand finden, der aus dem Gleichschritt der Verzückung ausschert. Natürlich kann man daran zweifeln, ob bei der Beurteilung künstlerischer Rangunterschiede jeder beliebigen Stimme per se das gleiche Gewicht zukommt. Doch selbst wenn man die These auf den Kreis derer einschränken wollte, die in diesem Zusammenhang gemeinhin unter Expertenverdacht stehen, lässt sie sich leicht falsifizieren. Denn obwohl in der wertsetzenden Literatur zum Thema Kunst seit eh und je die typische Genremischung aus ratlosem Andichten und euphorischem Kunstlob dominiert, finden sich unbestreitbar doch auch immer wieder skeptische, mitunter sogar vernichtende Urteile. Auf dieser Ebene funktioniert die These vom Ende der Kunstkritik also nicht.
Die zweite Bedeutung des Begriffs der Kritik geht auf den griechischen Wortstamm krinein = unterscheiden zurück. In diesem Sinne bezeichnet er ein wertendes Urteil, das nicht dogmatisch, sondern aufgrund einsichtiger, ausdrücklich benennbarer Kriterien gefällt wird, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob es zustimmend oder ablehnend ausfällt. Kritisieren heißt hier also nicht nur, ein Werturteil fällen, sondern es auch begründen zu können. Die These vom Ende der Kritik wäre in diesem Kontext gleichbedeutend mit der These vom Verlust verbindlicher Urteilskriterien. Diese Feststellung trifft fraglos eine Realität. Schon seit Anfang des 18. Jahrhunderts kann man die Geschichte der Kunst als Geschichte einer fortschreitenden Erosion tradierter Verbindlichkeiten erzählen: Gattungsgrenzen lösen sich auf, die Hierarchie der Sujets bricht zusammen, Maßstäbe handwerklicher Vollendung verlieren ihre Geltungskraft, ideelle Selbstverständlichkeiten werden problematisch, Gestaltungskonventionen brüchig, der Bildungs- und Interessenshorizont diffus. Aus Sicht der philosophischen Ästhetik stellt diese Entwicklung einen signifikanten Paradigmenwechsel dar: sie bedeutet den Abschied von einer normativen Ästhetik, die Kunstwerke als Exemplare einer Gattung (nämlich der Kunst) betrachtet, die spezifische Eigenschaften (etwa Schönheit) aufweisen und deren Rang dadurch begründet ist, dass sie diese Eigenschaften in besonderer Vollendung oder Fülle aufweisen.
Tradition oder Singularität
An die Stelle dieser Konzeption, innerhalb derer der Begriff der Tradition - verstanden als Auftrag an die Zeitgenossen, die künstlerischen Leistungen der Vergangenheit überbietend nachzuahmen - eine zentrale Stellung einnimmt, tritt in zunehmendem Maße die Vorstellung von der Singularität und Inkommensurabilität des Kunstwerks, dessen Kunstcharakter nunmehr davon abgeleitet wird, dass es sich normativen Festlegungen programmatisch entzieht. Man kann diesen Vorgang gleichermaßen als Fortschritts- oder auch als Verfallsphänomen interpretieren. Für beides lassen sich plausible Gründe anführen, je nachdem, ob man den Gewinn an künstlerischer Autonomie oder aber den Traditions- bzw. Legitimationsverlust akzentuiert. Dass sich die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts mehrheitlich für die erste Lesart entschieden hat, ist keine Konsequenz überlegener Argumente, sondern zeugt lediglich von der normativen Kraft des Faktischen: Geschichte wird nun einmal aus der Siegerperspektive geschrieben. Entscheidend ist allerdings weniger, ob man diese Entwicklung bedauert oder begrüßt, sondern ob man, wie zahllose Kritiker der Moderne, eine Reetablierung verbindlicher Urteilsnormen für möglich bzw. sinnvoll hält. In diesem Fall wäre die These vom Ende der Kritik mit der Hoffnung auf deren Wiedergeburt verbunden - einer Hoffnung, die allerdings, wie die Erfahrung zeigt, chronisch betrogen wird, weshalb sich in aller Regel in die Klage über den Verlust verbindlicher Wertstandards die Bitterkeit über das Ausbleiben günstiger Vorzeichen für ihre Wiederkunft mischt.
Sehnsucht nach Kriterien
Nun ist die Sehnsucht nach normativer Sicherheit - die beleibe keine Spezialität kulturkonservativer Denker, sondern offenbar derart tief im abendländischen Denken verwurzelt ist, dass sie selbst noch die Programme der vermeintlich so normenlibertären Avantgarde durchzieht - durchaus verständlich: Kritik ohne verbindliche Standards ist ohne Frage eine brüchige Veranstaltung. Wenn man sich allerdings die Rahmenbedingungen der Epochen etwas genauer ansieht, denen wir für gewöhnlich eine normative Ästhetik unterstellen, so wird deutlich, wie sehr sie sich von denen der Gegenwart unterscheiden. In Mittelalter und Renaissance etwa galt - cum grano salis - gleichermaßen die Vergegenwärtigung von Schönheit als Ziel künstlerischen Gelingens. Obwohl also in beiden Fällen die Kunst sich an ein und demselben Leitwert orientierte, entwickelten sich die Gestaltungssprachen beider Epochen in völlig unterschiedlicher Weise. Das ist kaum erstaunlich: Man kann schließlich alles ästhetisch erleben - und zudem, wie der Widerwille der Renaissance gegen das "Gotische" zeigt, durchaus sehr Unterschiedliches - als schön. Jede praktische Ästhetik muss aus dieser Überfülle an Möglichkeiten eine Auswahl - und zwar nach Möglichkeit eine hierarchische - treffen. Ein Kriterium für die Frage, weshalb man dem einen ästhetischen Erlebnis den Vorzug vor dem anderen geben sollte, lässt sich aus dem Bereich des Ästhetischen allein aber nicht - oder genauer: nur um den Preis der Preisgabe jeglicher überindividueller Geltungsansprüche - gewinnen. Dass darin ein Problem liegen könnte, blieb die längste Zeit der Zivilisationsgeschichte unbemerkt, denn schließlich konnte man zur Beilegung von Unstimmigkeiten jederzeit auf allgemeine, dem Bereich des Ästhetischen wie auch des Handwerklichen übergeordnete Ordnungsvorstellungen rekurrieren. Natürlich wurde auch dabei nicht in jedem Fall ein Konsens erzielt: auch Theologie und Metaphysik werfen schließlich Fragen auf. Tatsache aber ist, dass die Legitimation gestalterischer Arbeit in einen wertstiftenden Hintergrundrahmen eingefügt war. Was Kunst sei und wozu sie unternommmen werde, welche Aufgaben sie zu übernehmen und wie diese angemessen auszuführen seien - all diese für uns heute so virulenten Fragen fanden dort in letzter Instanz eine erschöpfende Antwort.
Was ist Kunst?
Nun haben derartige Ordnungsvorstellungen, mit welch universalem Anspruch sie auch immer auftreten mögen, in den westlichen Industriegesellschaften - die zwar nicht die Kunst, aber die Institution Kunst geschaffen haben - gegenwärtig nicht mehr annähernd vergleichbare Plausibilität und suggestive Strahlkraft wie noch vor einigen hundert Jahren. Zur Beilegung ästhetischer Urteilsdifferenzen können sie also nur noch in sehr begrenztem Maß beitragen. Diese Entwicklung ist zwar nicht denknotwendigerweise irreversibel. Es scheint allerdings mehr als unwahrscheinlich, dass sie in unserem Kulturkreis in absehbarer Zeit wieder rückgängig gemacht werden könnte. Verstehen wir unter der These vom Ende der Kritik also den Verlust verbindlicher Urteilskriterien, so müssen wir sie wohl oder übel bejahen. Aber was folgt daraus? Schließlich bedeutet der Umstand, dass uns ein unfehlbares Maß für künstlerisches Gelingen abhanden gekommen ist, weder, dass wir Werken, die Kunstanspruch geltend machen, keine Wertschätzung mehr entgegen brächten, noch dass wir keinen Drang mehr verspürten, unsere Haltung zu begründen.
Argumente ohne Ende
Eine solche Begründung ist, wenn man sich nicht mehr auf unverbrüchliche Standards verlassen kann, zugegebenermaßen ein schwieriges Geschäft, das in vielen Fällen nicht zu einem befriedigenden Ende führt. Es ist jedoch auch nicht schwieriger als der Versuch, einen Konsens etwa über politische Zielvorstellungen oder auch nur über Manieren herzustellen. Auch da können wir die Vortrefflichkeit unserer eigenen Position längst nicht mehr schlüssig beweisen, sondern müssen wohl oder übel versuchen, für sie zu werben, sie anderen plausibel zu machen, auf welchen argumentativen Bahnen auch immer. Auch da sind wir mit Dummheit, Anmaßung und ideologischer Blindheit konfrontiert, auch da sehen wir uns rhetorischer Nebelwerferei, geschwätziger Beredsamkeit und rhetorischen Einschüchterungsversuchen gegenüber. Das ist ohne Frage bedauerlich, spricht aber nicht für ein baldiges Ende der Verhandlungen, sondern wohl eher für ihre Unabschließbarkeit.
Der Autor ist Gastprofessor an der Universität für Angewandte Kunst und Autor des Buches "Die Beschämung der Philister. Wie die Kunst sich der Kritik entledigte" (zu Klampen Verlag 2003).
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!