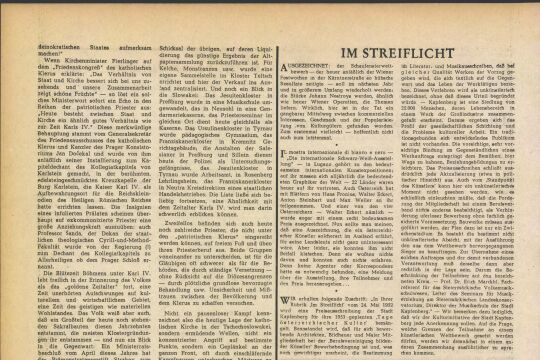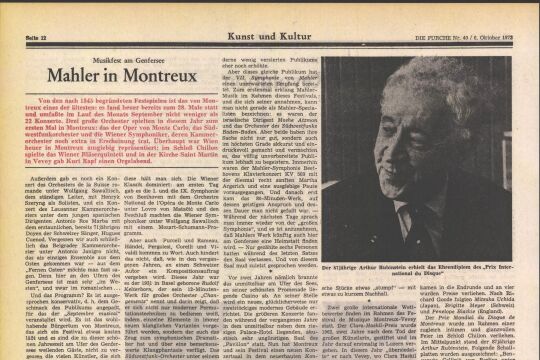Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Auf dem Wege zum Variete
EIGENTLICH SOLLTE das 30. Internationale Festival der zeitgenössischen Musik in Venedig mit einer grandiosen VarietivorsteUung beginnen. Selbstverständlich ein Varieti mit Scherz, Satire, Ironie und tieferer Bedeutung, in der Richtung auf ein neues Gesamtkunstwerk, wie es unter der Leitung des Venezianer Maestros Bruno Maderna schon im vorigen Jahr die Holländer versucht hatten. Aber „La donna e mobile“, und die Venezianer Biennale, in deren Rahmen sich auch die Musikfestivals abspielen, ist eine besonders kapriziöse Dame. Nach den an der Lagune üblichen Protesten, Intrigen und Polemiken fiel das Variete ins Wasser. Statt dessen wurde zu Ehren des jüngst verstorbenen Hermann Scherchen das Festival auf die würdigste Weise mit der klassischsten aller modernen Kompositionen, den sechs Stücken für Orchester, op. 6 von Anton von Webern aus dem Jahre 1909 eröffnet, und Bruno Maderna konnte abermals zeigen, daß er nicht nur ein Schüler Scherchens ist, sondern auch ein wahrer Meister, der mit handwerklicher Treue stundenlang jeden Paukenschlag und jeden Trompeteneinsatz probt, bis alles so vollkommen klingt, wie er es sich vorstellt.
NEBEN DIESEM VON ALLEN SCHLACKEN BEFREITEN Webern hatten die anderen Werke des Eröffnungskonzerts, zwei Orchesterstücke des in Moskau geborenen Schweizers Wladimir Vogel, eines Schülers von Skrjabin und Busoni, die Zehnte Symphonie des 85jährigen Malipiero und die „Epifanie“ von Luciano Berio, ein Auftragswerk des Südwestdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1959, einen schweren Stand. Immerhin erhielt der zweiundvierzigjährige Luciano Berio, neben dem gleichaltrigen Luigi Nono der repräsentativste Komponist der jungen Italiener, für sein etwas künstlich zusammengefügtes Gemenge aus drei Orchesterstücken und einer Reihe von Liedern von seinen Landsleuten reichen Beifall. — Nach diesem feierlichen, philosophisch und literarisch überladenen Auftakt wurde es munterer und wesentlich jugendlicher. Während sich an den Nachmittagen die dreißigjährigen Italiener im Apollo-Saal mit mehr oder minder Glück produzierten, traten am Abend auf der großen Opernbühne des Fenice-Theaters auswärtige Tanztruppen und Solisten auf, die in jedem internationalen Variete am Platz gewesen wären. Die Leiter des Festivals hatten ihre Grundidee, das Festival leichter und populärer zu gestalten, nicht aufgegeben...
DA NICHT IN JEDEM JAHR eine sensationelle Uraufführung wie 1951 die von Strawinskys „Rake's Progress“ möglich ist, mußte man sich mit künstlerisch und finanziell weniger anspruchsvollen Darbietungen begnügen. Eine in Europa noch unbekannte Tänzertruppe, die die altindische Tanzkunst wiederbeleben will, Kerala Kalamandalam, führte in einer fast dreistündigen rein pantomimischen Darstellung Szenen aus dem Legendenspiel „Mahabharata“ vor, eine gruselige, bluttriefende Geschichte einer Inderin, die glücklich mit fünf Brüdern verheiratet ist, bis ein fremder Eindringling den Frieden stört und dafür von einem ihrer Ehegatten mit Hilfe des göttlichen Helden Krischna umgebracht wird. Der Stil ist von Bali viel weiter entfernt als vom japanischen Kabüki, die Musikbegleitung besteht aus einem Dauertrommler und einem Litaneisänger, was das ganze nicht gerade kurzweiliger macht.
LEICHTER ZUGÄNGLICH für westliche Ohren und Augen, wenn auch weniger originell, war ein amerikanisches Negerballett, das Alvin Alley Dance Theater, eine der vom US State Department ausgesandten kulturpolitischen Reisetruppen, die in erster Linie für Südostasien bestimmt sind, aber dazwischen auch in Europa ihr technisches Können zeigen. Wirklich großes Varietetheater war die One-Woman-Show der armenisch-amerikanischen, nun in Mailand ansässigen Sängerin Cathy Berberian, die geistsprühend mit einem Programm, das von den Beatles über John Gage und Kurt Weill bis zu Strawi/nsky reichte, das Publikum zwei Stunden aufs vorzüglichste unterhielt. Auch eine Minisensation für Feinschmecker fehlte nicht: das letzte, 1966 komponierte Werk Strawinskys, „The Owl and the Pussy Cat“, ein Zwölftonlied mit Klavierbegleitung auf einen absurden Text — gewissermaßen eine Fortsetzung der Kinderlieder, die Strawinsky vor einem halben Jahrhundert geschrieben hat und die Cathy Berberian ebenfalls musikalisch und schauspielerisch mit ungewöhnlichem Charme wieder in Erinnerung brachte. Luciano Berio erwies sich als Pianist und Dirigent des Abends zugleich auch als Instrumentator zahlreicher Stücke, unter anderem einiger bekannter Schlager aus Weills „Dreigroschenoper“ und „Mahagonny“, als ein in allen Sätteln gerechter Gebrauchsmusiker.
MAN SIEHT, DIE VENEZIANER sind nicht verlegen um neue Wege und Auswege. Indes, der Direktor des Festivals und des Fenice-Theaters, Mario Labroca, der zu Anfang in einer Pressekonferenz das Bekenntnis abgelegt hatte: „Ich halte es für keine Schande, Varietedirektor zu sein“, war gescheit genug, zum Abschluß in der Scuola di San Rocco, dem schönsten Konzertsaal der Welt, Friedenstöne erklingen zu lassen. Er gab zwar auch da die Extravaganzen nicht ganz auf: Ein auf höchste Diskanttöne aufgebauter und vom Chor des schwedischen Rundfunks mit unvergleichlicher Virtuosität vorgetragener Lobgesang des Schöpfungsgottes auf sein Werk des schon vielfach bewährten Mailänder Komponisten Nicole Castiglioni, „Gyro“, klang eher wie ein Lehrstück für künftige Koloratursängerinnen. Die schwedischen Damen, in Lichtblau wie für eine Wagner-Oper gekleidet, sangen es so leicht, als ob es ein Kinderspiel wäre. — Wer sich mit dieser Behandlung eines Bibelzitates nicht ganz befreunden konnte, wurde durch das ziemlich konventionelle, aber solid gebaute, bereits 1965 in Stockholm uraufgeführte Requiem des Ungarn György Ligeti entschädigt, das tags darauf gelegentlich des Bonner Musikfestes mit dem Beethoven-Preis ausgezeichnet wurde.
SO KONNTEN ALLE befriedigt den Heimweg antreten. Nur Signor Labroca war noch etwas düster gestimmt, denn wohl mehr aus finanziellen als aus künstlerischen Gründen steht es noch nicht fest, ob 1968 das 31. Internationale Festival für zeitgenössische Musik zustande kommen wird. Doch solche Sorgen sind in Venedig nicht ungewöhnlich. Was man dort an Neuem und an Altem zeigt, scheint immer etwas gebrechlich und gefährdet zu sein. Aber dann geht es doch weiter. Zum Glück ist Venedig nicht so leicht zu zerstören, wie die Cassandren befürchten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!