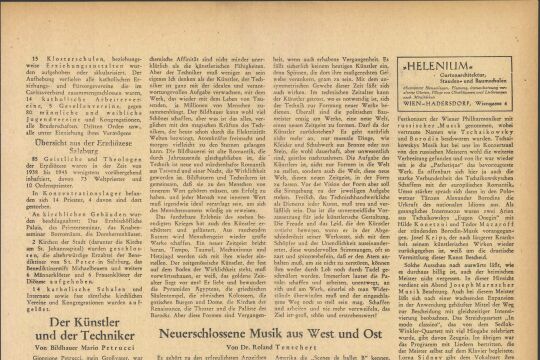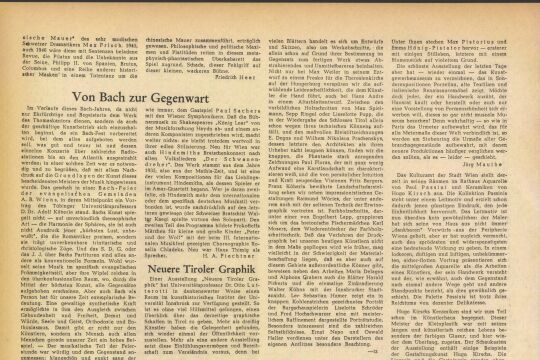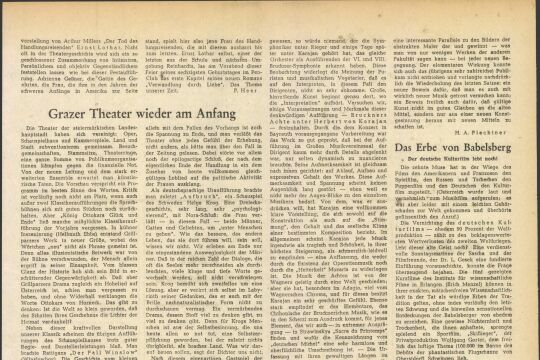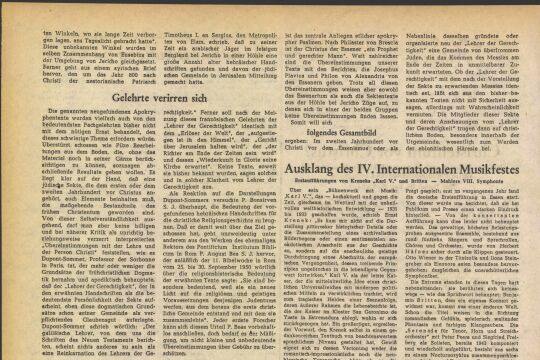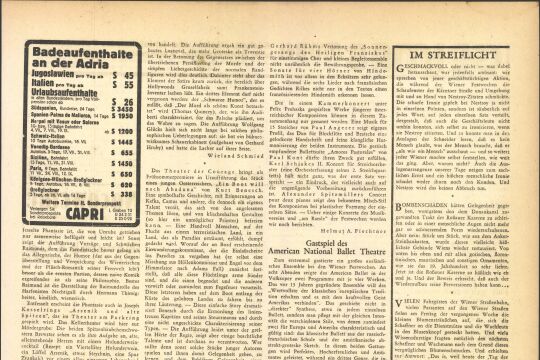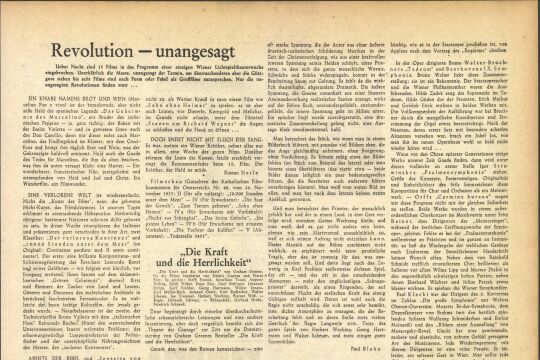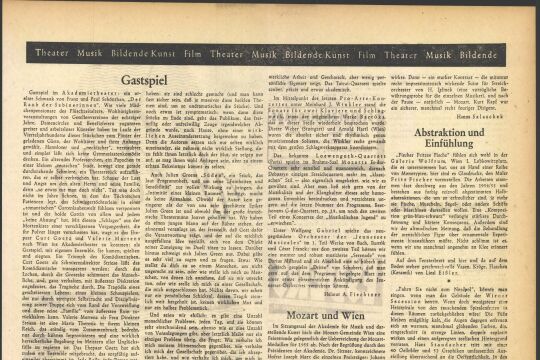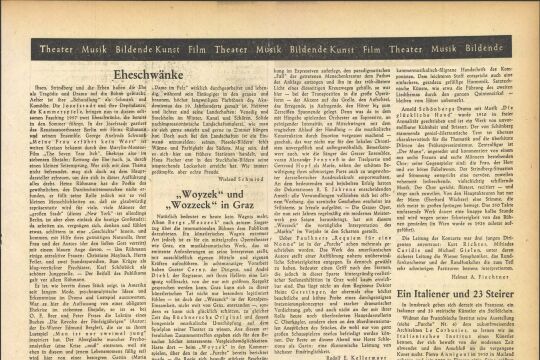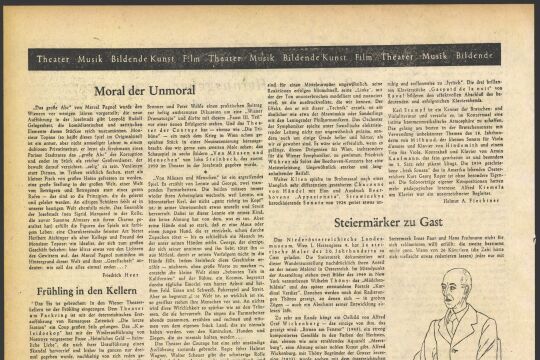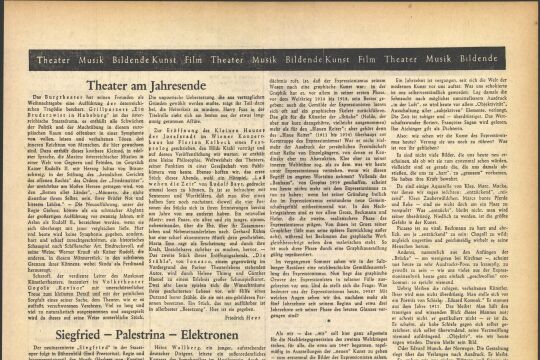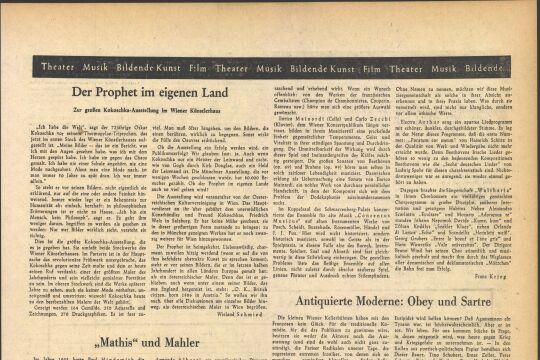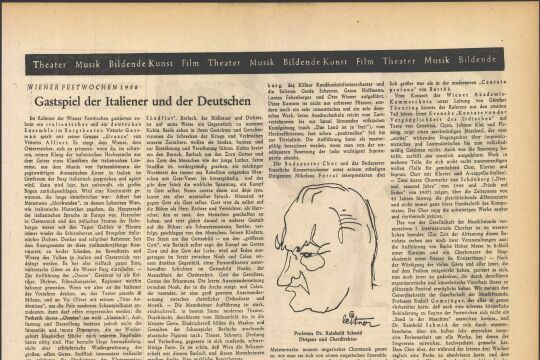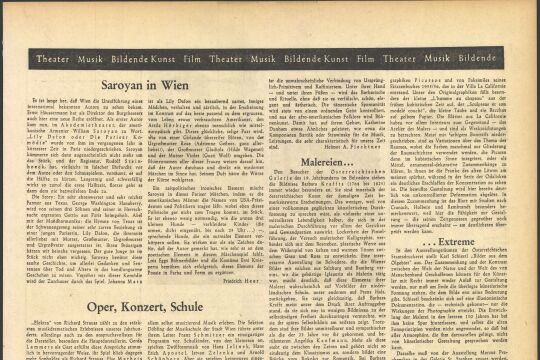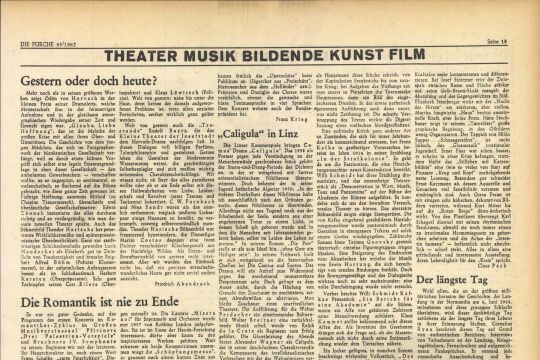Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Die Kluge“ von Orff in der Volksoper Fuf twängler dirigiert Furtwängler
Es hat lange genug gedauert, bis man sich dazu entschloß, der „Klugen“ die Volksoper zu öffnen. Genau zehn Jahre sind nach ihrer Uraufführung in Frankfurt vergangen, und seither wurde das erfolgreiche Werk an fast allen großen und kleinen deutschsprachigen Bühnen gespielt (auch Klagenfurt und Innsbruck sind der Wiener Staatsoper zuvorgekommen). Muß man sie und ihren Autor, einen der großen Erneuerer des zeitgenössischen Musiktheaters, noch vorstellen? Orff kommt von der Münchner Günther-Schule für Tanzgymnastik, begann mit Lehrstücken und Schulwerken und ist ein gelehrter Kenner der Antike und der deutschen mittelalterlichen Dichtung („Orfeo“ nach Monteverdi, Carmina Burana, Catulh Carmina und Trionfo di Afrodite). „Die Kluge“, der 1939 „Der Mond“ vorausgegangen war, ist die Dramatisierung eines uralten, auch im Orient und in Afrika vorkommenden Märchenmotivs. Die Musik ignoriert — wenn wir von einigen parodistischen Stellen absehen — bewußt die gesamte klassischromantische Entwicklung und knüpft an Urformen an: an rhythmischen Sprechgesang, primitive Tanzformen unjd modale Volksweisen. Vor allem aber ist der Bayer Orff ein Magier des Theaters. Im Unterschied zu seinen Partituren, die bis ins kleinste Detail präzisiert sind, bietet sein Bühnenwerk dem Regisseur reiche und vielfältige Interpretations-mögüchkeiten. Leider hat man sich einige davon bei der verspäteten Wiener Premiere entgehen lassen. Auch war die Tendenz spürbar, durch Generalisierung des Stiles der Rüpelszene aus der „Geschichte vom König und der klugen Frau“ eine Rüpel-Oper zu machen, was sie ganz und gar nicht ist. Da Vorder- und Hinterbühne nicht genügend scharf voneinander getrennt waren, konnten die möglichen Effekte der Simultanbühne nicht genügend genutzt werden. — Gott sei Dank: eine „Sparinszenierung“ — und kein neureicher „Vogelhändler“! (In den Hauptpartien: Esther Rethy, Kurt Pregcr, Karl Dönch, Rudolf Christ und Fritz Krenn.)
Viel besser gelang die Inszenierung von M e n o 11 i s „M e d i u m“, eines überaus wirkungsvollen und brutalen Reißers im Grand-Guignol-Stil, der jahrelang am Broadway lief und seinen Autor berühmt machte. Das faszinierende Bühnenbild schuf Robert Kautsky. Unübertrefflich: Rosette Anday als Inhaberin des spiritistischen Salons „Flora“, sehr angenehm und rührend Dorothea Siebert mit ihrem Partner, dem stummen Toby (Richard Novotny). — Adolf Rott war der Regisseur dieser beiden spannenden und unterhaltsamen Kurzopern; M e i n h a r d Z a 11 i n- -g e r hatte die musikalische Leitung.
Ein Werk, das gleichfalls schon längst 'von einem unserer beiden Opernhäuser hätte gespielt werden sollen, ist B e 1 a B a r t 6 k s Einakter „Herzog Blaubarts Bur g“, den wir beim IV. Internationalen Musikfest gehört haben und der bei der letzten Aufführung im Zyklus „Musica viva“ unter Paul Sacher einen noch stärkeren Eindruck machte. Diesmal sang Hilde Rössel-Majdan die Partie der Judith und Heinz Rehfuß — wie bei der ersten Aufführung — die Titelrolle. „Bartok schuf mit .Herzog Blaubarts Burg' ein Werk, das vom ersten bis zum letzten Takt von unwiderstehlicher suggestiver Kraft erfüllt ist... das nur einen Wunsch offen läßt: es nochmals zu hören.“ Diesem Urteil Zöltan Kodälys kann man vorbehaltlos zustimmen. — Seine Meisterschaft bei der Interpretation moderner Musik zeigte Paul Sacher auch in Bartöks „M u s i k für Saiteninstrumente, Schlagzeug und C e 1 e s t a“ aus dem Jahre 1936, die an dieser Stelle gleichfalls besprochen wurde. (Es spielten die Wiener Symphoniker.)
Im 6. Abonnementkonzert der Wiener Philharmoniker dirigierte Wilhelm Furtwängler seine 2. Symphonie. Leichter als die positive Beschreibung dieser Musik ist es, zu sagen, was sie nicht ist. Furtwänglers Symphonie ist keine „neue“ Musik und sie ist keine „Kapellmeistermusik“, sie ist weder „epigonal“ im engen Wortsinn noch „akademisch“. Sie entspringt einer kultur-konservativen, resignierenden Haltung, wie sie Grillparzer in dem bekannten Epigramm ausgesprochen hat: „Nur weiter, weiter geht ihr tolles Treiben / Von vorwärts! vorwärts! schallt das Land: Ich möchte, wär's möglich, stehen bleiben / wo Schiller und Goethe stand.“ Freilich sind Schiller und Goethe bei Furtwängler nicht Mozart und Beethoven, sondern Brahms, Tschaikowskij, Grieg und einige andere jener Generation. Wer Furtwänglers heftige Polemik gegen die Moderne kennt, wird hiervon nicht überrascht sein. Um so weniger begreift man die Nichtberücksichtigung der formalen Fassungskraft des Hörers, für den sich die vier Riesenblöcke dieser Symphonie mit einer Gesamtdauer von achtzig Minuten nicht zum Ganzen fügen können. Hervorgehoben sei die auf Brillanz .und .Virtuosität verzichtende Instrumentierung, besonders im letzten Teil ein vielstimmiger Blechbläsersatz, der — gedämpft und sonor — bald die „Götterdämmerung“, bald „Le Martyre de St. Sebastien“ beschwört.
Die Leitung der letzten Aufführung des „Buches mit sieben Siegeln“ von Franz Schmidt war dem jungen Hamburger Dirigenten Wilhelm Schüchter anvertraut, der auch einige vorsichtige und geschickte Retuschen an der Partitur vorgenommen zu haben scheint. Vom großen Chor des Singvereins und den Symphonikern gründlich studiert, klang das Werk ganz ausgezeichnet und wirkte kürzer als in jeder vorhergegangenen Aufführung. Dem hochbewährten Julius Patzak traten Dorothea Siebert, Myra Kaiin, Erich Majkut und Otto Edelmann zur Seite und bewährten sich mit ihren schönen Stimmen. Alois Forer spielte den Orgelpart.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!