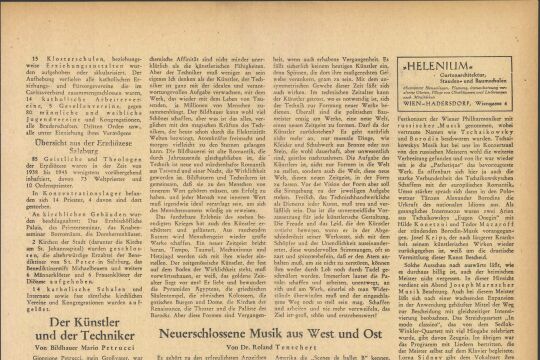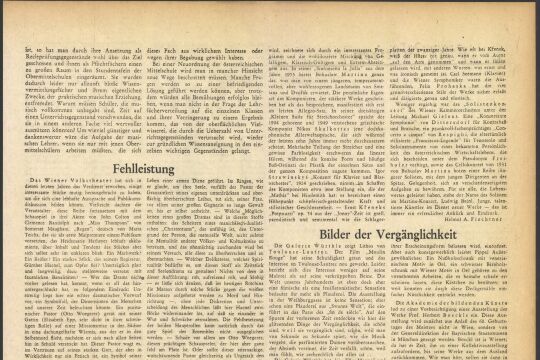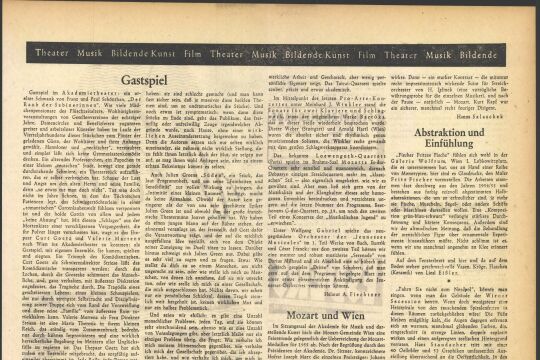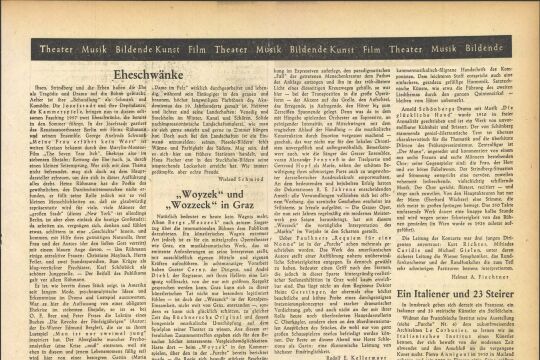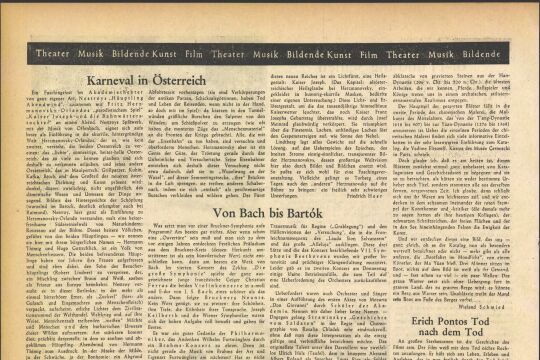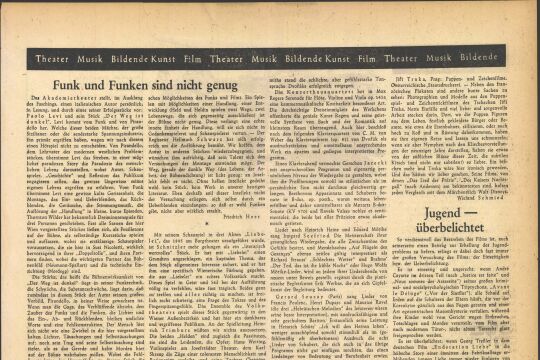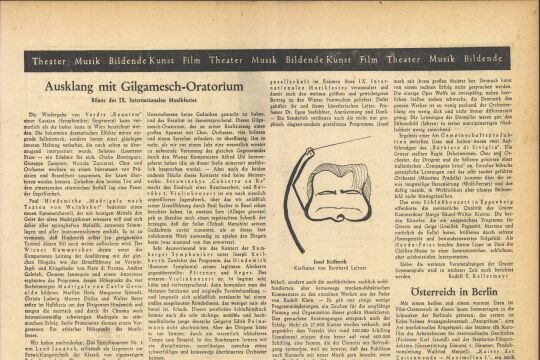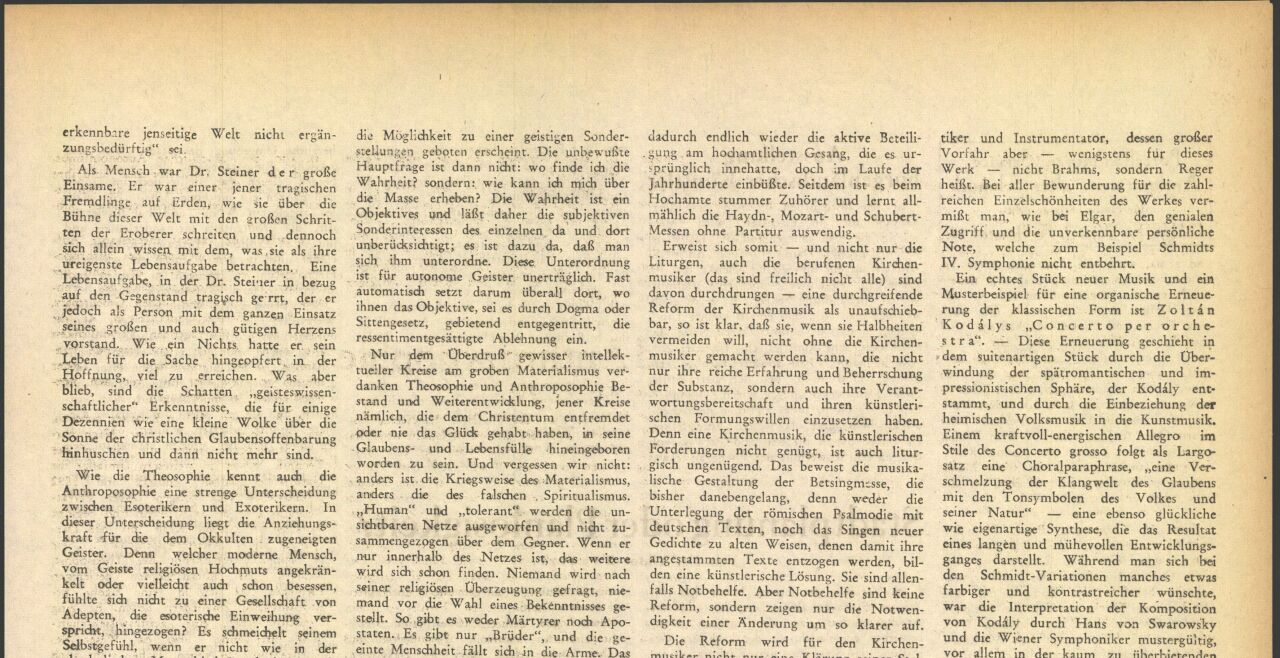
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Erneuerung der klassischen Formen
In dem Zyklus „Ausländische Meisterdirigenten“ interpretierte der englische Dirigent italienischer Abstammung John Barbirolli mit den Philharmonikern die „En i g rh a“ - Va r i a t i o n e n von Edward Elgar. 1857 geboren und 1934 gestorben, steht Elgar zwischen zwei musikalischen Epochen. Die vor allem während der Klassik und Romantik beliebte Form der Variation bereichert Elgar um ein sehr gepflegtes Stück, das allerdings, mehr durch die Qualität seiner Dar-stellungsmittcl als durch Ursprünglichkeit und Genialität der Eingebung fesselt. Neu an dem unter Hans Richter 1899. in London uraufgeführten Werk ist, daß sich in jeder der 14 Variationen der Charakter eines der Freunde des Komponisten spiegelt — die „Charaktervariation“ also einmal konsequent verwirklicht wurde. Ein sehr großes, sehr differenziert behandeltes Orchester steht im Dienste dieser maßvollen Charakterisierungskunst, die es — ob aus Vornehmheit oder aus Unfähigkeit möchte ich nicht entscheiden — vermeidet, an den Wesenskern der Erscheinungen zu rühren. Musikalisches Neuland wird weder erobert noch betreten. Entwicklungsgeschichtlich steht das Werk etwa auf einer Linie mit Brahms.
Barbirolli stellte die Elgar-Variationen zwischen ein Concerto grosso von Händel und Beethovens VII. Symphonie. In allen dargebotenen Werken wurde deutlich, daß sich der Dirigent nicht so sehr von der jedem einzelnen Opus zugrunde liegenden Idee leiten läßt, sondern vor allem auf eine exakte und tonschöne Wiedergabe des Details zielt. Allem Rhythmischen gilt seine besondere Aufmerksamkeit, was der Beethoven-Symphonie besonders zugute kam. Die Philharmoniker wurden von Barbirolli zu einer sehr guten Leistung angespornt, waren aber weit davon entfernt, ihr Letztes herzugeben. *
Der Wiener Meister Franz Schmidt (1874 bis 1939) gehört ebenfalls noch jener Generation an, die berufen war, das klassische Erbe zu bewahren. Die „V a r i a-tionen über ein Husarenlied“ zeigen ihn als kenntnisreichen Kontrapunktiker und Instrumentator, dessen großer Vorfahr aber — wenigstens für dieses Werk — nicht Brahms, sondern Reger heißt. Bei aller Bewunderung für die zahlreichen Einzel Schönheiten des Werkes vermißt man, wie bei Elgar, den genialen Zugriff und die unverkennbare persönliche Note, welche zum Beispiel Schmidts IV. Symphonie nicht entbehrt.
Ein echtes Stück neuer Musik und ein Musterbeispiel für eine organische Erneuerung der klassischen Form ist Z o 11 a n Kodalys „Concerto per orche-s t r a“. — Diese Erneuerung geschieht in dem suitenartigen Stück durch die Überwindung der spätromantischen und impressionistischen Sphäre, der Kodaly entstammt, und durch die Einbeziehung der heimischen Volksmusik in die Kunstmusik. Einem kraftvoll-energischen Allegro im Stile des Concerto grosso folgt als Largosatz eine Choralparaphrase, „eine Verschmelzung der Klangwelt des Glaubens mit den Tonsymbolen des Volkes und seiner Natur“ — eine ebenso glückliche wie eigenartige Synthese, die das Resultat eines langen und mühevollen Entwicklungsganges darstellt. Während man sich bei den Schmidt-Variationen manches etwas farbiger und kontrastreicher wünschte, war die Interpretation der Komposition von Kodaly durch Hans von Swarowsky und die Wiener Symphoniker mustergültig, vor allem in der kaum zu überbietenden Sicherheit und Exaktheit der Wiedergabe. Im zweiten Teil des Programms stand die II. Symphonie von Brahms. *
Unter dem gleichen Dirigenten spielten die Wiener Symphoniker im 1. Symphoniekonzert der Wiener Konzerthausgesellschaft Bachs Präludium und Fuge in Es-dur in der Bearbeitung für großes Orchester von Arnold Schönberg. Es war klar, daß der kluge und eklektische moderne Musiker weder eine Orgelimitation, noch eine Bearbeitung im Stile Stokowskis produzieren würde. Vom Geiste Bachs und dem Stil des 18. Jahrhunderts entfernt sich aber auch Schön bergs Bearbeitung so weit, daß nur die Geste der Bemühung um ein großes kontrapunktisches Werk der Vergangenheit festgehalten zu werden verdient.
Die „Impressionen für Orchester“, opus 8, von Theodor Berge r sind — entwicklungsgeschichtlich gesehen — ein Rückfall in jene primitivdeskriptive Musik, die wir endgültig überwunden glaubten. Nachdem dieses Genre und dieser Stil bei den französischen und spanischen Meistern (Debussy, Ravel, de Falla und Albeniz) bis zur Vollendung ausgebildet wurde, kann es für absehbare Zeit nur noch Epigonentum oder eine Vergröberung dieser Gattung geben; höchstens eine sehr persönliche oder spezifisch österreichische Umformung, wie wir sie etwa in den Werken unserer Wiener Meister Marx und Kornauth vor uns haben. Die Sägemühlen-und Werkstattrhythmen sind recht grob geraten und bringen nur musikalischen Rohstoff. Zu dieser Musik fehlt der Filmstreifen. Es ist sehr wohl nachzufühlen, welche Faszination der Lärm und das rhythmische Dröhnen großer Maschinenhallen auf den auditiven Menschen ausüben können. Ob man diese Eindrücke in Musik umsetzt, ist eine Frage der Einstellung, die man zur Musik und zur Kunst im allgemeinen hat. Ihre Verwertung kann nur auf dem Wege einer weitgehenden Sublimierung, zu deutsch: Veredelung, erfolgen. Und ferner: Was wird einmal von dieser Musik übrigbleiben, wenn die zeitgebundenen (und heute schon nicht mehr ganz zeitgemäßen) Instrumentationseffekte veraltet sein werden? Diese — und das sei vorbehaltlos anerkannt — beherrscht der junge Komponist in erstaunlichem Maße.. Er ist ein Virtuos des Orchesters. Ebenso virtuos war die Wiedergabe durch die Wiener Symphoniker, welche auf dem Wege sind, unter ihrem neuen Leiter ein Meisterorchester zu werden.
Von Dimitri Schostakowitsch, dem 1906 geborenen russischen Komponisten, wurden hier bereits mehrere Symphonien aufgeführt. Seine V. Symphonie erklang unter Josef Krips im Rahmen eines Festkonzerts anläßlich des Staatsfeiertages der Sowjetunion zum zweitenmal. Nicht nur in seiner äußeren Form ist das Werk Schostakowitschs dem klassischen Erbe zutieft verpflichtet Sehr eigenwillig, originell und genial wird die klassische Form bei Schostakowitsch erneuert und mit neuem Inhalt erfüllt. Gewiß müssen sich — für unser Gefühl wenigstens — bei ihm noch viele Ecken und Kanten abschleifen, und man hat oft den Eindruck, daß er mit seinen Themen allzu verschwenderisch umgeht. Aber unerschöpflich, wie die Erde seines großen Heimatlandes, erntet Schostakowitsch dreimal im Jahr, schleudert Werk auf Werk heraus und — innerhalb jedes neuen Opus (er hat schon 10 Symphonien geschrieben) — Thema auf Thema. Kraftvoll und unverbraucht, ist seine Musik klingender Ausdruck und Symbol für das Land, dem er entstammt.
Zum 51. Geburtstag Paul Hi n d c-m i t h s veranstaltete das C o 11 e g i u m m u s i c u m ein Festkonzert, das einen Querschnitt durch das kammermusikalische Schaffen des Komponisten bot. Die einzelnen Werke aus den drei Perioden Hindemiths sind von fast gleichem Wert und Interesse. Sie weisen jene Merkmale auf, tue Hindemiths Gesamtwerk charakterisieren: echtes, ursprüngliches Musikan-tentum, Stileinheit und Sauberkeit. Seine Musik ist durchaus immaterieller Natur und in hohem Maße vergeistigt. Das tritt nirgends so deutlich zutage, wie in dem „M a r i e n 1 e b e n“ nach Texten von Rilke, die durch Hindemiths Musik nicht nur ihrer Manier und des Allzumenschlichen entkleidet, sondern auch in jene geistig-religiöse Sphäre gehoben werden, welche dem Stoff angemessen ist.
Da die jungen Künstler des Collegium musicum die dagebotenen Werk nicht nur gut einstudiert hatten, sondern auch mit Hingabe und Begeisterung musizierten, seien die Solisten der einzelnen Werke besonders hervorgehoben. Allen voran: Kurt R a p f, der die Auswahl traf, das Kammerorchester leitete und am Klavier begleitete; Kamillo Wanausek, der die Flötensonatc spielte; H. Müller-Ecker, die Solistin des Cellokonzerts; Maria Kytka, die Interpreten des „Marienlebens'', und Friederike., Ratzer als Partnerin von Kurt Rapf in der „Sonate für zwei Klaviere“ 1942.
Klassische Form aber heißt nicht klassisches Schema. Und wenn man heute eine Cembalomusik schreibt, so ist man damit der Verpflichtung zu originaler und zeitgerechter Erfindung nicht enthoben. Alte Formen lassen sich nicht kopieren, sondern nur erneuern. Eas ist weder Fritz von Leeder, geboren 1872 (Concert im alten Styl für Cembalo und Streichinstrumente), noch Robert Neßler, geboren 1919 (Introduktion und Alkgro), gelungen. Was dabei herauskommt, ist Kunstgewerbe, bestenfalls Epigonenkunst. Gerade auch die Kenner und Liebhabe;, für welche Isolde Ahlgrimm ihre Konzerte veranstaltet, werden es der verdienstvollen Künstlerin danken, wenn sie sich, wie bisher, auf die mustergültige und stilgerechte Wiedergabe alter, insbesondere vorklassischer Werke beschränkt. Ein sehr ansprechendes, melodisches und feinsinniges Werk lernte man in der Sonate für Violine und Cembalo von Hans Ahlgrimm (1904 bis 1945) kennen, die allerdings erst in der Umbesetzung für Flöte und Klavier voll zur Geltung käme.
An den Schluß dieser Betrachtung über die Erneuerung der klassischen Formen sei das vom Steinbauer-Quartett uraufgeführte I. Streichquartett von Alfred Uhl gestellt. Denn in diesem Werk ist eine glückliche Synthese zwischen alt und neu, kontrapunktischer Arbeit und klanglicher Verwirklichung gefunden. Den langsamen Satz ersetzt eine Variationenreihe über ein Volksliedthema aus dem 16. Jahrhundert. In der Themenverarbeitung der bewegten Sätze wirkt die klassische Tradition; Hindemiths Einfluß ist spürbar, aber auch die neuen Franzosen hat der Komponist aufmerksam gehört: sie mögen den rhythmischen Fluß der Melodik entbunden und den Klangsinn des Komponisten entwickelt haben. Gesamtstil, Harmonik und Melodik aber tragen unverkennbar persönliches Gepräge; und darauf kommt es schließlich an.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!