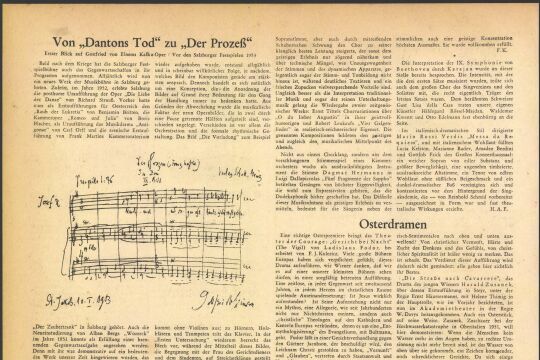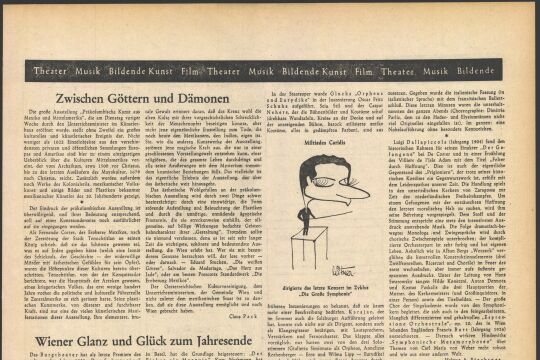Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Lulu-Tragödie von Alban Berg
In den Jahten 1892 bis 1901 schrieb Frank Wedekind die beiden Dramen „Erdgeist“ und „Die Büchse der Pandora“. Am 29. Mai 1905 fand in Wien, von Karl Kraus veranstaltet, die Uraufführung des zweiten Stückes statt, das vorher kein Theater zu spielen gewagt hatte. Dei 20jährige Alban Berg hat diese Aufführung, bei der Frank Wedekind und s-ine Frau Tilly mitwirkten, gesehen und war tief beeindruckt. — Aber erst viel später entschloß er sich zur Komposition, die nicht vor 1928 begonnen wurde. Anscheinend nicht ohne Zögern. Mit ..Wozzeck“ hatte sich Berg die Opernbühne erobert — auch wenn er den großen, an Popularität grenzenden Erfolg dieser Oper selbst nicht mehr erlebt hat. Dann lockte Gerhart Hauptmanns Glashüttenmärchen „Und Pippa tanzt“, dessen Vertonung an Äußerlichkeiten scheiterte. Hierauf wandte er sich dem Wedekind-schen Stoff zu, zog die beiden abendfüllenden Sprechstücke durch radikale Kürzungen zu einem dreiaktigen Libretto n sechs knappe Bilder zusammen und nannte seine Oper nach der Zentralgestalt ,Lulu“. Die Komposition im Particell konnte Berg, der am 24. Dezember 1935 als 50jähriger starb, noch beenden. Die Instrumentierung wurde zweimal — zugunsten der „Weinarie“ nach Baudelaire and des Violinkonzertes unterbrochen — und blieb unvollendet. Vom 3. Akt gibt es mr einige orchestrierte Stücke. Trotzdem iat man im Lauf der Jahre recht geschickte Lösungen gefunden, um diese zweite Oper Bergs auch für die Bühne zu retten. Die Uraufführung am Zürcher Stadttheater, am 2. Juni 1937, betonte den fragmentarischen Charakter des Werkes. Moch im gleichen Jahr wurde „Lulu“ in Prag gespielt, dann gab es nur. konzertante Aufführungen, bis 1952 Essen und 1956 Hamburg sich wieder an eine «zeni-iche Realisierung des schwierigen Werkes wagten. Bei den Berliner Festwochen, vor zwei Jahren, war Bergs „Lulu, in einer Gastauffübrunng der Hamburger Staatsaper mit Helga Pilarczyk in der Titelrolle, ein großer Erfolg. In Wien wurde „Lulu“ bisher nur zweimal konzertant aufgeführt.
In der musikalischen Gestaltung unterscheidet sich „Lulu“ sehr wesentlich von ihrem Vorgänger „Wozzeck“. Dessen Musik ist keineswegs „zwölftönig“, wie man oft hören und lesen kann, sondern im strengen Wortsinn „atonal“ — während die gesamte „Lulu“-Partitur auf einer Zwölftonreihe und der aus ihr gewonnenen Ableitungen basiert. Die vielen Kurzszenen des „Wozzeck“ wurden zu geschlossenen musikalischen „Charakter-poni6ten, nach seinen eigenen Worten, in „Lulu“ darauf ankam, die „durchzuführende Gesamterscheinung der einzelnen Bühnengestalten“ musikalisch zu formen. Dies geschieht, indem allen Hauptfiguren bestimmte, immer wiederkehrende Formen beziehungsweise Instrumentalensembles zugeordnet sind. Geblieben ist, wie in der „Wozzeck“-Partitur, die Synthese von musikalisoher Phantasie und strenger Konstruktion. — Über den fragwürdigen und papierenen Text, der auf der Sprechbühne heute kaum mehr erträglich ist (und auch früher nicht angenehm war) triumphiert die Musik durch ihre nie nachlassende Spannung, durch die einheitliche, intensive Stimmung, durch den düster-schwelenden Orchesterklang, dessen Kolorit durch Saxophone, Vibraphon und solistisch eingesetztes Klavier bestimmt ist. Diese Musik hebt die Wedekindsche Handlung und ihre Akteure ins Irreale, Traumhafte, Phantastische. Der Berg-Biograph Willi Reich zitiert, anläßlich der Analyse des Lulu-Stoffes, ein Wort Hans-licks über Verdis Wagnis, die übelbeleumdete „Kameliendame“ von Dumas für seine „Traviata“ zu verwenden: „Die erste Hälfte der Oper verherrlicht die Liederlichkeit, die zweite die Lungenschwindsucht; dort haben wir das übertünchte, hier das offene Grab. Aber die Musik, die selbst das Gräßlichste niemals ganz ohne Schönheit darstellen kann, durchdringt idealisierend alle Poren selbst der Verwesung und löst die entsetzliche Wirklichkeit des Dramas in einen schwermütigen
Die Aufführung im Theater an der Wien war ein glänzendes künstlerisches Ereignis und hat die Lebensfähigkeit der Oper (trotz einiger fehlender Szenen) einwandfrei bewiesen. _ Der Erfolg konnte nicht rauschender sein, galt allerdings ebensosehr als dem Werk den erstklassigen Kräften, die „am Werk waren“. Aufregend und brillant Evelyn Lear als Lulu, stimmlich ebenso wie schauspielerisch von traumwandlerischer Sicherheit. Sie vermochte das absolute Triebweib (im Prolog wird sie als Schlange vorgestellt) bei aller Gewagtheit und Echtheit ohne Obszönität, freilich auch ohne jede Prüderie zu verkörpern und dadurch menschlich zu erschüttern. Nicht weniger erschütternd Paul S c h ö f f I e r als Dr. Schön, im Banne Lulus von Szene zu Szene immer mehr verfallend und sich selbst verlierend. Kurt E q u i 1 u z als Maler hatte seine große Chance und wußte sie zu nutzen. Gisela L i t z als Gräfin Geschwitz, Josef Knapp als Schigolch, Hans Braun als Rodrigo — man müßte alle Darsteller nennen und loben, um ihnen gerecht zu werden. Die sehr schwierige Aufgabe der Inszenierung, die an der Grenze der Realität lebende, vom Urtrieb allein bestimmte Gestalt der Titelheldin inmitten des bürgerlichen Rahmens glaubhaft zu machen, löste Otto Schenk in geradezu inspirierter Weise, von den zwischenlichtigen Bühnenbildern Caspar N e h e r s angeregt und unterstützt, die im letzten Bild auch eine letzte Konsequenz ziehen: nie kann wohl das Ende allen Sichselbstverlierens bildhafter gezeigt werden als durch die paar armseligen Bretter des Schlußbildes. Die Kostüme (Hill Reihs-CrOmes) bleiben zeitgebunden in der Wedekindschen Atmosphäre und geben dem Auge jene Wirklichkeit, die uns heute ebenso Geschichte wie Fabel zu werden beginnt.
Die Musik wirkt über alle ihre sogenannten Probleme hinweg (die bei konzertanten Aufführungen des Werkes im Vordergrund stehen). Sie webt buchstäblich (und niemand denkt dabei an Zwölftonreihen) das Leben der Gestalten, hau:ht ihnen die Seele ein, die sie uns erträglich macht (was sie ohne Musik nicht oder zumindest nicht mehr sind). Die musikalische Leitung hatte Dr. Karl Böhm. Er hat seine ganze Führungskunst in den Dienst des Werkes gestellt, die geringste Partituranweisung realisiert und in meisterhafter Zusammenfassung aller Momente äußerste Konzentration und Wirkung erreicht. Das Orchester der Wiener Symphoniker, das mit dieser PremieTe seine erste Oper spielte, ließ unter seinen Händen nichts zu wünschen übrig.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!