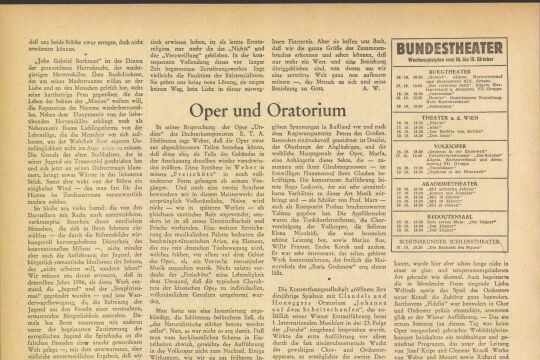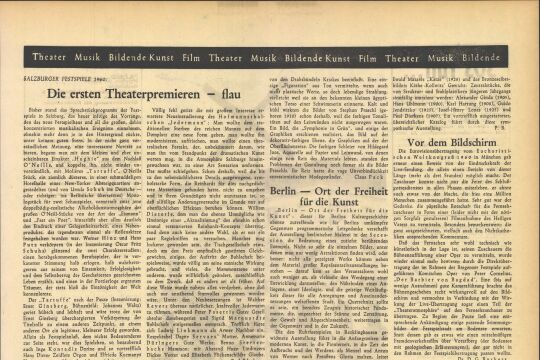Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Mozart, Beethoven und R. Strauß
Mozart ist Anfang und Ende der Oper. Zumal in Salzburg. Verhältnismäßig schnell wurde das Dramma giocoso .Don Giovanni“ wieder nagelneu auf die Salzburger Festspielbühne gebracht. Es war das .Debüt“ Clemens Holzmeisters, der damit zum erstenmal nach dem Kriege (oder seit wann überhaupt?) als Bühnenbildner wieder in Erscheinung trat. Er ist Architekt. Man weiß es, wenn man die mächtigen Säulen, den Prospekt im Hintergrund mit der spanischen Stadt (fein säuberlich und genau) und den Gouverneurspalast mit seinen Steinquadern gesehen hat. Das Architektonische, Zeichnerische überwiegt, und man vermißt sehr das Malerische: ist es nicht eigentlich einzig geeignet, Mozarts Welt visuell einzufangen? Auch gab es ziemliche Ungeschicklichkeiten. Das machtvolle Reiterstandbild wurde schier erdrückt im engen Raum, den die Säulen ihm ließen, und manchmal gab es ein Gewirr von ineinander komponierten bildnerischen Einfällen, die das Auge nicht zur Ruhe kommen ließen. Es war bewundernswert, wie O. F. Schuh, der Regisseur, In dieser geradezu prunkvoll-repräsentativen Dekoration dennoch zur ironischen Intimität des .giocoso Im .dramma vordringen konnte, ohne die Komödie (was auch nicht unbedingt wünschenswert wäre) zu sehr zu betonen. Dieser standen vor allem die überraschend breiten und von den Sängern das Höchste an Stimme und Konzentration verlangenden Tempi Wilhelm Furtwänglers entgegen, die andererseits wieder im Mozart-Brio bisher versteckt gebliebene Partiturschöntoeiten zutage förderten und vor allem alle lyrisch-seelischen Partien (Ottavio, Zerline) noch vertieften. Man mag Furtwänglers Zeitmaße als ungewohnt empfunden haben, sie hatten jedoch Charakter und rückten die seelische Wärme als Gegensatz zu G;ovannis Lebensdämonie stark in den Vordergrund. Hier und in den spielerisch aufgelockerten Ensembles, die Furtwängler zu wahren Höhepunkten entwickelte, spürte man enge Beziehungen der Regie und musikalischen Deutung. Die .Wiener Besetzung“ mit Ljuba Welitsch (Donna Anna), Elisabeth Schwarzkopf (Elvira), Erich Kunz (Leporello), Irmgard Seefried (Zerline) und Alfred Poell (Masetto) war über alles Lob erhaben. Josef Greindls machtvolle Stimmfülle hob das Erscheinen des Komtur in die Sphäre des Ubernatürlichen. Leider hat jedoch Tito Gobbi, der als Wozzeck der Neapolitaner Einstudierung Karl Böhms von sich reden machte und nun (überhaupt zum erstenmal I) den Don Giovanni gab, enttäuscht.
Furtwängler, der in diesem Jahr ebenso charakteristisch wie überzeugend das künstlerische Maß der Salzburger Festspiele bestimmt, leitete auch die beiden Opernreprisen: Mozarts „Z a u b e r f 1 ö t e in der Felsenreitschule, die szenisch nur geringe, aber symbolisch vertiefende Änderungen gegenüber dem Vorjahr aufwies, und Beethovens „F i d e-1 i o“. Interessanterweise, aber kaum überraschend, hat erst Beethovens Werk jene Begeisterung entfacht, die ein Festspiel auch äußerlich zum außerordentlichen Ereignis macht. Furtwänglers Verhältnis zur Musik, auch zur Opernkunst, ist immer vom geistigen Aufriß der symphonisch-instrumentalen Welt bestimmt. Dort, wo Beethoven in das Allgemeine und Typische der ethischen Verpflichtung als Symphoniker vordringt (Fidelio-und III. Leonorenouvertüre, chorische Schlußapotheose), erreichte er wieder eine Bekenntnishöhe, die zum Packendsten zählt, was heute überhaupt im Bereich der künstlerischen Interpretation erlebt werden kann. Unbestritten im Mittelpunkt des Bühneninteresses stand wieder Julius Patzak als Florestan. Neben Kirsten Flagstad als Imponierender Leonore, Paul Schöffler als Pizarro und Josef Greindl (Rocco) waren Elisabeth Schwarzkopf und Anton Dermota (Marzelline und Jacquino) neu in dieser Aufführung: trotz hervorragender sängerischer Leistungen war gerade hier, im ersten Akt, das Fehlen des Regisseurs Günther Rennert bemerkbar. Es entsteht die Frage, ob es der Salzburger Festspielidee entspricht, wenn eine Aufführung wie diese ohne neuerliche gründliche szenische Uberprüfung wieder aufgenommen wird.
Kam bei Mozart und Beethoven das Menschliche in verschiedener künstlerischer Variation auf die Salzburger Bühne, so mit der letzten vollendeten Oper von Richard Strauß, nach einer Idee des Librettisten Clemens Krauß „Capriccio“ genannt, die verfeinerte Welt des Artistischen, das auch die Seelenlage seiner Figuren bestimmt. Wie in allen Bühnenwerken von Strauß steht auch hier eine liebenswerte Frauenfigur im Mittelpunkt, der die ganze Leuchtkraft und feine Psychologie des Strauß-Orchesters dient. Es ist eine Gräfin diesmal, eine Witwe in jungen Jahren, die zur Zeit, als im nahen Paris der Streit der Gluckisten und Piccinisten um die Frage entbrannt war, ob Wort oder Ton in der Oper das Übergewicht haben solle, auf ihrem schönen Landschloß aufgerufen wird, diese Frage zu entscheiden. Sie fällt ihr um so schwerer, als sie ihr in der leibhaftigen Person des Musikers Flamand (Anton Dermota) und des Dichters Olivier (Hans Braun) gegenübertritt. Glaubt sie, dem Sonett des Dichters ganz verfallen zu sein, muß sie wenig später, als der Komponist sie mit seiner Musik zum
Sonett umwirbt, diesem das Vorrecht einräumen. Strauß (und Krauß), die beide, nach einem Wort des Komponisten, diesmal den doch immer trivialen Opernschluß vermeiden wollen, lassen schließlich die Frage, ob Fla-mand oder Olivier (Ton oder Wort), offen. In einer berückend schönen Szene der Grafin vor dem Spiegel klingt das Werk in wehmutsvoller Resignation der Unentschiedenheit aus.
Dieser .Bericht aus der Werkstatt eines erfahrenen Opernkomponisten am Ende seines Lebens und Schaffens besitzt den Glanz einer Kunst am Ende einer Epoche, die schließlich an die Stelle der großen Figur und de menschheitlichen Ethos die verfeinerte Nuance setzt, den Sonderfall, das Kuriose. Die Aufführung (Dirigent: Karl Böhm, Regie: Rudolf Hartmann, Bild und Kostüme: Gustav Vargo) war hervorragend. Paul Schöffler als Theaterdirektor bot eine vollendete komische Figur mit tragischem Unterton. Lisa della Casa (Gräfin) war für die Welt des frivolen 18. Jahrhunderts um etwas zu natürlich, ihrer Stimme entströmt viel seelische Wärme, während die frivol-spielerisch gemeinte Höhenlage des Straußschen Soprans nicht mit der notwendigen Selbstverständlichkeit erreicht wurde.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!