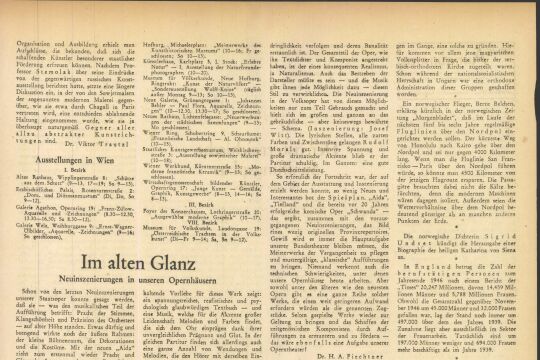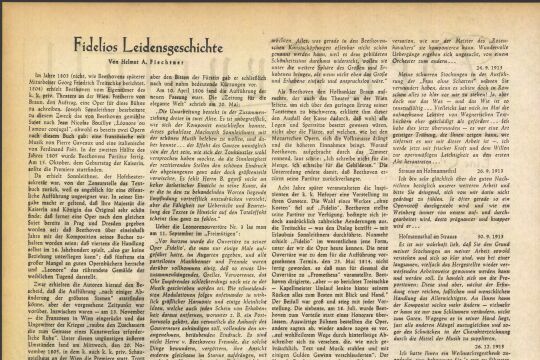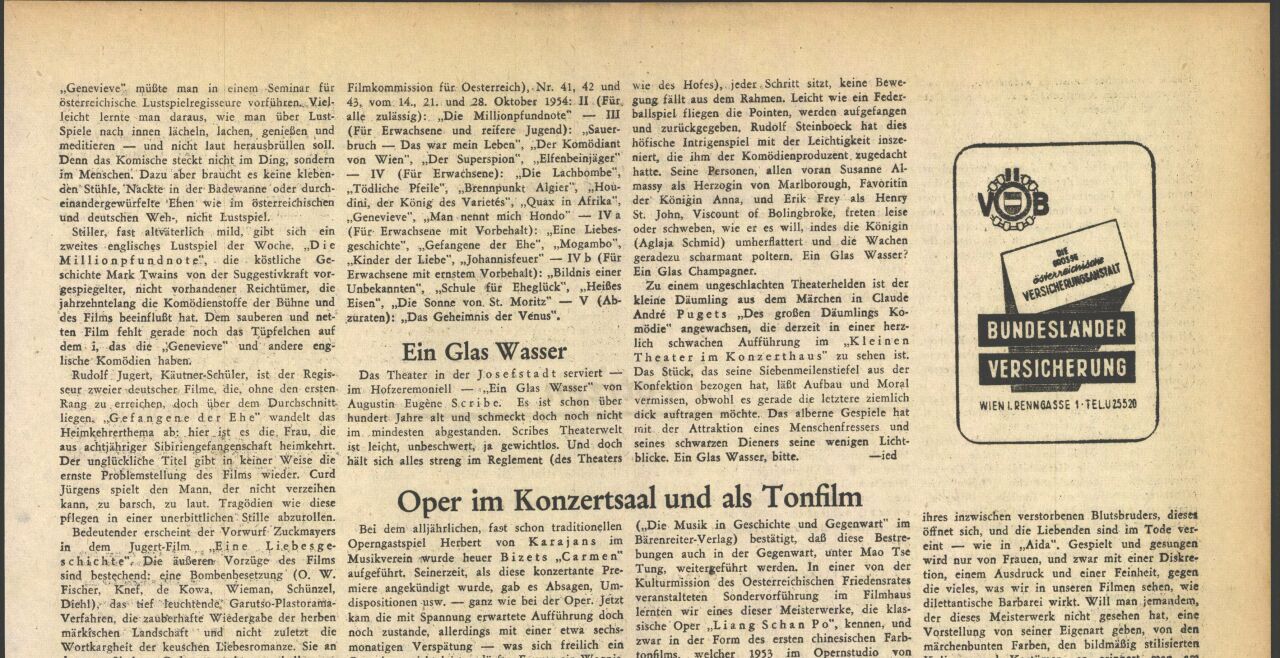
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Oper im Konzertsaal und als Tonfilm
Bei dem alljährlichen, fast schon traditionellen Operngastspiel Herbert von Karajans im Musikverein wurde heuer Bizets „Carmen" aufgeführt. Seinerzeit, als diese konzertante Premiere angekündigt wurde, gab es Absagen, Umdispositionen usw. — ganz wie bei der Oper. Jetzt kam die mit Spannung erwartete Aufführung doch noch zustande, allerdings mit einer etwa sechsmonatigen Verspätung — was sich freilich ein Opernhaus nicht leisten dürfte. Es war ein Wagnis, fast eine Herausforderung, diese Oper aller Opern, diese „braune Musik des Südens", die bekanntlich Nietzsche so sehr verehrte, daß er sie mehr als dreißigmal gehört hat, und die der ernste Brahms als seine „ganz besondere Geliebte" bezeichnete, ihrer Inszenierung zu entkleiden und gewissermaßen als „abstrakte spanische Oper Nr. 1“ auf das Podium des Konzertsaales zu verpflanzen. Man kennt das Werk so genau, daß jeder, der ihrer bedarf, die fehlenden optischen Vorgänge mit Leichtigkeit ergänzen kann. Trotzdem kamen einige besonders „theatralische" Szenen auch bei so vorzüglicher musikalischer Wiedergabe nicht zur Wirkung. Die Vorteile einer wohlstüdierten und bis ins Detail ausgefeilten konzertanten Darbietung liegen auf der Hand. Während man bei einer szenischen Aufführung der „Carmen" mit fast atemloser Spannung verfolgt, wie ein genialer Musikdramatiker zehnmal hintereinander ins Schwarze trifft, gilt unsere Bewunderung im Konzertsaal einer Partitur, bei der jede Note, jede Klangfarbe sität, wobei mit dem Raffinement der Einfachheit die durchschlagendsten Wirkungen erzielt werden. Diese zu servieren und ins rechte Licht zu setzen, ist Karajan der richtige Mann, für dessen einzigartige Leistung Reinhold Schmidt durch gewissenhafteste Vorbereitung alle Voraussetzungen schuf. Als größter Gewinn dieser Aufführung ist die Darbietung des Werkes im Original, das heißt in französischer Sprache zu vermerken. Der französische Text ist im ganzen und in jedem Detail prägnanter, härter und nüchterner als selbst die verbesserte deutsche Fassung. Den Clou ließ man sich leider entgehen: nämlich die Aufführung in der ursprünglichen Fassung als Spieloper mit gesprochenem Dialog. Die weichlichen Rezitative schuf bekanntlich Bizets Freund Erneste Guiraud für die Wiener Oper, wo das Werk in dieser Gestalt ih Bizets Todesjahr (1875) zur deutschen Erstaufführung kam. Erst in der ursprünglichen Fassung aber kommt die geniale Musik Bizets voll zu ihrer Wirkung, wo sie, nach gesprochenen Dialogen, mit geisterhafter Plötzlichkeit einsetzt und ihren ganzen Zauber ausübt. Schade, daß man diese einzigartige Gelegenheit im Musikverein versäumt hat. — Sieben von den zehn ausgezeichneten Solisten kamen von der Mailänder „Scala" (an der Spitze Giulietta Simionato als Carmen, Graziella Scuitti als Frasquita und Nicolai Gedda als Don Jose). Den Escamillo sang der Franzose Michel Roux, die Micaela Hilde Güden. Der große Chor des Singvereins leistete stimmlich und in der sauberen, fast fehlerfreien Aussprache des Französischen Hervorragendes, desgleichen der Kinderchor des Konservatoriums der Stadt Wien. Die Streicher der Wiener Symphoniker imponierten durch bemerkenswerte Präzision, die Bläser durch geradezu solistische Leistungen, während sich die Schlagwerker in leibhaftige Spanier verwandelt hatten.
Die klassische chinesische Oper, die im 18. Jahrhundert entstand, erscheint als ausgesprochene Spätform innerhalb der Gesamtentwicklung der chinesischen Musik, wenn man bedenkt, daß diese bereits anderthalb Jahrtausende vor Christi Geburt eine erste Blütezeit erlebte, daß es schon 200 Jahre vor Christus eine zwölf- tonige Leiter gab und daß bereits 1584 yon einem chinesischen Prinzen eine temperierte Skala errechnet wurde. Aus der Ming-Zeit stammen die ersten Bühnenwerke mit Musik (melodramatisch begleitete Teile mit Rezitativen und Arien). Um 1400 gab es schon mehr als 500 „Opern" dieser primitiveren Art. Zwei neue Opern-Singstile verschmolzen im 18. Jahrhundert zur „Residenzmelodie", das heißt zum hauptstädtischen (Pekinget) Opernsingstil. Zwischen den beiden Weltkriegen bemühte man sich um die Restauration und Wiederbelebung der klassischen chinesischen Oper, und die allgemeine Musikenzyklopädie
(„Die Musik in Geschichte und Gegenwart" im Bärenreiter-Verlag) bestätigt, daß diese Bestrebungen auch in der Gegenwart, unter Mao Tse Tung, weitergeführt werden. In einer von der Kulturmission des Oesterreichischen Friedensrates veranstalteten Sondervorführung im Filmhaus lernten wir eines dieser Meisterwerke, die klassische Oper „Liang Schan Po”, kennen, und zwar in der Form des ersten chinesischen Farbtonfilms, welcher 1953 im Opernstudio von Schanghai aufgenommen wurde. Das Sujet ist die bekannte altchinesische Geschichte von den Blutsbrüdern: Ein junges Mädchen aus vornehmer Familie verkleidet sich als Mann, um an der Universität studieren zu können. Dort lernt sie ihren Freund und Blutsbruder kennen, mit dem sie drei Jahre lang, als Mädchen unerkannt, zusammen lebt. Nach Abschluß des Studiums will sie ihn, angeblich mit ihrer Zwillingsschwester (die natürlich sie selbst ist), verheiraten. Aber der Vater hat es inzwischen mit ihr anders beschlossen: sie soll sich dem Sohn des Gouverneurs vermählen. Auf dem Weg zu diesem besucht sie das Grab ihres inzwischen verstorbenen Blutsbruders, diese öffnet sich, und die Liebenden sind im Tode Vereint — wie in „Aida". Gespielt und gesungen wird nur von Frauen, und zwar mit einer Diskretion, einem Ausdruck und einer Feinheit, gegen die vieles, was wir in unseren Filmen sehen, wie dilettantische Barbarei wirkt. Will man jemandem, der dieses Meisterwerk nicht gesehen hat, eine Vorstellung von seiner Eigenart geben, von den märchenbunten Farben, den bildmäßig stilisierten Kulissen und Kostümen, so erinnert man am besten an Teschners magischen Figurenspiegel. Besonders wirkungsvoll ist ein dramaturgischer Trick: daß nämlich auf den Höhepunkten der Handlung die Musik aussetzt und die ent scheidenden Worte gesprochen werden. Der Film hat, nebenbei, keinerlei „Tendenz", und es wäre sehr wünschenswert, ihn zumindest einem weiteren Kreis von Fachleuten des Theaters, Musikern, Bühnenbildnern und Regisseuren, vor allem aber Schauspielern — und solchen, die es werden wollen — zu zeigen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!