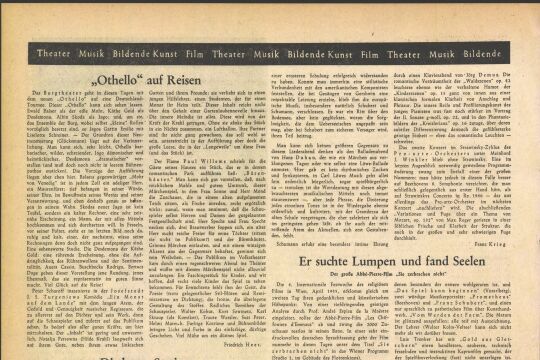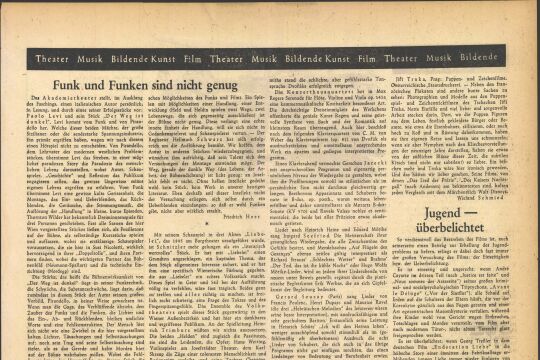Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Orpheus und die Moskauer
Eine konzertante Wiedergabe der Oper „Orpheus und Eurydike“ von Christoph Willibald Gluck, unter der Leitung von Josef Krips, kann durch die Qualität der Wiedergabe als Spitzenleistung innerhalb der Festwochen bezeichnet werden. Den Orpheus sang Christa Ludwig, die Eurydike Wilma Lipp, den Amor Lotte Schädle, den Chor stellte der Singverein und das Orchester die Wiener Philharmoniker. Daß bei solcher Besetzung eine sehr gute Aufführung zustande kam, mag selbstverständlich sein; die Selbstverständlichkeit wurde indes überboten durch die Größe aller persönlichen Leistungen, die Kostüm und Bühnenbild in der Tat entbehrlich machten. Man „sah“ die Hirten und Nymphen (die Furien hörte man nur), so exakt und ausdrucksgeladen war jedes Wort und jeder Ton des Chores. Davon abgehoben, durch Stimme und Erscheinung individualisiert, die Solistinnen: Christa Ludwigs dunkel gefärbter Gesang, in allen Registern gleich wohllautend, rund erhaben; Wilma Lipps lichte, immer tröstende weiche und doch sich zu echter Dramatik verdichtende Stimme; als Gegensatz der objektivere Sopran Lotte Schädles, dem Gott Amor entsprechend, frisch, ohne tragischen (aber doch mit menschlichem) Unterton. Es war ein Fest der schönen Stimmen, dem Josef Krips durch souveräne Führung des Orchesters auch den instrumentalen Klang der großen Tragödie verlieh.
Vom Moskauer Rundfunkorchester hörten wir unter der Leitung von Gennadi Roshdestwenskij die 5. Symphonie von Tschaikowsky, das 2. Klavierkonzert von S. Rachmani-noff mit Dimitri Baschkirow als Solisten und „Poeme de l'extase“ von A. Skrjabin. Vor allem zu loben sind Solist und Orchester mit Dirigent beim Klavierkonzert. Das blitzsaubere und extrem exakte Spiel des Solisten wurde weich und mit dynamischer Sorgfalt in den Orchesterklang gebettet beziehungsweise von ihm abgehoben. Es war der geschlossenste und in den Gewichten am besten verteilte Eindruck. In den anderen Werken fiel auf, daß die einzelnen Orchestergruppen an sich tadellos und von vorbildlicher Disziplin sind, ihr Zusammenspiel aber keine Homogenität ergibt. Die Streicher wirken mehr mathematisch als schwingend und kommen gegen die Bläserfreudigkeit nicht auf, die sich im „Poeme de l'extase“ voll auslebte. Letzteres nur mehr selten zu hörende Werk bietet in seinem Schlußteil noch heute unmittelbare mitreißende Wirkung, während die Symphonie von Tschaikowsky in ihrer trotz aller Wucht schlanken Wiedergalbe doch den tieferen Eindruck hinterläßt. F. K.
An seinem letzten Abend in Wien spielte das Moskauer Rundfunk- und Fernsehorchester Michael Glinkas Ouvertüre zu „Ruslan und Ludmilla“, das Konzert für Violine und Orchester von Schostokowitsch, Igor Strawinskys
Ballettsuite „Der Kuß der Fee“ (Divertimento) und Prokofleffs „Skythi-sche Suite“ op. 20. Die Ouvertüre geriet ein wenig lärmend, das Violinkonzert (1. Fassung von 1947, endgültige, als op. 99, von 1955) recht eindrucksvoll, aber ein wenig grau in grau, wie die Musik. Hierauf kam der brillante Teil: ans Phantastische (oder Mechanische) grenzende Präzision bei der Wiedergabe von Strawinskys Meisterpartitur, mit einem blitzschnellen Wechsel von Tschai-kowskyscher Kantilene zu Strawins-kyscher Trockenheit.. Zum Schluß: eine hinreißende Wiedergabe von Prokofleffs Jugendwerk von 1915, dessen Brutaleffekte mit großer Kunstfertigkeit in differenzierte Klangfarben umgesetzt werden. Diese ans Hexerische grenzende Leistung vollbrachte das überaus disziplinierte Orchester unter der Leitung von Gennadi Roshdestwenskij, der erst 35 Jahre alt sein soll, mit seinem gemessenen Auftreten und dem professoralen Typus aber älter wirkt. Was in diesem temperamentvollen Phlegmatiker steckt, erlebte man mit Staunen im Verlauf dieses kurzweiligen Abends. Auch der hervorragende Geiger Leonid Kogan zieht es vor, seine Emotionen zu verbergen. Der auf einem kostbaren Instrument hervorgebrachte Ton ist von kühler Noblesse, das technisch vollendete Spiel von gebändigtem Ausdruck, die sympathische persönliche Ausstrahlung stark, aber unaufdringlich. Beifallstürme, trotz des unkonventionellen, eher grüblerischen als brillant-konzertanten Werkes. Als Zugabe die Sarabande aus J. S. Bachs Partita II, die erneut den hohen Rang des Musikers Kogan bestätigte.
Ein Festwochenerlebnis besonderer Art war der Orgelabend von Marie-Claire Alain auf der neuen Orgel des Mozartsaales. Sowohl das Instrument als auch die französische Orgelkunst kamen im gebotenen Programm zu ungeahnt voller und zukunftsweisender Geltung. Marie-Claire Alain ist nicht bloß die Interpretin der Werke ihres allzu früh verstorbenen (gefallenen) berühmten Bruders Jehan Alain, sondern auf allen Gebieten der Orgelkunst daheim, vielfache Preisträgerin und internationale Berühmtheit unter der jungen Organistengeneration. Die Bedeutung ihres Wiener Orgelabends wurde noch durch die Tatsache unterstrichen, daß kein Geringerer als Anton Heiller ihr registrierte. Trotz des französischen Programms stand in der Mitte Johann Sebastian Bach mit der Triosonate Nr. 2, c-Moll, die mit ebensolcher Leichtigkeit und eleganter Gelöstheit musiziert wurde wie die folgende Toccata und Fuge F-Dur mit Kraft und Schwung. In den vorangehenden Stücken der Suite du Deuxieme Ton von Guilain (1706 erschienen) und den Deux Noels von Jean-Francois Dandrieu (1682 bis 1738) kamen die Register der Orgel als Solostimmen in bisher kaum gehörter Vielfalt zur Geltung, im letzten, der Moderne gewidmeten Teil des Programms kontrastierten Klangebenen und Mixturen mit
schlichten gesanglichen Stimmen. Jehan Alains „Variations sur un theme de Clement Jannequin“, noch mehr seine „Postlude pour l'office de Complies“ öffnen klanglich und gedanklich einen Ausblick in die Orgelkunst von morgen, nicht unwesentlich berührt von den Anregungen seines großen Landsmannes Olivier Messiaen, dessen „Dieu parmi nous“ (Gott unter uns) sich zu einer Wirkung steigern, die nicht mehr gemessen, sondern nur noch erlebt werden kann. Das Spiel der Künstlerin ist einfach und natürlich, dabei von jener gallischen Grazie, die auch schwerste Passagen und problematischeste Klangmischungen mit Anmut ausführt und damit die Empfangsbereitschaft hebt. Es wäre schön, Marie-Claire Alain wieder bald in Wien zu hören.
Franz Krieg Russische Klaviermusik des 19. und 20. Jahrhunderts spielte im Mozart-Saal Nikita Magaloff, der Gentleman am Klavier. (Übrigens ist er wirklich fürstlichen Geblüts, emigrierte 1918 nach Paris, wo er die freundschaftliche Förderung Prokofleffs erfuhr, wohnt seit 25 Jahren in der Schweiz und hat vor kurzem in Le-
ningrad konzertiert.) Magaloffs Darbietungen gleichen in ihrer verbindlich-unverbindlichen Art ein wenig denen im Salon, was nicht heißen soll, daß Magaloff nicht ein glänzender Pianist wäre. An den Anfang seines Programms setzte er Tschai-kowskys „Grande Sonate“ G-Dur, op. 37, aus dem Jahre 1878, also noch vor der 4. Symphonie entstanden und von symphonischen Ausmaßen (über 30 Minuten Spieldauer). Leider ist sie nicht von gleicher Erfindung und ohne jene so typische persönliche Note, die die Meisterwerke Tschaikowskys auszeichnet; wohl aber kompositorisch hervorragend gemacht und angenehm anzuhören. (Sie wurde in Wien unseres Wissens noch nie gespielt und kann auah nicht empfohlen werden.) Nach Sonaten von Skrjabin und ProkoflefJ folgten sechs Preludes des überaus fruchtbaren Dimitri Kabalewskij (Jahrgang 1904), der seine Technik und Palette in den 1945 erschienenen „24 Preludes“ im Gefolge Chopins aufs gefälligste zu modernisieren wußte. Zum Abschluß „Trois mouvements de Petrouchka“ von Strawinsky — und viel Applaus.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!