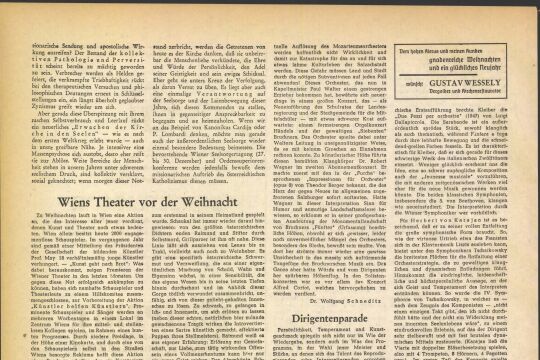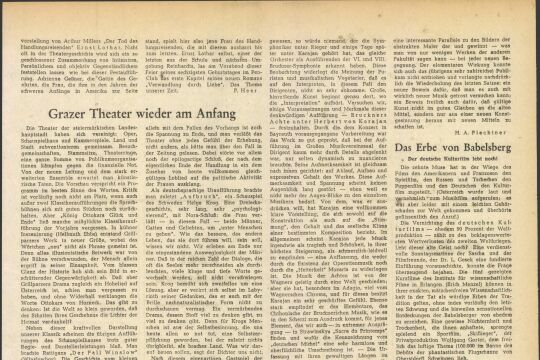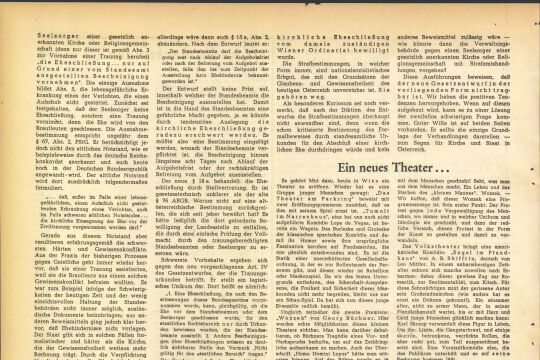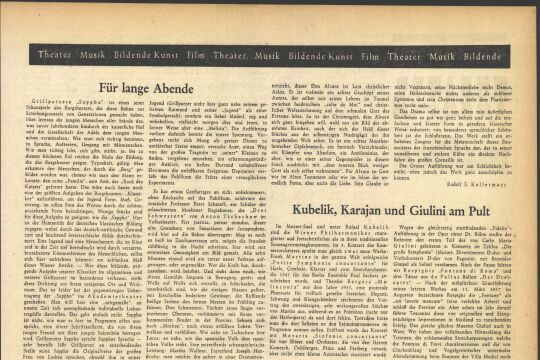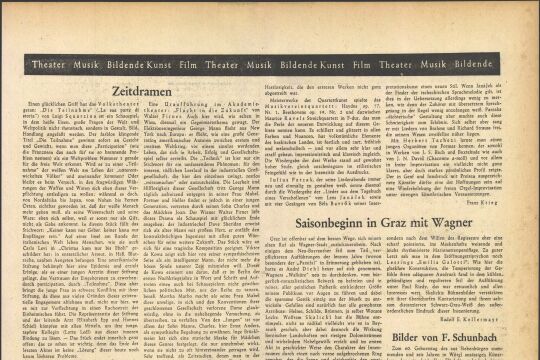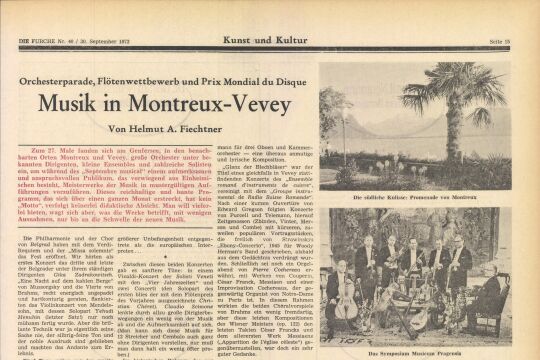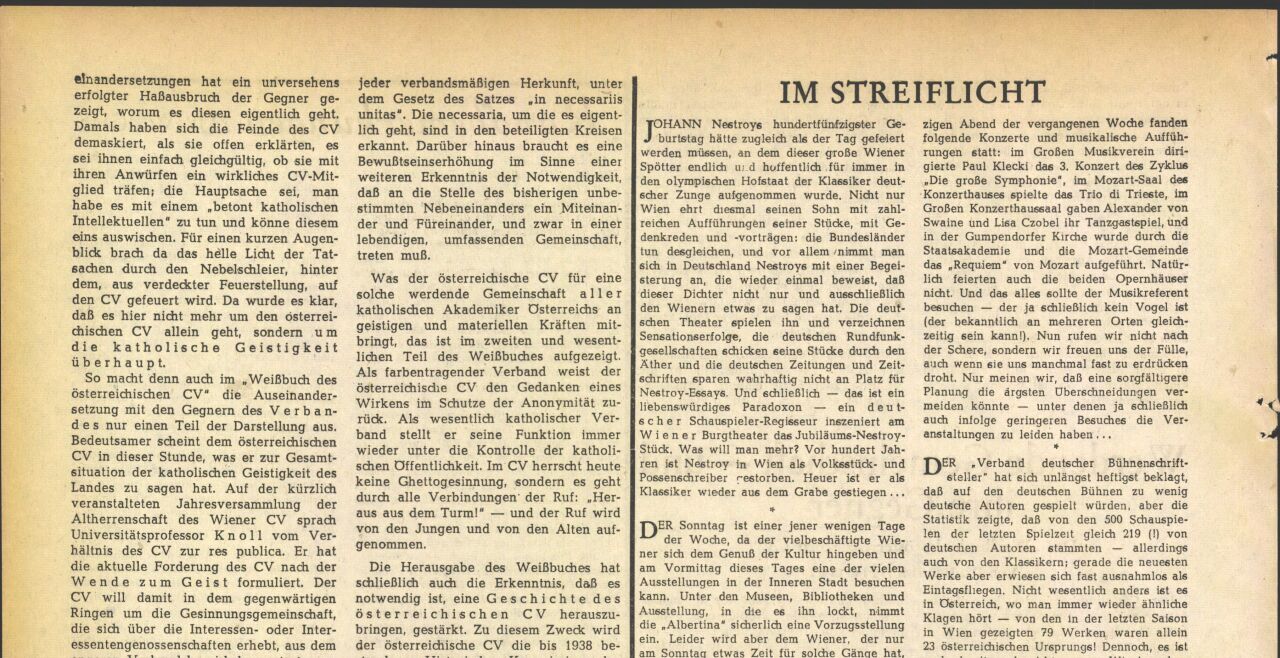
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Psalmensymphonie“ und Gedächtniskonzert
Die Programme der beiden letzten Konzerte der Gesellschaft der Musikfreunde sind ohne Vorbehalt zu loben. Paul Klecki, seit zwei Jahren vom Wiener Musikpublikum hochgeschätzt, gab ein Beispiel weiser Beschränkung, indem er nur zwei Werke: Schuberts „Unvollendete“ und Mahlers „Lied von der Erde“ aufs Programm des dritten Konzerts im Zyklus „Die große Symphonie“ 6etzte. In Schuberts Meisterwerk wurden die klassischen, monumentalen und dramatischen Züge hervorgehoben, zuweilen auf Kosten des Atmosphärischen; aber wir haben selten einen so schönen Anfang dieses Werkes gehört. Mahler geriet stellenweise etwas zu mosaikhaft, dafür aber vorbildlich klar. Elisabeth Höngen und Erich Witte von der Staatsoper Berlin waren die guten, wenn auch nicht mitreißenden Interpreten. Besondere Anerkennung gebührt den Wiener Symphonikern für ihr feines, nuanciertes Spiel der „Unvollendeten“.
Strawinskys „Psalmensymphonie“, 1930 für die 50-Jahr-Feier des Bostoner Symphonieorchesters komponiert und unter der Leitung von Ernest Ansermet uraufgeführt, trägt den Vermerk: „Zur Ehre Gottes komponiert“. Wir haben hier in der Tat ein Werk der sakralen Kunst vor uns, dessen orthodoxe Strenge nur mit den byzantinischen Mosaikmeistern des 11. Jahrhunderts zu vergleichen ist. Der dreisätzigen Komposition 6ind Verse aus dem 38., 39. und 150. Psalm unterlegt. Das Fehlen der Violinen (und der Klarinetten) bestimmt die dunkle, herbe Klangfarbe des Begleitorchesters. Das ganze Werk kann, rund 20 Jahre nach seiner Uraufführung, bereits zum klassischen Bestand der Gegenwartsmusik gezählt werden. Nur der mittlere Satz wirkt immer noch sehr abstrakt, so daß selbst die Ausführenden es schwer haben mögen, sich darin „zurechtzuhören“. Daher kommt es dort leicht zu jenen Betriebsunfällen, die eher vermieden werden können, wenn der Dirigent die Partitur vor sich hat. Allen Ausführenden, vor allem den Mitgliedern des Singvereins, gebührt Dank für ihre Mühe, die nicht vergeblich war: der Chronist vermerkt, daß der Beifall nach der Psalmensymphonie den Dirigenten um zweimal öfter aufs Podium rief, als nach dem „Concerto grosso“ von Händel. Karajan als Tschaikowsky-Interpret wurde an dieser Stelle wiederholt gewürdigt. Die Aufführung der V. Symphonie bestätigte unseren Eindruck von früher nachdrücklich. Für die Größe, das Leidende und Leidenschaftliche dieser Musik, für die so charakteristische tragische Sphäre des hochbürgerlichen 19. Jahrhunderts, hat Karajan ein besonders geschärftes Gefühl. Auch der letzte Rest von Sentimentalität wird im Feuer seiner Interpretation verbrannt. Kein Publikum der Welt wird sich, wenn es ohne Vorurteile ist, dieser Faszination entziehen können, da hier ein großer Komponist seinen Interpreten gefunden hat.
Fritz B u 6 c h hätte das dritte Abonnementkonzert der Wiener Philharmoniker leiten sollen. Nun lagen Blumen auf dem Dirigentenpult, und das Orchester spielte zu seinem Gedächtnis den Marsch aus Mozarts „Ido-meneo“. Dann dirigierte Ernest Ansermet, der das Konzert übernommen hatte, die österreichische Erstaufführung der V. Symphonie von Arthur Honegger. So abwegig es erscheinen mag, gerade bei Honegger Zusammenhänge zwischen den äußeren Lebensumständen und den Werken zu statuieren: ein Kommentar Ansermets weist darauf hin, daß dieses tragisch-pathetische Werk aus einer Zeit 6tammt, in der der Komponist durch Leid und Krankheit heimgesudit wurde. Die schweren, schneidend-dissonanten Akkorde de6 Einleitungs-Grave und das in den Scherzosatz eingeschobene Adagio schlagen Töne an, die wir bei Honegger bisher nicht kannten. Auch das motorische „Allegro marcato“ verebbt, lost sich gleichsam in Klangschatten auf. Jeder der drei Teile schließt mit dem Ton d: daher der enigmatische Untertitel des Werkes g „di tre re“. Die Symphonie hatte bei ihrer Wiener Erstaufführung einen unerwartet lebhaften Erfolg. Ravels „La Valse“ und die
IV. Symphonie von Brahms bildeten den zweiten Teil des Programms, das von ■ einem Meisterorchester unter einem Meisterdirigenten exekutiert wurde.
Im zweiten Konzert de6 „Musica-Viva“-Zyklus wurden Erinnerungen an die Flegeljahre der modernen Musik aufgefrischt. Das IV. Streichquartett von H i n d e m i t h aus den Jahren 1923/24 hören wir unwillkürlich kritischer und vergleichen seine „Atonalität“ mit der gefestigten harmonischen Ba6is des „Mathi“ oder der „Sinfonda 6erena“, Aber auch hier 6Chon fesselt die kraftvoll-leichte, fließende Handschrift des Komponisten, der seine Linien ohne Rücksicht auf harmonische Zusammenklänge 6etzt. Aus der Frühzeit von Strawinsky hörten wir die Pri-baoutki, vier Scherzlieder epigrammatischen Charakters aus dem Jahre 1914, in denen „Petruschka“ und „Sacre“ nachklingen. Die berühmte und oftgespielte „Pastorale“ von 1908 (1923 instrumentiert) ist eine Bagatelle, um die 6ich niemand kümmern würde, wenn nicht der große Name darüberstünde. Das 5. Streichquartett von Bela B a r 16 k wurde 1934 komponiert und ein Jahr später in Washington uraufgeführt. Es weist verschiedene Stilelemente auf: die beiden raschen Ecksätze sind von einer auch für Bartök ungewöhnlichen harmonischen Härte, in der Bewegung äußerst unruhig und zerrissen. Die zwei langsamen Teile (2. und 4. Satz) entwickeln 6ich aus verschleierten Anfängen zu gesanglichem Espressivo. Der mittlere, Hauptsatz des Werkes, verwendet komplizierte bulgarische Rhythmen, über denen sich reges melodisches Leben kraftvoll entfaltet. Aus der großen Zahl der Ausführenden sei nur das Boskow6ky-Quartett hervorgehoben, das besonders lebhaft akklamiert wurde.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!