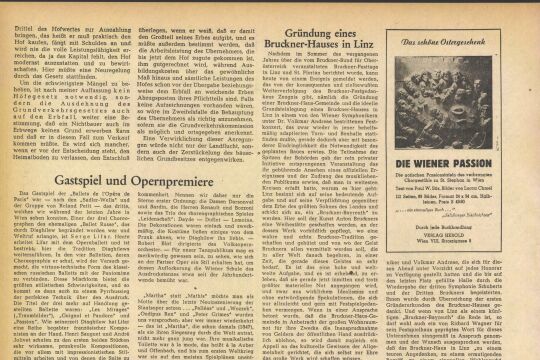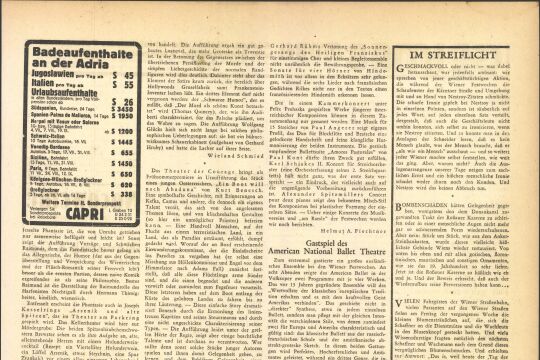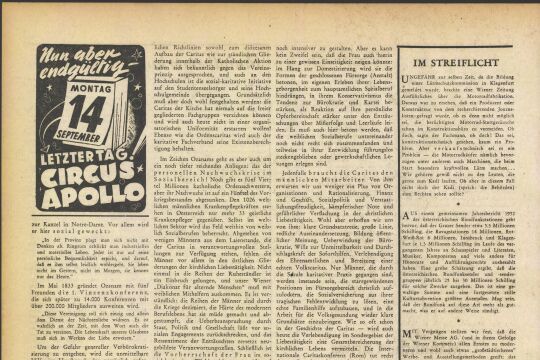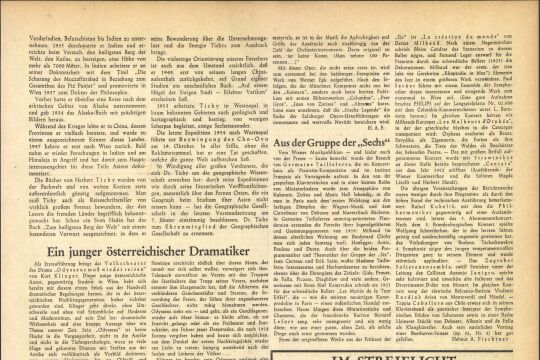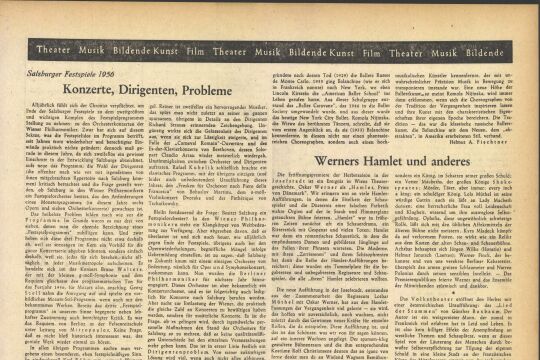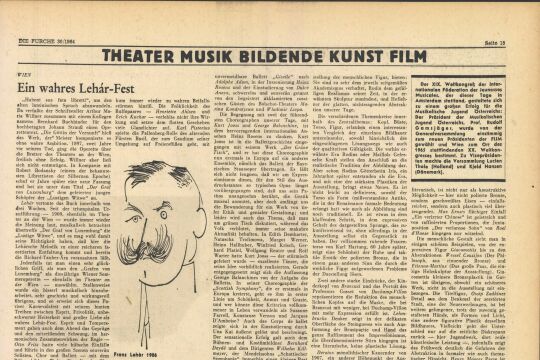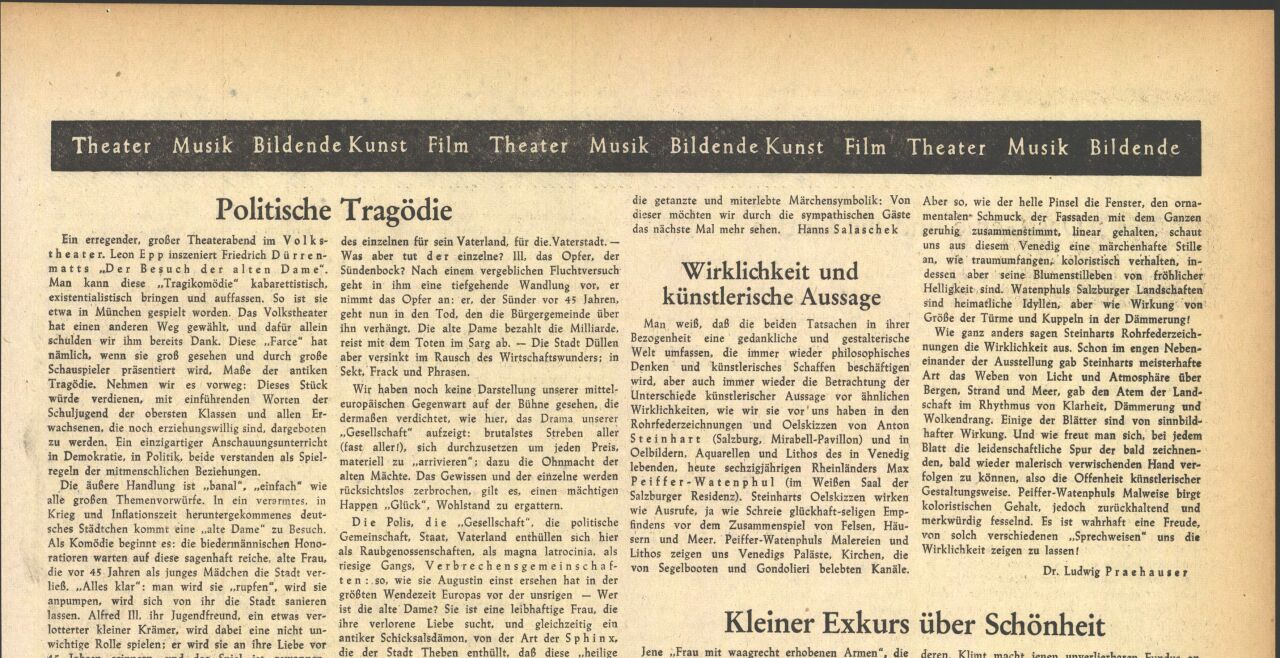
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Sechzehn Ballette in einer Woche
Nachdem das New York City Ballet acht seiner Kreationen bei den Salzburger Festspielen gezeigt hatte (vergleiche „Die Furche“ Nr. 37), gastierte es während der letzten Woche in der Staatsoper und zeigte neun weitere Ballette („Fanfare“ nach Musik von Britten aus den Salzburger Programmen wurde leider nicht wiederholt). Nunmehr kann man sich vom Repertoire und den Leistungen dieses Ensembles, das gegenwärtig wahrscheinlich das beste der Welt ist, ein genaues Bild machen.
Das erste Wiener Programm vereinigte vier handlungslose Ballette: „Serenade nach der gleichnamigen reizvollen Musik Tschaikowskys: Poesie in Himmelblau, in der Konstruktion fast so streng wie das weltberühmte „Concerto Barocco“ mit der Choreographie Balanchines, „L a V a 1 s e“ von Ravel, dem eine Suite von Soli, Pas de deux und Pas de trois nach den „Valses nobles et sentimentales“ vorausging, und im zweiten Teil „Sylvia“ und „Bourree fantasque“, die bereits in Salzburg aufgeführt wurden. Hier zeigte sich, daß Balanchine der einzige Choreograph ist, der den Totentanzcharakter, den der Schluß von Ravels symphonischer Dichtung hat, begreift. Kostüme, Dekorationen und Beleuchtung (Karinska und Rosenthal) sind wirklich kongenial: die hinter Schleiern und nachtblauem Hintergrund wie Geschmeide blitzenden Lüster schaffen eine traumhafte Stimmung.
Das zweite Programm brachte, außer zwei Ballets blancs (Divertimento nach Mozart und Pas de dix nach Glazunow) auch das einzige „Handlungsballett“, das am wenigsten befriedigte. Die Geschichte vom „Verlorenen Sohn“, von Prokofieff mit einer effektvoll-düsteren und sehr gestischen Musik ausgestattet, wird zwar originell variiert, aber die Passagen, wo die Handlung vorwärtsgetrieben werden soll, bedienen sich eben doch jener primitiven Zeichensprache, die uns dieses Genre immer schon verleidet hat. Glänzend einige mit der Aktion nur sehr locker zusammenhängende Tänze und die eindrucksvollen Bühnenbilder des großen Georges Rouault, in die sich die Kostüme wie in ein strenges Gemälde einpassen. — Im „Rattenfänger“ zeigt sich der zweite, 1918 geborene Choreograph der Truppe, Jerome R 0 b b i n s (von dem wir in Wien „Interplay“ und ,,Fancy Free“ gesehen haben), von seiner besten Seite. Auf der Bühne sitzt ein Herr im Straßenanzug und bläst, vom Streichorchester der Philharmoniker begleitet, das Klärinettenkonzert von Aarön Copland. Dazu vollführt das gesamte Corps de ballet ein ausgelassenes, ironisch-lustiges Spiel im besten amerikanischen Stil, der durch die sehr reizvolle Synthese von zugleich schlacksigen und wohldisziplinierten Bewegungen charakterisiert ist
Die vier Temperamente“ nach der Musik Hindemiths, Pas de trois nach Glinka und Symphonie in C von Bizet (alle mit der Choreographie Balanchines und Kostümen der Karinska) sowie sechs heitere Kurzszenen nach Musik von Samuel Barber (Choreographie von Todd Bolender, dem Grotesktänzer des Ensembles) bildeten am Samstag und Sonntag das vierte und letzte Programm, in dem sich noch einmal Eigenart und Qualitäten des New York City Ballets glänzend manifestierten. Der Stil dieses Ensembles hat etwas absolut Großstädtisches, Weltläufiges und schwer definierbar Mondänes. Alle folkloristischen Elemente der choreographierten Musik (Ungarisches, Russisches, Amerikanisches) erscheinen so sublimiert, daß davon nur noch ein Hauch, ein zusätzlicher Reiz spürbar bleibt. Die Abstraktion (etwa in dem Hinde-mith-Ballett, das in schwarzweißen Trainingsanzügen getanzt wurde) grenzt oft ans Gymnastische, die Bewegungskomposition (etwa die der Bizet-Symphonie) ist zuweilen von geometrischer Strenge Ebenso wichtig wie die schöpferische Phantasie des Choreographen und wie die Technik und Disziplin des Ensembles ist die Konsequenz, mit der alle minderen Elemente und Ingredienzien ausgeschieden bzw. vermieden werden: das Sentimentale und das Banale, das hemmungslos Ekstatische und das exhibitionistisch Vergrübelte, das „Liebliche“ und das Neckische. Was Balanchine mit seinem Ensemble vorführt, ist Kunst: streng, kühl und heiter (auch im „ernsten“ Sujet). Und wer auch nur eine der Darbietungen sehen konnte, hat eine Lektion in der hohen Schule des Geschmacks empfangen.
Helmut A. Fiechtner
Nach den Darbietungen aus Berlin und Paris und vor den Gästen aus New York kamen Gäste aus alt-österreichischem Gebiet: das Bosnische Nationalballett. Am ersten Abend war die „Ochrider Legende“. Ochrida — das ist die Stadt der jetzigen Volksrepublik Mazedonien, am Ufer des Ochridasees, das antike Lychnidos. Die Musik von Stefan Hristic ist in Wien durch das „Balkankonzert“ der Wiener Symphoniker unter Weisbach während des Krieges schon bekanntgeworden. Die Handlung dreht sich um eine Märchenepisode aus der Zeit türkischer Fremdherrschaft. Die Technik des Balletts ist gut, die Ensemblewirkung läßt aber die nationale Ursprünglichkeit missen. Auch orchestral blieb einiges uneben. Das Wichtigste aber, was uns fehlte, das war die Durchdringung der technischen Vervollkommnung mit dem Pulsschlag einer gemütvollen, aus den Quellen des Dorflebens quellenden Volkstümlichkeit, wie man sie an Laientanzgruppen aus dem Südosten kennt und schätzt. Die Klassik des Spitzentanzes in Ehren, aber sie ist erstens das tägliche Brot, zweitens eines, das uns überdies von überall her gebacken wird. Was uns New York, Paris und Berlin aber nicht so schnell geben können, das ist die getanzte und miterlebte Märchensymbolik: Von dieser möchten wir durch die sympathischen Gäste das nächste Mal mehr sehen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!