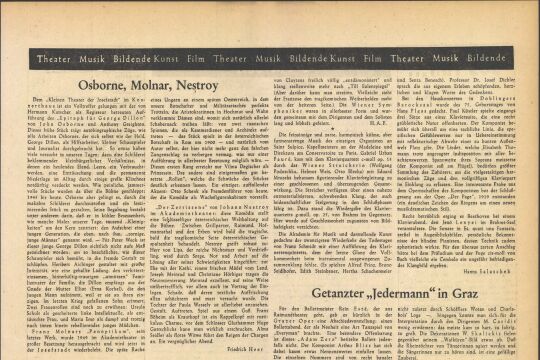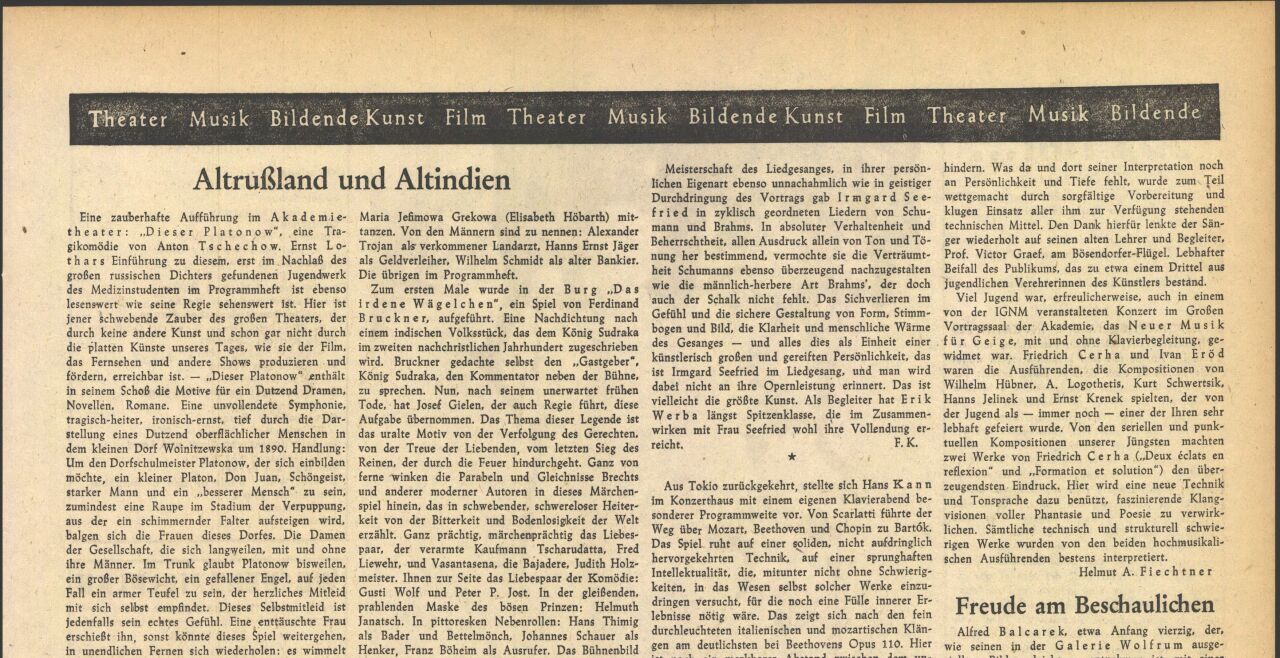
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Solistenparade
Das fünfte Konzert des Zyklus Die; große, Symphonie wurde vom ddm =Bukartstiften Constantin Silvestri geleitet: einem untersetzten Herrn in mittleren Jahren, der zunächst etwas schulmeisterlich wirkt. Aber das gewählte Programm hatte bereits für ihn gesprochen. Debussys klang- h zauberische „Nocturnes” wurden fein und mit großer Akkuratesse musiziert, und Dvofäks selten gespielte Vierte, ein vitales, melodietrfülltes, zuweilen etwas tumultöses Werk, fand in Silvestri und den Wiener Symphonikern virtuose Interpreten. Im Zentrum des Programms und der Aufmerksamkeit stand das recht reißerische, stilistisch zwischen Balakirew, Grieg und Gershwin angesiedelte Klavierkonzert von Aram Chatschat u- r i a n mit Shura Cherkassky als Solisten. Was dieser kleine, freundlich .lächelnde Mann mit dem Tatarenschädel aus dem Steinwayflügel an Theaterdonner, Klangnuancen und glitzernden Läufen herausholt, ist unwahrscheinlich, zuweilen bestürzend. Cherkassky gehört zu jenen Musikern, die es sich leisten können, einem Urtrieb des Virtuosen: der Ueberwältigung des Publikums, nachzugeben. Und da dies an Hand eines so robusten Werkes geschieht, hat auch der Kritiker keine Einwände zu machen.
Die Philharmonia Hungarica unter ihrem ersten ständigen Leiter Zöltan Rosznyai zeigte sich bei einem Konzert im Großen Konzerthaussaal in bester Form. Das zur Eröffnung gespielte „Furioso” von Rolf Liebermann hält durchaus, was der Titel verspricht und ist ein Beispiel dafür, wie man mit einem Minimum von melodischer Substanz und Einfall ein Maximum an Effekt erzielt. — Alexander Jenner, der den Solopart von Schumanns Klavierkonzert spielte, haben wir schon besser gehört. — Respighis fünfteilige Suite für kleines Orchester „Die Vögel” wurde präzis und klangschön musiziert. Auf Zöltan Kodalys „Pfauen-Variationen” (1938/39 komponiert) seien unsere großen Orchester und Dirigenten nachdrücklich hingewiesen.
Das Amerikahaus vermittelte uns die Bekanntschaft mit einem ausgezeichneten Geiger, dem Konzertmeister des Louisville Symphony Orchestra,) Sidney Harth, der von der Pariser Pian.stin Chri- stianne Verzieux begleitet wurde, die ihren wohlbemessenen Anteil am Erfolg dieses schönen Konzerts im Palais Schwarzenberg hatte. Drei Violinsonaten — von Beethoven (op. 30. Nr. 2), Brahms (op. 108, Nr. 3, d-moll) und Bartök — standen auf dem Programm. Harth ist weniger der Typ des Virtuosen, als des geborenen Kammermusikers, der durch die Werkwahl seinen guten Geschmack und durch die Interpretation seine solide Technik (besonders hervorzuheben ist seine schöne und ruhige Bogenführung) betfftltasie- und kraftvolles Werk aus dem Jahr 1921, wiegt einen ganzen Abend „zeitgenössischer” Musik auf. Der Beifall des geladenen Publikums war dementsprechend.
Mimi Coertse, als Violetta Valery in „La Traviata” (Staatsoper) vor eine neue Aufgabe gestellt, bewältigt diese nicht nur durch ihre stimmlichen Mittel und ihre schauspielerische Begabung, sondern durch ihre menschlich-lebendige Auffassung der Heldin und durch den wohltuenden Abstand ihres Spiels von jeder Routine. Diese wird in ihrer ganzen Kälte fühlbar in den Darstellern der beiden Ger- monts, Vater und Sohn: Giuseppe Zampieri und Ettore Bastianini, trotz der edlen Stimme besonders Bastianinist’ ebenso routinemäßig wirken die Dekoration — und nicht zum Letzten das Herumstehen der Gesellschaft in den beiden Salonbildern. Frau Coertse, die niemanden an die Wand spielt (wie wir es immer wieder von berühmten Frauen erleben können), bleibt gerade dadurch Mittelpunkt der Szene, selbst in ihrem Sterben noch erfreulich.
Meisterschaft des Liedgesanges, in ihrer persönlichen Eigenart ebenso unnachahmlich wie in geistiger Durchdringung des Vortrags gab Irmgard Seefried in zyklisch geordneten Liedern von Schumann und Brahms. In absoluter Verhaltenheit und Beherrschtheit, allen Ausdruck allein von Ton und Tönung her bestimmend, vermochte sie die Verträumtheit Schumanns ebenso überzeugend nachzugestalten wie die männlich-herbere Art Brahms’, der doch auch der Schalk nicht fehlt. Das Sichverlieren im Gefühl und die sichere Gestaltung von Form, Stimmbogen und Bild, die Klarheit und menschliche Wärme des Gesanges — und alles dies als Einheit einer künstlerisch großen und gereiften Persönlichkeit, das ist Irmgard Seefried im Liedgesang, und man wird dabei nicht an ihre Opernleistung erinnert. Das ist vielleicht die größte Kunst. Als Begleiter hat Erik Werba längst Spitzenklasse, die im Zusammenwirken mit Frau Seefried wohl ihre Vollendung erreicht.
Aus Tokio zurückgekehrt, stellte sich Hans Kann im Konzerthaus mit einem eigenen Klavierabend besonderer Programmweite vor. Von Scarlatti führte der Weg über Mozart, Beethoven und Chopin zu Bartök. Das Spiel ruht auf einer soliden, nicht aufdringlich hervorgekehrten Technik, auf einer sprunghaften Intellektualität, die, mitunter nicht ohne Schwierigkeiten, in das Wesen selbst solcher Werke einzudringen versucht, für die noch eine Fülle innerer Erlebnisse nötig wäre. Das zeigt sich nach den fein durchleuchteten italienischen und mozartischen Klängen am deutlichsten bei Beethovens Opus 110. Hier ist noch ein merkbarer Abstand zwischen dem unbekümmerten Zupacken und dem Gefühlsgehalt spürbar, der zuweilen ein unpersönliches konventionelles Maß annimmt.
Ganz anders gibt sich Walter Klien, den wir als Solisten in Ravels Konzert für Klavier und Orchester G-Dur (öffentliches Konzert des Oesterreichischen Rundfunks) hörten. Dem Pianisten kommt ein un- gemein wandlungsfähiger Anschlag zugute. Wenn man etwa den dritten Satz an einem anderen Abend mit geschlossenen Augen gehört hätte als das Adagio assai des zweiten Satzes — man hätte fast zweifeln können, daß es sich um den gleichen Interpreten handelt. Bei Klien brilliert die Technik ungehemmt — aber die Solostellen mit dem bezaubernd ausschwingenden Melos der hohen Lagen, dieses verklärte Leuchten des Gemüts, hatten das gleiche Gewicht wie die rr- hematisch anmutende Brillanz des Prestos. — Der Abend brachte als Erstaufführung die II. Symphonie des .1932 in Mailand geborenen Niccolo Castiglioni. Die Mikrothematik des Achtzehn- minütenwerkes stellt an den Hörer und das Orchester (Großes Wiener Rundfunkorchester unter dem subtil zeichnenden Miltiades Caridis) bedeutende Anforde, Busoni und Webern sind deutlich. Aber dem Werk fehlt die ideelle Substanz und die Kraft des Zusam- menbindens: die Spekulation endet in zwölftönigem Leerlauf.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!