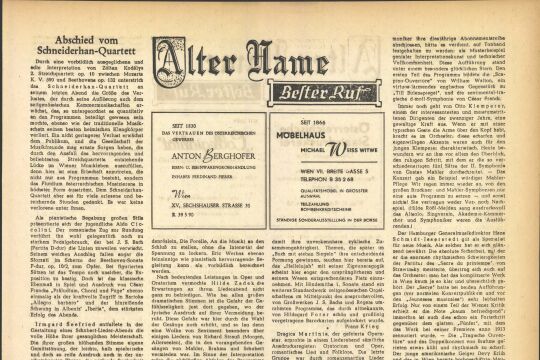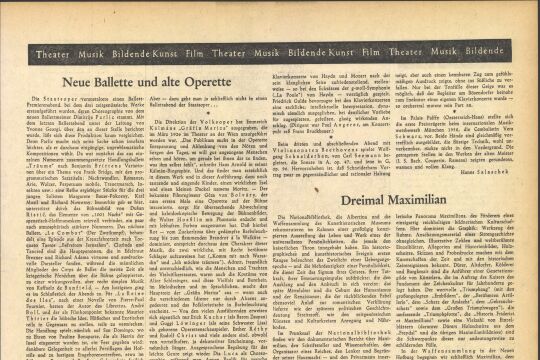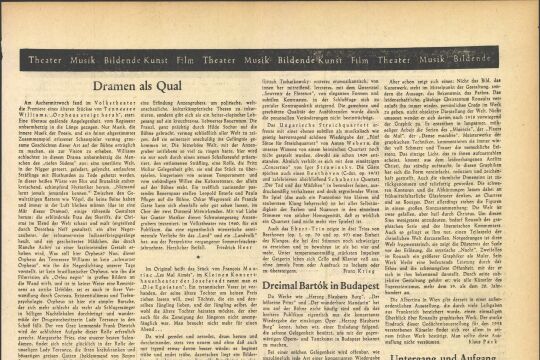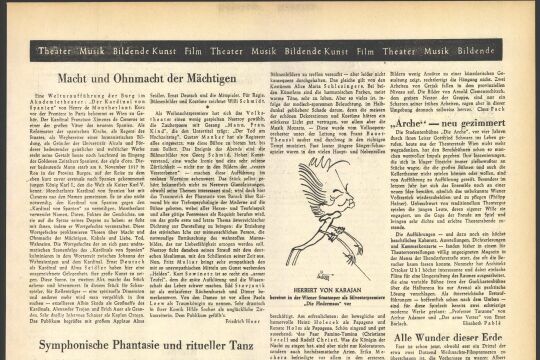Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Stabat mater, Hindemith-Konzert
Wiener Symphoniker und Wiener Singakademie bestritten den instrumentalen und chorischen Teil des „Stabat mater“ von Anton Dvofäk, zu dem der Dirigent Zdenek Kosler sich die Solisten Eva Ge-bauerovä, Vera Soukopovä, Jiri Zahrad-nicek und Eduard Haken mitbrachte, die aber anscheinend insgesamt indisponiert waren. Trotz lebhafter Gestaltung von seiten des tüchtigen und temperamentvollen Dirigenten und trotz hervorragender Leistung des Chores und Orchesters und bei aller Wiener Vorliebe für Anton Dvofäk dürfte das „Stabat mater“ kaum Spielplan und Publikum hierzulande erobern. Vom kirchlichen Standpunkt (als Sequenz am Feste Maria sieben Schmerzen) hat es durch Anlage und Dauer keine Bedeutung, als Oratorium besitzt es zuwenig Spannung und Vielfalt. Vielmehr wird ein pseudosakraler Ton festgehalten, der weder Fisch noch Fleisch ist, soweit man die Musik am Text zu messen hat. Kompositionen des gleichen Textes von Palestrina, Pergolese und selbst Rossini stehen, kirchlich oder konzertant, dem Inhalt der wunderbaren Verse viel näher. Wir sagen dies mit einer Verbeugung vor Dvofäk, dessen Messe in D zu hören bestimmt mehr Freude und Wirkung erregt hätte. So blieb es bei einer guten, bemühten Leistung, die leider nicht erwärmte. H. A.
Eichendorf f-Schumannsche Romantik haben wir selten so unmittelbar erlebt wie im Liederabend von Hermann Prey. In voller Natürlichkeit, ohne jedes äußere Stimulans, allein aus sich heraus vermag dieser Künstler dem Gedicht und seiner Weise ihren fröhlichen, verträumten, zärtlichen oder balladesken Ausdruck zu geben, das schillernde Wechselspiel der Tönung und Dynamik ist ihm ebenso zu eigen wie der große Spannbogen eines Zyklus. Wer die „Mondnacht“ und die „Frühlingsnacht“ in derselben Programmfolge mit gleicher Vollendung singen kann, steht zweifelsohne in der ersten Reihe unserer Liedersänger. Bei den folgenden „Vier ernsten Gesängen“ von Johannes Brahms erreichte der Kontrast zwischen der Jugend des Interpreten und der Todesnähe der biblischen Texte die Wirkung einer tragischen Szene. Befreiend folgten die von Brahms bearbeiteten deutschen Volkslieder als ein bunter Strauß tönender Blumen. Die Klavierbegleitung Günther Weißenborns war sehr diskret, wenn auch stellenweise ein trockener Kontrapunkt. Das Publikum nahm das Ende des immerhin 23 Lieder umfassenden Programms nicht zur Kenntnis und erzwang sieben Zugaben.
Es gibt wenig Pianisten, die uns in ihrem Spiel menschlich so nahe kommen wie Rudolf Serkin. Man spürt seinen Kampf mit dem Engel: „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!“ Schumanns Konzert ohne Orchester op. 14 war voll dieses Kampfes, und nicht weniger Beethovens Sonate A-Dur, op. 101, der der Segen nicht ausblieb. Die elegante Kunst eines durch und durch dem Ergebenen und sich selbst Vergessenden war sogar in Chopins Barcarole Fis-Dur, op. 60, und Bolero op. 19, noch mehr in Mendelssohns Variations serieuses und im Rondo capriccioso vergeistigt und beseelt. Wenn trotzdem ein Rest blieb, der nicht aufging, mag er in einer subjektiven Isolation liegen, vor der man sich beugte, ohne sie teilen zu können.
Das Programm des von Wolfgang Sawallisch geleiteten 3. Konzerts im Zyklus „Wiener Symphoniker“ am vergangenen Sonntagabend wurde in sehr taktvoller Weise wegen des eine Stunde vorher bekanntgegebenen Abscheidens des Herrn Bundespräsidenten geändert. An Stelle von Gershwins „Rhapsodie in Blue“ erklang der Trauermarsch aus Beethovens „Eroica“. Danach folgte Ravels dramatisch-rhapsodisches Klavierkonzert für die linke Hand, ein ebenso bedeutendes wie brillantes Werk, das Ravel für den einarmigen Pianisten Paul Wittgenstein geschrieben hat und das im gleichen Saal am 5. Jänner 1932 uraufgeführt wurde. Alexander Jenner hat sich der schwierigen, aber dankbaren Aufgabe bestens entledigt, wenn er auch als pianistischer Typus wahrscheinlich mehr Affinitäten zu dem gleichzeitig entstandenen G-Dur-Konzert von Ravel — dem leichteren, spielerischen — hat. Als Interpreten von Mussorgskys „Bildern einer Ausstellung“ in der effektvollen Orchesterfassung Ra-vels haben wir die Wiener Symphoniker wiederholt bewundert. Ein interessantes Programm in glänzender Darbietung.
Dem jungen Hindemith der Jahre 1921 bis 1924 war das von Friedrich Cerha dirigierte letzte Konzert der „Reihe“ im Mozart-Saal gewidmet. Hat er jemals später Genialeres, Fesselnderes geschrieben als die Kammermusik Nr. 1 und 2 für 12 Soloinstrumente, zu denen bei der letzteren noch ein solistisch behandeltes Klavier hinzutritt? In dem frühen Streichtrio aus dem Jahr 1924 (op. 34, Nr. 1) kündigt sich allerdings schon ><e Gefahr an: der „papierene“ Kontrapunkt, den freilich, im gleichen Stück, der vorletzte Pizzi-cato-Satz mit einer Handbewegung hinwegwischt. Die Klaviersuite „1922“, eines der von der neueren Musikwissenschaft am häufigsten analysierten und bemühten Werke Hindemiths, hören wir heute mit anderen Ohren als Anno dazumal, bald nach seiner Entstehung. Es sind nicht nur die „gay twenties“, die daraus sprechen, sondern auch Barbarisch-Chaotisches, Ballungen und Entladungen von einer Gewalt, wie vielleicht nur noch in dem zehn Jahre früher entstandenen „Sacre“ von Stra-winsky. Elsa Stock-Hug spielte das ungemein schwierige Werk (Hindemith war kein guter Pianist!) mit männlicher Kraft, Leichtigkeit und Vehemenz. Eine erstaunliche Leistung. Helmut A. Fiechtner
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!