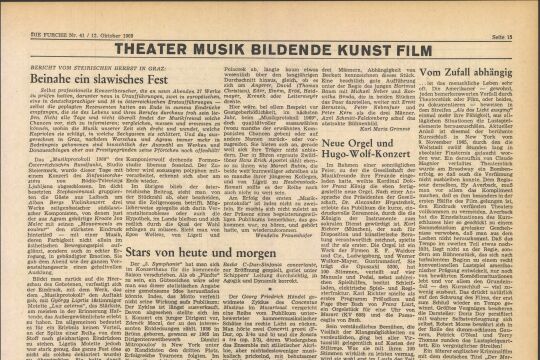Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Von Bach bis Ligeti
Zdenek Kosler dirigierte das 3. Konzert im Dvorak-Zyklus der Wiener Symphoniker. Blutvolles Musikantentum des Komponisten in der Ouvertüre „Carneval“ wurde fantastisch gut musiziert. Das Violinkonzert a-Moll, op. 53, das Dvoräk dem Geiger Joachim zuliebe, dem es gewidmet ist, zweimal gründlich umarbeitete, fand in Ricardo Odnopo- soff einen Solisten ersten Ranges, der sogleich die Führung übernahm und das Orchester beschwingte, das Zdenek Kosler behutsam führte. Die Abschließende 3. Symphonie die als Jugendwerk im Schatten der bekannten Meistersymphonien steht, ist trotz ihrer unverbindlichen Haltung in Klang und Ausdruck von prächtiger Frische und glänzender Instrumentierung, und sehr wohl wert, gehört zu werden, was der Beifall des Publikums bewies.
Das 2. Konzert des Symphoniker- Zyklus hatte Joseph Haydns Symphonie mit dem Paukenschlag, Robert Schumanns Klavierkonzert a-Moll, op. 54, und die Vierte Brahms- Symphonie auf dem Programm. Dirigent war Wolfgang Sawallisch, Solist Alfred Brendel. Es war ein Abend besonders schönen Musizierens. Das immer Überraschende in Haydns Symphonie, der Wechsel von feierlicher Verhaltenheit und heiterer Gelöstheit; das nicht im Virtuosen, sondern bei aller Klavieristik im Symphonischen wurzelnde Klavierkonzert Schumanns mit seiner glänzenden Instrumentierung und seiner romantischen Ausdruckswelt, im Solopart von Brendel hervorragend gestaltet; schließlich die herb-ernste „Vierte“ von Brahms, die doch soviel Ruhe und Sicherheit verströmt (siehe das unvergeßliche Anfangsthema und die gewaltige Passacaglia im Finale!) — es kam alles zu voller Geltung mit heroischem Unterton, der wohl der Mentalität des Dirigenten besonders entspricht. Das Publikum war begeistert und gab dieser Begeisterung durch lang dauernden Applaus Ausdruck.
Erwähnt sei wenigstens das Konzert des Symphonieorchesters der Universität von Tokio, das am vergangenen Freitag im Großen Festsaal der Universität stattfand und aus Platzmangel leider nicht besprochen werden kann. Neben Werken von Beethoven und Mendelssohn war auch ein Konzert für Marimbaphon und Orchester von Hayakawa angekündigt. Franz Krieg
Für ihren Bach-Zyklus hat die Wiener Konzerthausgesellschaft den Concentus musicus gewonnen, der bisher vornehmlich in historischen Räumen (und in Schallplattenstudios) musizierte. Man spielt, wie Nicolaus Harnoncourt dies einmal in einem ausführlichen Artikel in der „Furche“ dargelegt hat, ausschließlich auf alten beziehungsweise nach authentischen Vorbildern rekonstruierten Instrumenten, und man versucht, die alten Werke so zu interpretieren, wie es die Forschung glaubhaft macht. Im 1. Konzert wurde beides (Instrumentarium und Spielweise) an der D-Dur-Suite Nr. 3, dem Konzert für zwei Violinen, d-Moll, und dem 5. Brandenburgischen Konzert demonstriert. Mit seiner „Großbesetzung“ von eineinhalb Dutzend Mann rückte der Concentus, ohne Dirigenten, im ersten Stück an; bei den folgenden waren es dann, außer den Solisten, nur noch etwa ein halbes Dutzend „Begleiter" (vorzüglich in jeder Hinsicht: Alice Harnoncourt und Walter Pfeiffer — Violine, Flute traver- siėre — Leopold Stastny und Cembalo — Herbert Tachezi). Man spielt im allgemeinen ziemlich natürlich, flott und keineswegs leisetreterisch, aber das Klangvolumen der schönen alten Instrumente aus dem 17. und 18. Jahrhundert ist gering, und der Mozartsaal schluckte zu viel (während die Marmorwände etwa des Schwarzenberg-Palais den Klang hart reflektierten). Doch dafür konnten die exzellenten jungen Musiker nichts ... Viel Beifall.
Eugene Ormandy, 1899 in Ungarn geboren, steht seit bald 30 Jahren an der Spitze des Philadelphia
Orchestra und hat diesem den unter Stokowski eroberten ersten Rang unter den amerikanischen Orchestern zu erhalten gewußt. — Die Werke, die Ormandy im 2. Abonnementkonzert der Wiener Philharmoniker dirigierte, sind so bekannt, daß an dieser Stelle nur von der Interpretation gesprochen zu werden braucht. Das Eigentümliche (das eigentlich das Selbstverständliche sein sollte) und Erfreuliche seiner Interpretation ist, daß man sowohl bei Mozart (Haffner-Symphonie), Respighi (Fontane di Roma, 1916) und Schostakowitsch (5. Symphonie, 1937) nie mit dem Dirigenten, sondern immer mit dem Werk konfrontiert wird. Darin versteht sich Ormandy ausgezeichnet mit unseren Philharmonikern, die ebenfalls große „Unterspieler“ sind, das heißt: technisch überaus schwierige und äußerste Präzision erfordernde Stellen werden nicht „serviert“, sondern quasi beiläufig gebracht, so zum Beispiel einige besonders heikle Streicherpassagen bei Mozart. Als Höhepunkt der Interpretation empfanden wir den Largosatz in der Symphonie Schostakowitschs, den wir noch nie so intensiv und so stimmungsgeladen gehört haben. Der Beifall schien uns nicht ganz den hervorragenden Leistungen von Dirigent und Orchester zu entsprechen.
In musikalisches Neuland stößt der 1923 in Siebenbürgen geborene Ungar György Ligeti mit seinen „Aventures“ und „Nouvelles Aven- tures“ (1962 bis 1965) vor. Diese Abenteuer des Klanges und der Strukturen erscheinen im so bemerkenswerter, als sie mit bescheidenen kammermusikalischen Mitteln — drei Sänger und sieben Instrumentalisten — und ohne Einsatz elektronischer Klangspielereien realisiert werden. Es ist nicht leicht, zu beschreiben, was sich da im letzten „Reihe-Konzert“ im Mozartsaal ereignete. Anläßlich der Hamburger Urauffühung der „Abenteuer“, der vor kurzem auch eine szenische Wiedergabe durch die Stuttgarter Oper folgte, schrieb der Komponist, es handle sich bei diesen musikalischphonetisch-dramatischen Stücken um eine imaginäre Oper ohne Text. Und in der Tat ist, was die drei Sänger gemeinsam mit den Instrumentalisten produzieren, von heftigster affektiver Dramatik; das Zischen, Lachen, Stöhnen, Flüstern, Schreien und Wispern hat aber nie einen konkreten semantischen Sinn. — Die virtuose Wiedergabe durch Gertie Charlent, Marie Therese Cahn und den farbigen Bariton William Pearson sowie durch sieben Instrumentalsolisten der „Reihe“ unter der Leitung von Friedrich Cerha war von bewundernswürdiger Präzision, die viel zur „Glaubhaftigkeit“ dieses kühnen Experiments beitrug. Diese Produktion sollte unbedingt auf Schallplatten aufgenommen und das Ensemble bei internationalen Veranstaltungen mit Werken neuer Musik präsentiert werden. — Von ähnlicher Kühnheit mag den Zuhörern im Berliner Choralionsaal im Jahr 1912 Schönbergs „Pierrot Lunaire“ nach 21 Gedichten Albert Girauds für Sopran, fünf Instrumente und Klavier erschienen sein. Im Lauf der Jahre hat man sich daran gewöhnt, aber die Interpretation durch Marie Therese Escribano war trotz ihrer bemühten Korrektheit nicht die überzeugendste, die wir gehört haben. Beide Werke wurden von einem interessierten Publikum mit begeistertem Beifall quittiert.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!