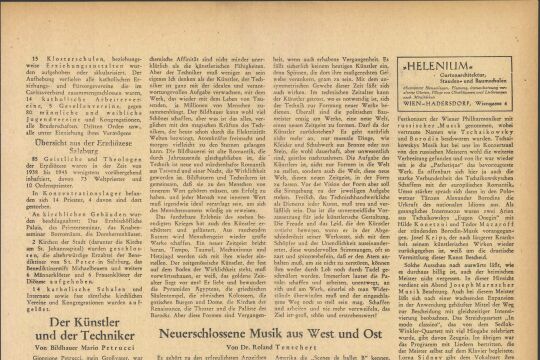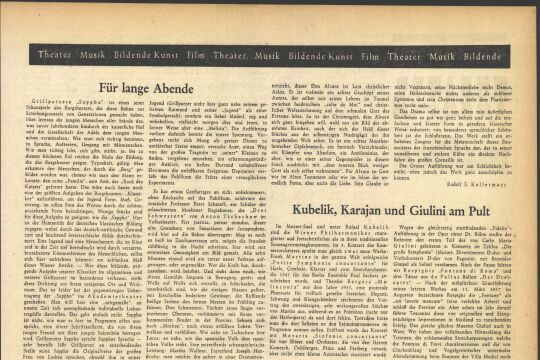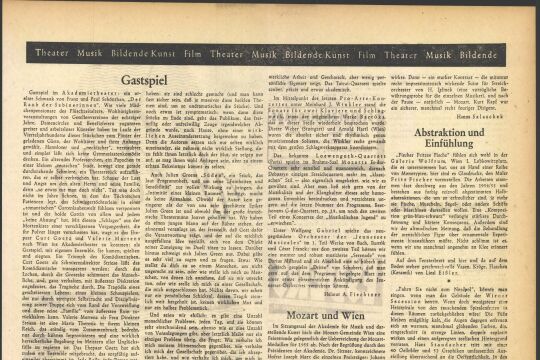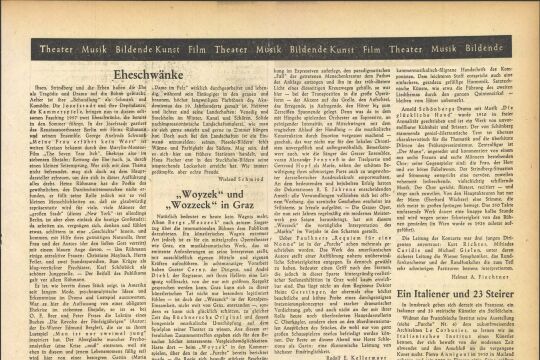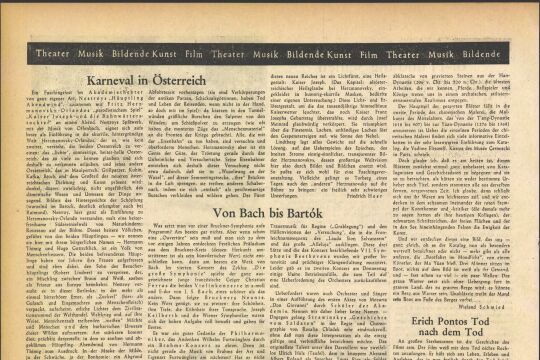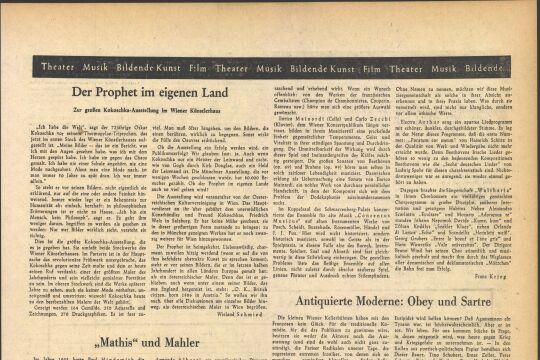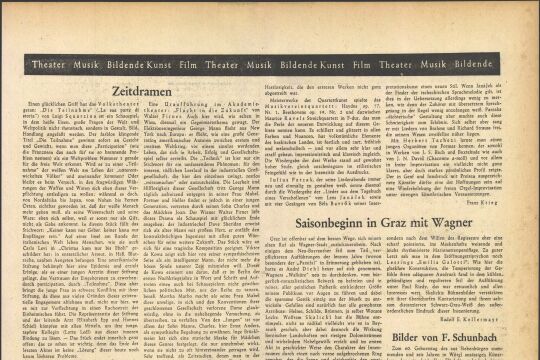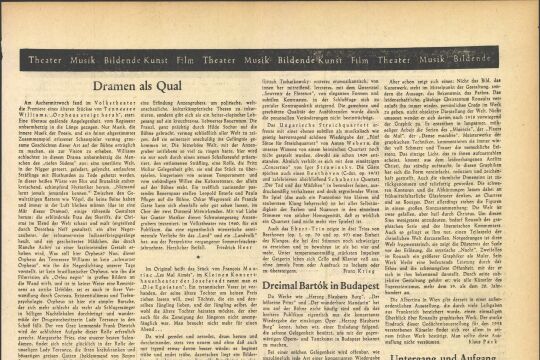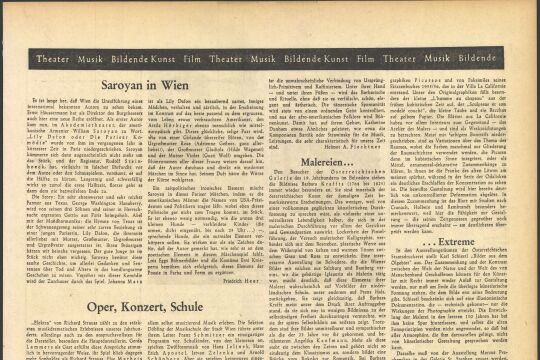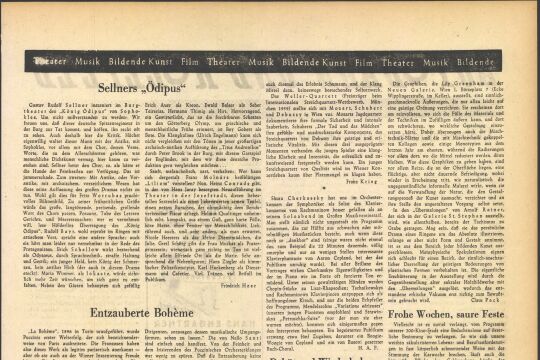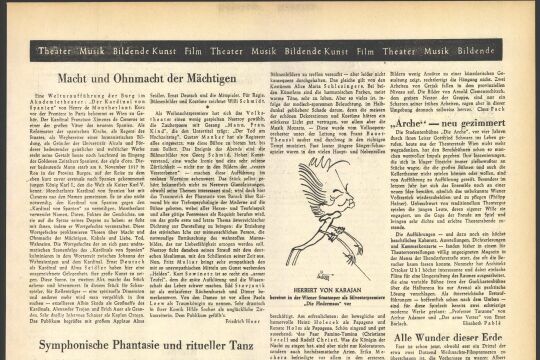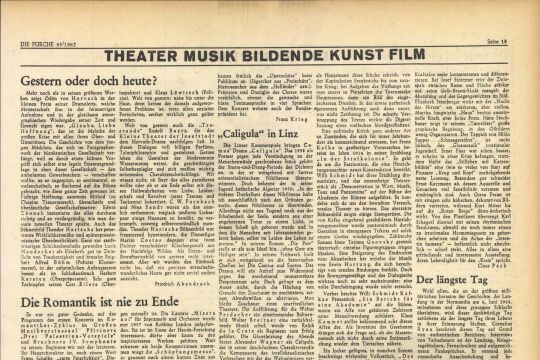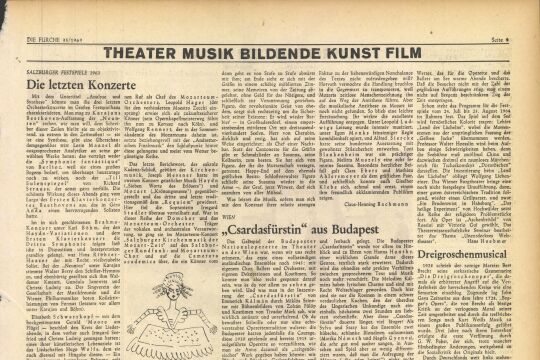Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Von Bach zu Schostakowitsch
Johann Sebastian Bachs Fuga sopta Magnificat „Singet dem Herrn ein neues Lied“ für Doppelchor a cappella stellte selbst eine so geschulte und gewandte Singgemeinschaft wie den Staatsopernchor (unter Hans Gillesberger) vor ungewohnte Probleme klanglicher und stilistischer Art. Der Floribus der Stimmen fordert kammermusikalische Leichtigkeit, die dem Großchor in der räumlichen Klangentfaltung verwehrt ist und die klaren Linien verwischt. Weit plastischer gelang Anton H e i 11 e r s Motette „Ach. wie nichtig, ach, wie flüchtig“, die, obwohl technisch weit schwieriger, schon durch ihre akkordfreie Führung den Stimmen Raum und Farbe gibt. Zur vollen Geltung kam die Schönheit der Stimmen in den fünf Motetten Anton Bruckners und im Deutschen Magnificat von Heinrich Schütz, darin Helga Schramm, Christine Zottl, Rudolf Kreuzberger und Rudolf Resch die Soli sangen und Mitglieder der Wiener Symphoniker die instrumentale Begleitung spielten; mit Josef Nebois an der Orgel und Karl Piks am Cembalo.
Singakademie und Wiener Kammerchor sangen die „ P e z z i s a c r i “ von Verdi. Auch hier gab es, besonders beim „Tedeum“, Intonationsgefahren, die nicht unbedingt überwunden wurden. Auch entbehrte die Textaussprache jeder Sorgfalt; man verstand bloß hie und da ein (lateinisches) Wort. Darüber hinaus faßte jedoch der Dirigent, Argeo Q u a d r i, die Stimmen zu schöner chorischer Wirkung und gewaltigen Klangballungen zusammen.
Das Orchester der Wiener Kult Urgesellschaft unter Josef Maria Müller spielte Anton Bruckners IV. Symphonie in anerkennenswert bravem Bemühen, das nicht in Sauberkeit oder intonalet Sicherheit, dennoch aber1 in der InteptetÄtiöti and Dauer (70 Minuten) hinter den VörMösettürigen blieb. Voran ging die Uraufführung det Symphonie in C-dur des 75jährigen Oskar Dietrich, von der es im Programmheft hieß: Sie beginnt und endet in C-dur, aber dazwischen ist Platz füt allerhand Moll. Dem kann nichts Wesentliches hinzugefügt werden.
Das Amadeus-Quartett (London, allerdings mit Ausnahme des Cellisten wienerischer Herkunft), bei seinem letzten Wienet Auftreten vielleicht noch ein Ver-sptechen, hat dieses nun erfüllt und sich sowohl in Bartöks Streichquartett Nr. 6 als in Schuberts a-Moll-Quar-tett als geistiges und künstlerisch hochstehendes Ensemble legitimiert. Schon das voranstehende Streichquartett G-dut, op. 64/4 von H a y d n stand untet diesem Zeichen. Der Wunsch nach Wiederhören der vier Musiker dürfte ihr überzeugendster Erfolg sein. Franz Krieg
Rafael Frühbeck de Burgos, ein junger schlanker Spanier, war der Dirigent des 5. Konzerts im Zyklus „D i e große Symphonie“. Er hatte die Ouvertüre seines bei uns wenig bekannten Landsmannes, des frühverstorbenen Juan Chrisostomo Arriaga (1806 bis 1826), der von zeitgenössischen Kennern als ein Talent erster Ordnung gerühmt wurde, an den Anfang seines Programms gesetzt: ein flottes, liebenswürdiges Stück, das an Rossini und Mozart denken läßt. Dann spielte Shura Cherkassky mit seiner an dieser Stelle vor kurzem gerühmten Meisterschaft und Bravour ein Klavierkonzert von Tschaikowsky. Aber, erfreulicherweise, nicht das wohlbekannte erste, sondern das in Technik, Charakter und Ausdruck von seinem Votgänger völlig verschiedene zweite in 6-Dut: eine elegante, unterhaltsame Komposition voller gutet Laune mit einem brillanten Klaviersatz, ein Werk, das eine solche Vernachlässigung in unseren Konzertsälen keineswegs verdient hat. — Den zweiten Teil des Programms bildete Schostakowitschs X. Sympho-n i e, die anläßlich ihrer Wiener Erstaufführung (unter Karajan, im Dezember 1959) an dieser Stelle ausführlich besprochen wurde. Beim zweiten Hören — und in einer weniger intensiven Darbietung — zeigt das fast einstündige Werk auch seine Schwächen, deren größte in der Langatmigkeit des ersten, mehr als 20 Minuten währenden Satzes besteht, dem es zwar keineswegs an Substanz mangelt — aber es geht nicht vorwärts (was bei Schostakowitsch selten vorkommt), es wird zuviel leerer Lärm produziert, und das ganze ist techt ermüdend. Der routinierte, zunächst etwas farblos wirkende
Dirigent kennt dieses Werk genau, er ist ein aufmerksamer und umsichtiger Orchesterleiter (Wiener Symphoniker) und tat sein möglichstes, die schwet verdauliche Kost schmackhaft zu machen. Wenn es ihm nicht ganz gelungen ist, so lag es auch ein wenig am Objekt.
Die Zagreber Solisten untet Leitung Antonio Janigros sind ein sehr sympathisches und tüchtiges Ensemble. Die Konkurrenz untet den meist aus etwa zwölf Mann bestehenden Streicherensembles ist während der letzten Jahre erfreulich hart geworden, und die Maßstäbe, die man anlegen darf, sind die höchsten. So muß man nach dem letzten Konzett der Zagreber im gutbesetzten Mozart-Saal feststellen, daß diese weder die Intensität und Exaktheit des Zürcher Kammerorchesters noch den schwelgerischen und zugleich noblen Schönklang der römischen Musici und Vir-tuosi haben. Aber die Zagreber Solisten sind trotzdem hörenswert, besonders in Wien, wo wir zumindest ihrer Routine nichts an die Seite zu stellen haben. Im etsten Teil spielten sie Symphonien und Con-certi von Vivaldi, Couperin, Tartin i und Pergolesi, im zweiten neue Streichermusik von H i n d e m i t h (die an einem Tag geschriebene Trauermusik auf den Tod König Georgs von 1936), Albert R o u s s e 1 (Sinfonietta), W e-b e r n (fünf Sätze für Streichorchester op. 5 von insgesamt zehn Minuten Dauer) und Schostakowitsch (ein Schetzo aus dem Streichoktett op. 11 von 1925, also aus des Komponisten „wilder“ Zeit). Zu den Komponisten des ersten Teils scheinen die Zagreber Musiker ein unmittelbares Verhältnis zu haben; die vier so grundverschiedenen neuen Werke klangen ein wenig allzu ähnlich; vor allem bei Webern, det sehr korrekt gespielt wurde, w¥f -eine iensiblSfei'ditfereSWielitere .fTönw) ge»uitg: - yenkbar^Wie- 'das-'-Eristmbie.- so sind auch die Solisten: Jelka Stanic, Violine, und Antonio J a n i g t o, der in zwei Stücken den Dirigentenstab mit dem Cellobogen vertauschte und, vor seinen ihn im Halbkreis umsitzenden Musikern auf einem Podium thronend, einen etwas merkwürdigen Anblick bot... Als Cellist und Dirigent ist Herr Janigro eine recht gute Klasse, überdies ein sehr natürlicher und kultivierter Musiker. Wie das letzte Reihenkonzert mit Werken von Strawinsky und Ravel, zeigte auch das Konzert der Zagreber einen Mangel, das heißt ein Zuviel an Stücken (insgesamt acht Kompositionen mit zwei Dutzend kleinen Sätzchen). Die Nachteile einer solchen Programmgestaltung wurden in der letzten Nummer der „Furche“ auf dieser Seite erläutert, sparen wir diesmal daher Zeit und Platz.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!