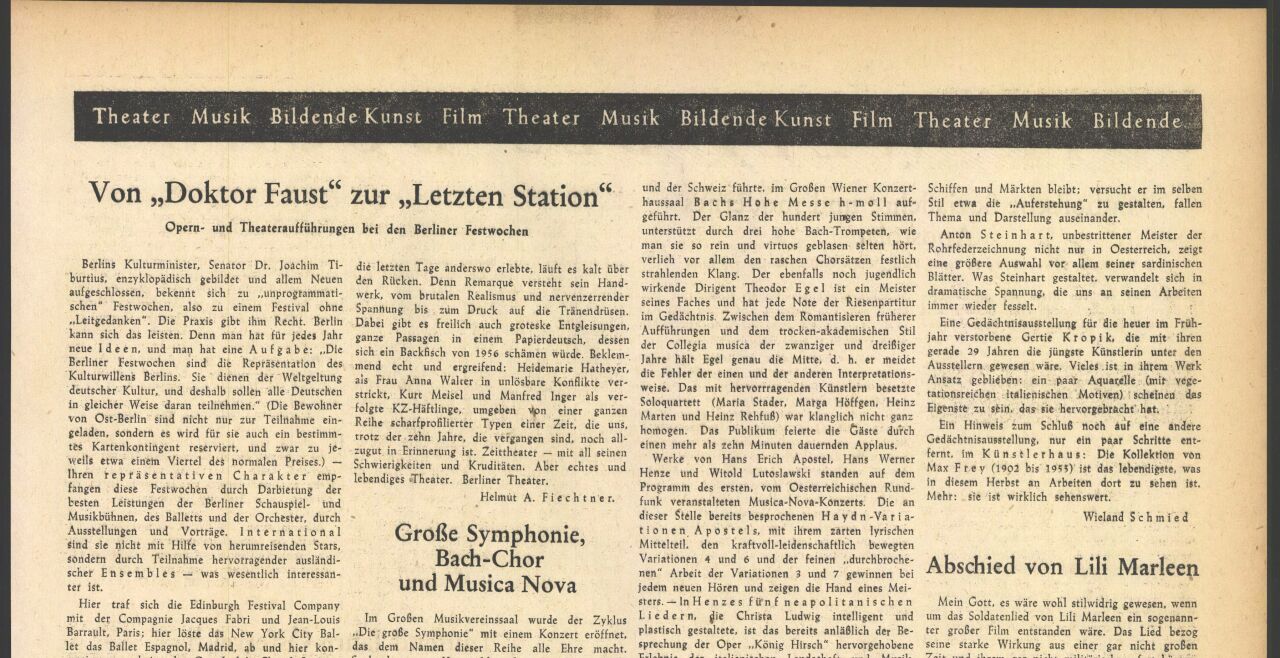
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Von „Doktor Faust“ zur „Letzten Station“
Berlins Kulturminister, Senator Dr. Joachim Tiburtius, enzyklopädisch gebildet und allem Neuen aufgeschlossen, bekennt sich zu „uiiprogtammati-schen“ Festwochen, also zu einem Festival ohne „Leitgedanken“. Die Praxis gibt ihm Recht. Berlin kann sich das leisten. Denn man hat für jedes Jahr neue Ideen, und man hat eine Aufgabe: „Die Berliner Festwochen sind die Repräsentation des Kulturwillens Berlins. Sie dienen der Weltgeltung deutscher Kultur, und deshalb sollen alle Deutschen in gleicher Weise daran teilnehmen.“ (Die Bewohner von Ost-Berlin sind nicht nur zur Teilnahme eingeladen, sondern es wird für sie auch ein bestimmtes Kartenkontingent reserviert, und zwar zu jeweils etwa einem Viertel des normalen Preises.) — Ihren repräsentativen Charakter empfangen diese Festwochen durch Darbietung der besten Leistungen der Berliner Schauspiel- und Musikbühnen, des Balletts und der Orchester, durch Ausstellungen und Vorträge. International Sind sie nicht mit Hilfe von herumreisenden Stars, sondern durch Teilnahme hervorragender ausländischer Ensembles — was wesentlich interessanter ist.
Hier traf sich die Edinburgh Festival Company mit der Compagnie Jacques Fabri und Jean-Louis Barraült, Paris; hier löste das New York City Ballet das Ballet Espagnol, Madrid, ab und hier konzertierten nacheinander Our Lady's Choral Society, Irland, und der Freiburger Bach-Chor mit dem Symphonieorchester von Winterthur. Die bildende Kunst war mit 120 Meisterv/erken aus dem Musee d Art Moderne, Paris (erläutert von Werner Haftmann und Will Grohmann), mit einer Kokoschka-und einer Willi-Baumeister-Gedächtnisausstellung glänzend vertreten. Sieben Berliner Bühnen zeigten innerhalb von zwei Wochen ihre besten Inszenierungen und brachten je eine bis zwei Ur-oder Erstaufführungen.
In der Städtischen Oper fanden zwei Uraufführungen durch das Berliner Ballett unter d'er Leitung von Tatjana Gsovsky statt, ferner die deutsche Erstaufführung von Blachers „Mohr von Venedig“, Egks „Zaubergeige“, Busonis „Doktor Faust“ sowie die an dieser Stelle ausführlich gewürdigte Uraufführung von Werner Henzes „König Hirsch“. Im Schillertheater gab man Shakespeares „Maß für Maß“, Calderons „Dame Kobold“, „Dantons Tod“ von Büchner, Baflachs „Armen Vetter“ und „Cristinas Heimreise“ von Hofmannsthal. Im Schloßparktheater erregte Strind-bergs „Nach Damaskus“, Anouilhs „Ornifle“ und „Das Tagebüch d'er Anne Frank“ Aufsehen.“Als die intensivste Schauspielaufführung kann man wohl „Eines langen Tages Reise in die Nacht“ von O'Neill im Theater am Kurfürstendamm bezeichnen, als die aufregendste: Remarques „Letzte Station“ im Renaissance-Theat er.
An ein hochinteressantes und wertvolles, aber fast vergessenes Werk des Deutschitalieners und Wahl-Berliners Ferruccio Busoni (der hier von 1894 mit kurzer Unterbrechung bis zu seinem Tod im Jahre 1924 lebte) erinnerte die Städtische Oper. Buäonis „Doktor Faust“ basiert auf einem der vielen Volksbücher und gliedert die Handlung in zwei Vorspiele in Fausts Studierzimmer (Besuch dreier Studenten aus Krakau als „Satansboten“ und Teufelspakt), ein Zwischenspiel im Münster (Mephisto-Faust und Bruder Gretchens, die selbst nicht in Erscheinung tritt) und drei große Szenen des Hauptspieles: Herzoglicher Hof zu Parma (etwa der Szene Kaiserliche Pfalz bei Goethe entsprechend), Schenke zu Wittenberg (korrespondierend mit Auerbachs Keller) und Straße zu Wittenberg (Fausts Ende). — In den geschlossenen Szenen, den großen Soli und den Vor- und Zwischenspielen (Symphonia, Cortege, Sarabande) zeigt sich Busoni als origineller und feiner Musiker, der, soweit das überhaupt möglich ist, durch Kunstverstand und hohen Ernst jenen Impetus, jenes genialisch-unvernünftige Element kompensiert, das für ein breiteres Publikum nun einmal zum Musiktheater gehört. Darstellerisch und stimmlich hervorragend war — unter der musikalischen Leitung von Richard Kraus ^- Dietrich Fischer-Dieskau in der Titelpartie; ein wenig farblos und bescheiden wirkten die Bühnenbilder, vor allem aber die Kostüme Caspar Nehers; auch die Regie (Wolf Völker) könnte man sich besser vorstellen. Trotzdem empfing man von dieser Aufführung einen starken Eindruck, in erster Linie durch ein Werk, das leistungsfähigen Bühnen warm empfohlen werden kann.
Eine mutige Tat setzten auch das Renaissance-Theater, der Regisseur Paul Verhoeven und der Bühnenbildner Fritz Maurischat, die es wagten, den Berlinern im Parkett und in den Logen die „letzten Tage“ Berlins auf der Bühne vorzuführen. Erich Maria Remarques „Letzte Station“ spielt am 30. April und am 1. Mai 1945. Bombenangriffe und SS-Streife, fliehende KZ-Häftlinge und die Eroberer, Russen in Uniform, zum Teil russisch sprechend und mit Maschinenpistolen im Arm: dem „Publikum“ stockt der Atem, und auch dem, der die letzten Tage anderswo erlebte, läuft es kalt über den Rücken. Denn Remarque versteht sein Handwerk, vom brutalen Realismus und nervenzerrender Spannung bis zum Druck auf die Tränendrüsen. Dabei gibt es freilich auch groteske Entgleisungen, ganze Passagen in einem Papierdeutsch, dessen sich ein Backfisch von 1956 schämen würde. Beklemmend echt und ergreifend: Heidemarie Hatheyer, als Frau Anna Walter in unlösbare Konflikte verstrickt, Kurt Meisel und Manfred Inger als verfolgte KZ-Häftlinge, umgeben Iprt einer ganzen Reihe scharfprofilierter Typen einer Zeit, die uns, trotz der zehn Jahre, die vergangen sind, noch allzugut in Erinnerung ist. Zeittheater — mit all seinen Schwierigkeiten und Kruditäten. Aber echtes und lebendiges Theater. Berliner Theater.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































