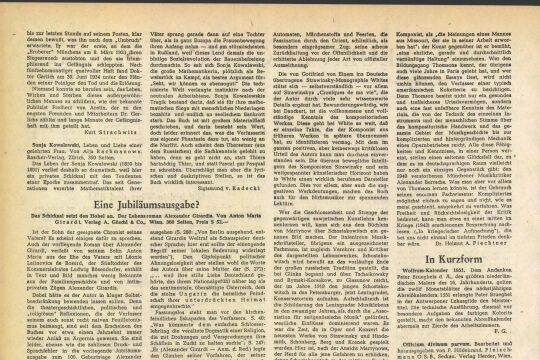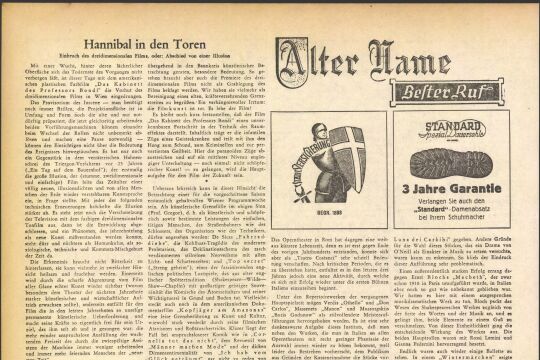Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Was die Staatsoper nicht spielt
Man kann heutzutage nicht über das Repertoiretheater sprechen — dessen den gegenwärtigen Verhältnissen angepaßte Modifikation an allen deutschsprachigen Bühnen längst im Schwange ist und das wir auch beizubehalten wünschen —, ohne vom „Opernschwund“ zu hören, d. h. von der Jahrzehnt für Jahrzehnt, Jahrfünft bis Jahrfünft geringer werdenden Zahl von Werken, die für das Publikum von heute noch akzeptabel sind. — Die Summe der „gängigen“ Werke betrug um die Jahrhundertwende noch 100 bis 120, Heute umfaßt das Repertoire der Wiener Staatsoper (und kein anderes Haus hat mehr) 45 Opern, von denen man im Laufe eines Monats 20 bis 22 sehen kann. Diesen Reichtum möchten wir nicht nur nicht missen, sondern sichten und mehren, indem einige wenige Werke in absehbarer Zeit abzusetzen und andere, das Repertoire repräsentativ gestaltende, neu zu erarbeiten sind.
Es geht dabei nicht ausschließlich um solche neuerer und zeitgenössischer Autoren, sondern auch um die Wiedergewinnung älterer, zu Unrecht vernachlässigter Stücke. Auf einige Desiderata haben wir im Leitartikel der „Furdhe“ („Das Opern- jubiläum 1969“) bereits hingewiesen, auf Gustav Mahlers Bearbeitung der „Drei Pintos“ von Weber, auf „Karl V.“ von Křenek, der für die Wiener Oper bestellt, aber hier noch nie aufgeführt wurde, und auf „Maximilien“ von Darius Milhaud, weil es sich hier nicht nur um einen Stoff aus der österreichischen Geschichte handelt, den ein österreichischer Dichter (Franz Werfel) dramatisiert hat, sondern weil das Werk in jeder Hinsicht interessant und wertvoll ist.
In der Direktion der Wiener Staatsoper werden gegenwärtig Pläne erwogen, die, wenn sie verwirklicht werden, zur Repertoirebereicherung beitragen könnten. Man denkt dort an Einems Kafka-Oper „Der Prozeß" und an „Dalibor" von Smetana in der Regie von Harry Buckwitz; vielleicht wird man sich für „Mefistofeie“ von Bioto, vielleicht für die „Afrikanerin“ oder den „Propheten“ von Meyerbeer entschließen. — Über die Notwendigkeit, Rossinis „Barbier“ in italienischer Sprache neu einzustudieren, kann man geteilter Meinung sein, denn wir haben eher zuviel als zuwenig „Italianitä“ im Großen Haus am Ring ...
An älteren Werken vermissen wir vor allem die Musikdramen Glucks, aber auch wenigstens eine Oper von Purcell. — Aus dem französischen Repertoire fehlen „Die Perlenfischer“ von Bizet, vor allem aber ein Werk von Berlioz („Benvenuto Cellini" oder „Die Trojaner“), von Dukas fehlt der „Blaubart“ und von Debussy „Le Martyre de St. Sebastien“. — Spanien wäre am wirkungsvollsten mit „Meister Pedros Puppenspiel“ von de Falla vertreten. Neben den Opern von Tschaikowsky und Schostakowitsch sollte sich auch der „Don Juan“ des älteren Dargomyschskij (1813 bis 1869) finden, und mit „König Roger“ von Szymanowski könnte vielleicht eine sensationelle Entdeckung für die westlichen Bühnen gelingen.
Einen kleinen aus mindestens drei Opern bestehenden Janáček-Zyklus haben wir schon vor längerer Zeit angeregt (Jaroslav Krombholc könnte Ihn betreuen), auch ein Werk des Tschechen Bohuslav Martinu oder des Slowaken Eugen Suchon läge gewissermaßen nahe ... Wichtige Beiträge zum zeitgenössischen Musiktheater hat Luigi Dallapiccola mit „Nachtflug“ und „Der Gefangene“ geliefert. (Man brauchte sich nicht unbedingt auf seine letzte sehr intellektuelle und epische Oper „Odysseus“ zu stürzen.) Eine der schmerzlichsten Repertoirelücken wird durch die permanente Abwesenheit von Busonis „Doktor Faust“ verursacht, und gewänne man, wie in Berlin, für die mächtige Titelpartie Dietrich Fischer- Dieskau, so wäre der Erfolg sicher. Auch ein anderer Deutschitaliener, Ermanno Wolf-Ferrari, hat nicht nur heitere Opern, sondern auch „Slj/“ geschrieben — aber wer kennt ihn schon? Von Hindemith bedürfte „Mathis der Maler“ einer gründlichen Auffrischung, und von Henze wäre am meisten „Der junge Lord“ zu empfehlen. Von Kurt Weill würde am besten „Die Bürgschaft“, nach einem Text von Caspar Neher, ins Große Haus passen.
Am traurigsten aber ist es mit dem neueren österreichischen Opem- schaffen bestellt. Hier fehlt einmal zunächst Hugo Wolfs „Corregidor“. Natürlich gehört auch eine Oper von Schreker ins Repertoire (entweder „Der ferne Klang“ oder „Die Gezeichneten“). Nachdrücklich sei an Egon Wellesz erinnert, der als Dreiundachtzigjähriger in Oxford lebt, vom österreichischen Rundfunk zwar gefördert, von den Konzert- veranstaltem und der Staatsoper aber konsequent ignoriert wird. In dem Jahrzehnt zwischen 1921 und 1931 hat Wellesz acht musikdramatische Werke geschrieben: vier Opern und vier Ballette, von denen wir vor allem das kultische Tanzspiel „Die Opferung des Gefangenen“ und „Alkestis“ auf einen Text Hofmanns thals empfehlen, den Wellesz in viel adäquaterer Weise vertont hat als Strauss die „Elektra“. Die genannte Wellesz-Oper, 1921 bis 1923 geschrieben, wurde 1924 in Mannheim uraufgeführt, ein Jahr später folgte Gera, hierauf (1926) die Bühnen von Köln, Bremen, Dessau, Coburg, Berlin, die Ravag (1935) mit einer konzertanten Aufführung und zuletzt, 1960, die Akademie für Musik im Akademietheater. Aber „Alkestis“ gehört ins Große Haus; Besetzungsschwierigkeiten dürfte es keine geben, zumal der österreichische Rundfunk für dieses Frühjahr eine Gesamtaufnahme vorbereitet.
Noch manches wäre zu nennen, das gegenwärtig im Spielplan der Staatsoper fehlt, aber gut hineinpassen würde. Doch genug der Vorschläge, auf daß unsere Wunschliste nicht zu lang und zu verwirrend werde. An ihre vollständige Erfüllung, auch im Laufe der nächsten zehn Jahre, haben wir keinen Glauben. Aber vielleicht pickt man sich an verantwortlicher Stelle zwei oder drei der genannten Werke heraus. Das wäre wenigstens etwas für das Jubiläumsjahr 1969.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!