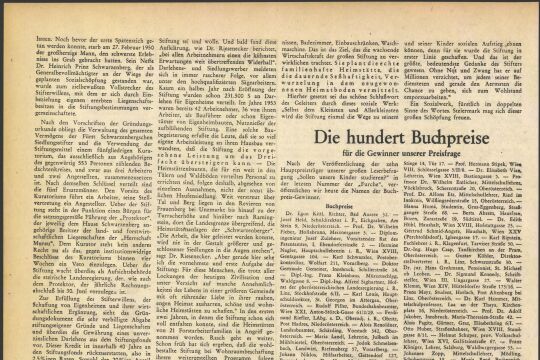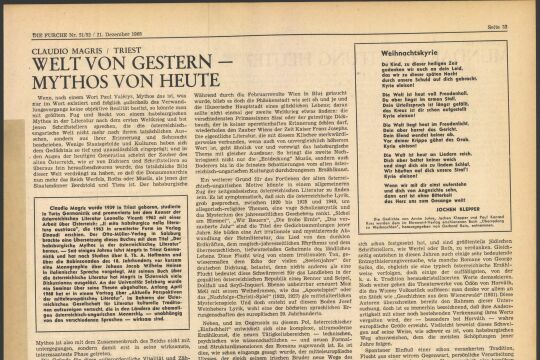Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ariadne auf Naxos
Selten nur ist es uns gegönnt, den schaffenden Künsder unmittelbar am Werk zu sehen, ausnahmsweise nur dürfen wir den Werdegang eines Kunstwerkes, zumal eines literarischen oder musikalischen, vom ersten Aufleuchten der Grundidee bis zur endgültigen Fassung verfolgen. Wir genießen es in seiner schlackenlosen Vollendung, kennen aber fast nie den Dornenweg seiner Entstehung, da erste Entwürfe oder etwa versuchte Zwischenlösungen fast nie auf uns kommen, beziehungsweise vernichtet werden.
Welche Diskrepanz oft zwischen erstem Aufblitzen des „göttlichen Funkens“ und vollendetem Werk!
Die Autoren des „Rosenkavalies“ wollten sich Max Reinhardt für seine tätige Hilfe bei der Inszenierung dieser Komödie für Musik erkenntlich zeigen und ihm und seiner Bühne ein musikalisches Werk widmen. Es sollte eine noble Geste sein ...! Hugo von Hofmannsthals Wahl fiel auf Molieres „Bourgeois gentilhomme“. Er zog die fünf Akte des Stückes auf zwei zusammen, und Richard Strauß stattete diese mit einer funkelnden Bühnenmusik von köstlicher Schönheit aus, die r in verschwenderischer Fülle zwischen die Szenen streute. Statt eines eingelegten Balletts aber, das Jourdain seiner Angebeteten zu Ehren gibt, schrieb der Dichter, offenbar um dem Komponisten Gelegenheit zum musikalischen Ausleben zu geben, eine Miniaturoper, in welcher er das Ariadnemotiv neu gestaltete. Die „Urari-adne“, zunächst Aufputz eines Sprechstückes — allerdings ein Aufputz aus edelstem Material, in verschwenderischer Fülle dargeboten —, war geboren. In dieser Form erblickte das Werk am 25. Oktober 1912 in Stuttgart das Rampenlicht.
Schon dem Titel haftete etwas Monströses an: „Ariadne auf Naxos, Oper in einem Aufzug nebst einem Vorspiel von Hugo von Hofmannsthal. Mit einem Epilog: „Der Bürger als Edelmann“. Ein dramatischmusikalisches Gebild von eigenartiger Gegensätzlichkeit und verwirrender Buntheit! Das in einen antikisierenden Barockrahmen gestellte Lustspiel, trots der mit literarischer Delikatesse vorgenommener Bearbeitung nicht genügend zeitnahe, um wirklichen Anteil zu erwecken, war mit einer Oper, erfüllt von riefer Innerlichkeit, unerhörter Schwungkraft und hellenischer Klarheit zu einem Ganzen zusammengefügt worden. Letztere, als anspruchsloses Einschiebsel gedacht, war zu Dimensionen mit ungeahntem Ideengehalt gewachsen, wie es die Autoren ursprünglich gar nicht gewollt hatten.
Man erinnert sich, daß schon einmal ein anderer großer „Richard“ im Sinne hatte, eine leichte Oper in italienischer Manier zu sdireiben, die sich unter seinen Händen zu dem hohen Lied „Tristan und Isolde“ auswuchs.
Wie vorausgesehen werden konnte, war der Eindruck der Erstaufführung und der Darstellung an anderen Bühnen kein einheitlicher. Trotzdem hielt Strauß an dieser Fassung kompromißlos und ohne Bedacht-nahme auf Wünsche eines breiten Publikums fest, was die gegen ihn oft erhobenen Vorwürfe sogenannter „Geschäfstürhtigkeit“ auf das schlagendste entkräftet.
Jedoch es bestand kein Zweifel — die Oper „Ariadne“ belastete in ihrer grandiosen Ausweitung allzusehr das vorangehend Sprechstück. Die beiden zusammengefügten Teile wollten sich zu keinem harmonischen Ganzen finden. Ariadne mit ihren breit angelegten musikalischen Formen, die in weit ausholenden Bogen, geschlossenen Ensemblesätzen und extatischen Aufschwüngen gipfelte, hatte derart an bedeutsamem Eigenleben gewonnen, daß sie sich allzusehr von der bürgerlichen Komödie Molieres distanzierte. Schließlich mochte sich der Komponist der Zwitterhaftigkeit des Geschaffenen mehr und mehr bewußt geworden sein, und die Autoren einigten sich, eine Umarbeitung vorzunehmen. Die dabei durchgeführte Operation war radikal genug! Das gesamte Moliersche Stück verfiel der Resektion, nur eine ursprünglich zur Oper überleitende Szene wurde zu einem jetzt durchkomponierten Vorspiel ausgeweitet und dessen Handlung nach Wien verlegt: Ein reicher Mäzen hat für ein in seinem Palais stattfindendes Fest eine ernste Oper, eine „Opera seria“ und ein Possenspiel, eine Art Operette bestellt. Nach seiner Anordnung soll zuerst die Oper, dann die Operette zur Aufführung kommen. Schließlich bestimmt er in protzigem Übermut und im Gefühl, sich für sein Geld eben alles leisten zu können, zur Verzweiflung des jungen Komponisten der ernsten Oper, daß beide Stücke zugleich gespielt werden sollen. Und das fast unausführbar Scheinende wird Wirklichkeit! In dieser sogenannten Wiener Fassung kam das Werk im Jahre 1916 in Wien zur Uraufführung.
Was war aber aus der beabsichtigten, bescheidenen Widmung an Reinhardt, der Neubearbeitung eines Moliereschen Lustspieles, geworden! Ein farbenschillerndes, dionysisch hinreißendes, tiefgründiges musikalisches Gebilde eigenartiger Stilform, welches Strauß — als das erste seiner dramati-schen Werke — „Oper“ nennt, dessen Bühnengeschehen in dem einander abgrundtief gegenüberstehenden Wesen zweier Welten verankert ist! Der einen dieser Welten gehört die oberflächliche, gedankenlose, immer nur dem Heute verbundene Zerbi-netta mit ihren einfältigen vier Anbetern an,der anderen die höheren Regionen verwo-bene, adelig erhabene, halbgöttliche Ariadne. Auf der einen Seite das sinnenhungrige Weibchen, das immer dasselbe wiedererlebt, immer wieder enttäuscht wird, immer das gleiche, durchs Leben tanzende, girrende, erdgebundene Flatterwesen bleibt, auf dr anderen Seite — Ariadne, di Frau unter Millionen, die nie vergißt, die immer nur einem angehört, dann keinem mehr, nur dem Tod. „Sie kann nur eines Mannes Hinterbliebene sein.“ Den jugendlichen Bacchus hält sie für den Todesgott, den sie, nachdem sie von Theseus verlassen wurde, in düsterer Resignation ersehnt. „Sie gibt sich dem Tod hin — ist nicht mehr da — weggewischt — stürzt hinein in das Geheimnis der Verwandlung — wird neu geboren — entsteht wieder in seinen Armen!“ Während sie glaubt, sieh dem Tod hinzugeben, fühlt sie sich von dem gottgewordenen Bacchus in Liebe umfangen. „Es nkt ihr Kahn und sinkt zu neuen Meeren.“ Wandlung zu neuen Wandlungen! Wandlung durch das Wahnerlebnis des Todes zu ewiger Liebe!
Aber nicht bloß zwei Welten, auch die sie charakterisierenden und symbolisierenden gegensätzlichen musikalischen Kunstrichtungen treten nun folgerichtig miteinander in Wettstreit. Hier — Talmikunst seichten Singspiels, bravouröser Koloraturleerheit, leichter Tanznummern, dort — selig beschwingtes Dahinfluten, Widerhall ewiger Sternenchör, leuchtende Hell klassischer Schönheit!
Daß Strauß alle musikalischen Möglichkeiten dieser Gegensätze nach seiner Weise nützte und in genialer Weise ausdeutete, ist selbstverständlich. Nach der orgiastisch-orientalischen Salomepalette, den monumentalen, mystischen Elektraklängen, der wienerisch maskierten Walzerseligkeit des Rosenkavalier fand er auch für dieses Werk die entsprechende, neue Ausdrucksform, Fin Kammerorchester von 36 Musikern — Meistern ihres Instrumentes — war ihr Träger. Während er für das Vorspiel eine barock-antikisierende, ironische, geistreich und locker illuminierende Art des Musd-zierens wählte, schuf er für die eigentliche Ariadne-Oper eine eigenartige, mysterfen-dunkle, tiefgründige Musik von selten adeliger Hoheit. Diese neue Ariadne war ein Bekenntnis zur melodischen Gesangslinie, zu traumhafter Orchesterfarbigkeit und vollendeter innerer Geschlossenheit.
Im Abrollen der Opernhandlung verblaßt das operettenhafte Element gegenüber dem in hymnischer Glut aufrauschenden, köstlichen Klanggewebe der „Opera seria“ mehr und mehr, und in breiten Bogen gespanntes, melodisches Ausströmen behauptet in makelloser Verklärtheit reiner und wahrer Kunst das Feld.
Und darin liegt wohl der letzte Sinn dieser Oper.
Alles Irdische sinkt schließlich dahin, jegliche billige Staffage, wie Kronleuchter, Inselfels, Muschel- und Palmendekoration, verdämmert in ihren Konturen und schwindet. Alles Zeitlidie verrauscht in dem ewigen Strom des Seins.
Da ist nicht mehr Kommen und Gehen, nicht mehr Vorstellung und Nichtvorstellung! Nur noch Ruhe, Frieden und — Musik!
Mag sein, daß manches Detail der Opernhandlung dem unvorbereiteten Zuhörer dunkel und unverständlich bleibt, zumal viel an wesentlichem Geschehen in erzählender Gesangsform verankert ist. Immerhin muß auch ihm schon der rein optische und klangliche Eindruck den Sieg reiner Höhenkunst über fragwürdige Talmikunst, des Edlen über das Gemeine, des Erhabenen über das Niedrige vermitteln, soferne er nicht allein mit Ohren und Augen hört und schaut, sondern auch mit dem Herzen und sich willig der Verzauberung durch die heilige Kunst hingibt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!