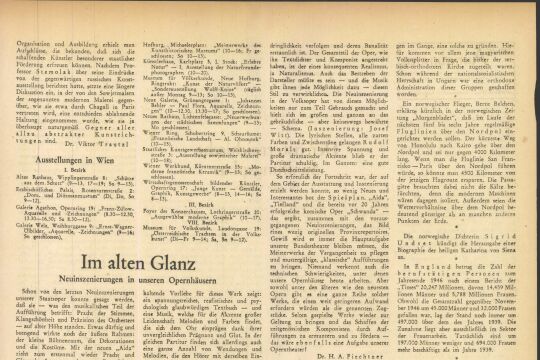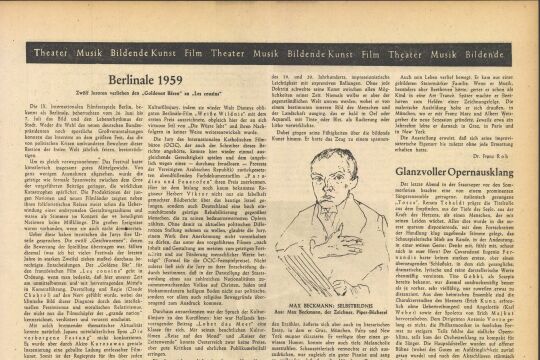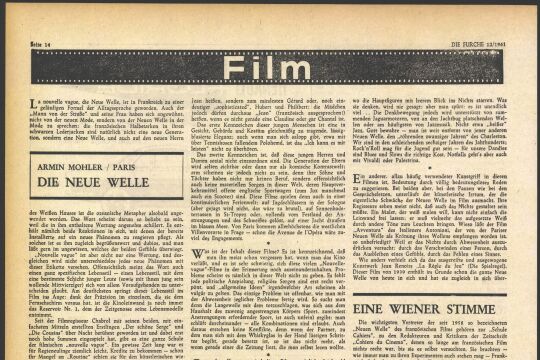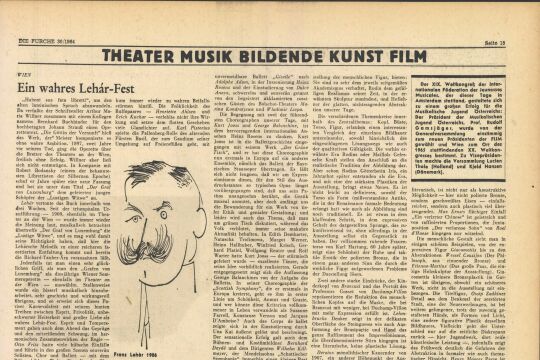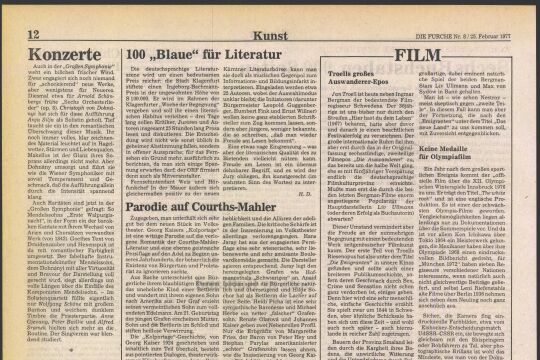Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Bassena-Kino
So bezeichnet man in England scherzhaft jene Abart des „free cinema“, die den Stoff für ihren Realismus hauptsächlich aus der Milieuschilderung von Slumschick-salen bezieht: „kitchen-sink-cinema“. Bai den vorjährigen Filmfestspielen in Karlsbad war ein in diese Sparte fallender Streifen des vom Fernsehen her kommenden englischen Regisseurs Kenneth Loach gleich in zweifacher Hinsicht erfolgreich: „Poor Cow — geküßt und geschlagen“ erhielt Preise für die beste Regieleistung und für die beste Darstellung. War das nicht Vorschußlorbeer? Nun, Loach präsentiert in seinem ersten Kinospielfilm ein wohldosiertes und durchaus akzeptables Gemisch aus bester englischer Problemfilmtradition und jener zur Zeit so beliebten, gefälligen Ansammlung moderner Stilelemente, mit denen Filmschaffende von Antonioni bis Lelouch, von Truffaut bis Lester größere Ausdruckskraft zu erzielen hoffen. Bei Loach sind die Modernismen und Romantizismen allerdings nie Mittel zum Zweck, sondern dienen hauptsächlich zur Steigerung der Kontraste. Ein trostloses Frauenschicksal bildet den roten Handlungsfaden — die Frau eines zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilten Einbrechers schlittert in der quälenden Zeit des Alleinseins „geküßt und geschlagen“ von Verhältnis zu Verhältnis. Loach bedient sich bewährter Fernseheffekte, wie Dokumentaraufnahmen und Selbstbekenntnisse, schneidet dagegen aber romantisch verklärte Wunschträume und Erinnerungen seiner Protagonistin. Diese wird von Carol White verkörpert, einer im Typ etwa an Judy Geeson oder Julie Christie erinnernden jungen Engländerin, die ihr Schauspiel über lange Strecken vergessen läßt. Unter ihren männlichen Kollegen fällt besonders der sympathische Terence Stamp als Dave auf. Besondere Erwähnung verdienen noch zwei Faktoren, denen der Film einen nicht unwesentlichen Teil seiner positiven Gesamtwirkung verdankt: die sorgfältige, Stimmungsmalende Photographie von Brian Probyn und die dezente, balladenartige Filmmusik, die der bekannte englische Folk-Sänger Donovan beisteuerte — sie gehört zum Besten, was seit langer Zeit auf diesem Gebiet geboten wurde.
Sommerreprisen
Es ist nicht Immer leicht, in der sommerlichen Reprisenflut der Kinos, die von Jahr zu Jahr ärger wird, noch erwähnenswerte Erstaufführungen zu bemerken. Eine Ausnahme bildet diese Woche der italienische Streiten „Das ausgeliehene Mädchen“ — und siehe da, wenn der Film auch zum erstenmal bei uns gezeigt wird, entstand er immerhin schon 1964! Zu einer Zeit also, da die Flut von italienischen Filmen sozial-kritischer Natur (wie etwa „Scheidung auf italienisch“) ihren absoluten Höhepunkt schon überschritten hatte. Nun, Alfred Oianetti, der Regisseur des vorliegenden Films war lange Jahre 'hindurch Drehbuchautor bei Pietro Germi, kein Wunder also, daß sein Werk durchaus konkurrenzfähig geraten ist: Gianetti nimmt eine ganz bestimmte, für Italien fast nationaltypische Erscheinungsform des männlichen Charakters aufs Korn, den „unwiderstehlichen“ Charmeur und Frauenhelden mit fast antiken Ansichten über das „Herrschaftsrecht“ des Mannes über die Frau. An Hand seiner beiden Protagonisten, des Müßiggängers Mario und der Bankangestellten Clara — die bereits eine aufgeklärte, emanzipierte Geisteshaltung vertritt — entwickelt Gianetti nun seine treffsichere Sozialkritik, hinter deren heiterer Oberfläche schärfste Satire zu bemerken ist.
Eine interessante Wiederaufführung ist der amerikanische Musikfilm „Die 5000 Finger des Dr. T.“ aus dem Jahre 1952, denn er ist weit mehr als ein Filmmusical im üblichen Sinne. Erstens steht er filmhlstorisch am Wendepunkt vom konventionellen amerikanischen Musikfllm zum modernen Musical und ist somit ebenso legitimer Nachfahre des „Hexers von Oz“ wie Vorläufer von .,Mary Pop-pimis“ — nicht nur stilistisch sondern
auch thematisch. Zweitens aber ist der Streifen das Produkt des Zusammenwirkens mehrerer Persönlichkeiten, die ihn weit über den Durchschnitt heben: Das Drehbuch verfaßte der berühmte amerikanische Tiefenpsychologe Dr. Seus, die Musik (bekannt durch den „Blauen Engel“) komponierte Friedrich Holländer und produziert wurde der Film von Stanley Krämer, der damals — 1952 — noch nicht selbst Regie führte, den Streifen aber auch als
Produzent entscheidend beeinflußt haben dürfte. Das Ergebnis ist eine htareißende Traumparabel, deren tiefere Bedeutung Kinder natürlich nie erfassen werden, die aber dadurch für Erwachsene in gleicher Weise faszinierend wird. Die engagierte Darstellung, die hinreißenden Tanzszenen, die schwungvolle Musik und die perfekte Inszenierung Roy Rowlands ergeben einen eindeutig positiven Gesamteindruck,
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!