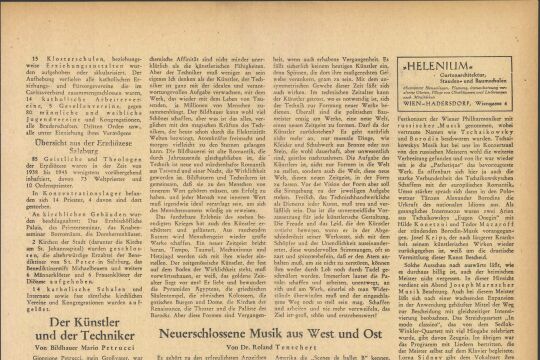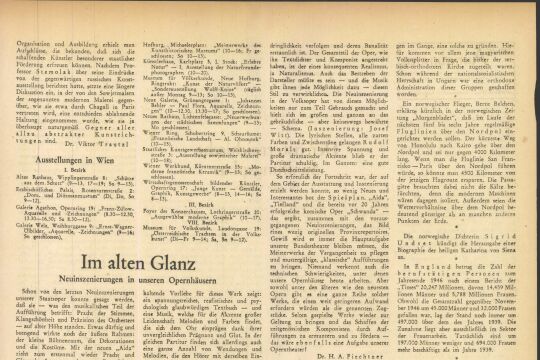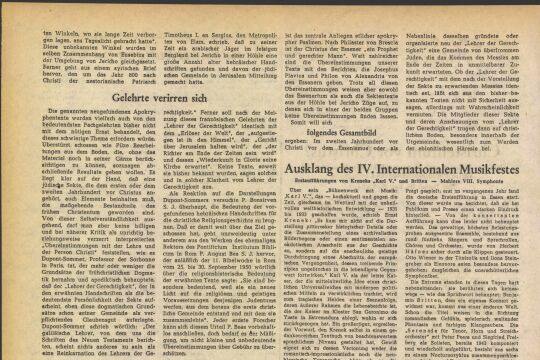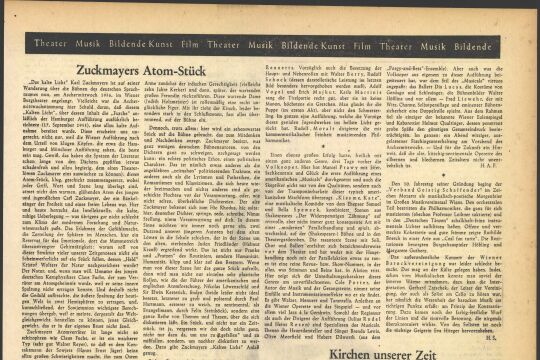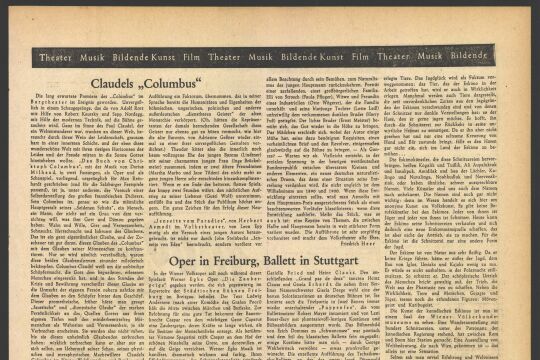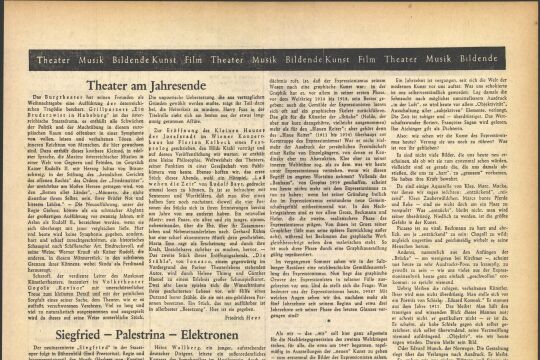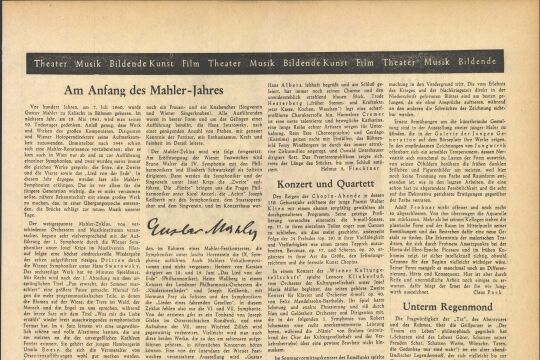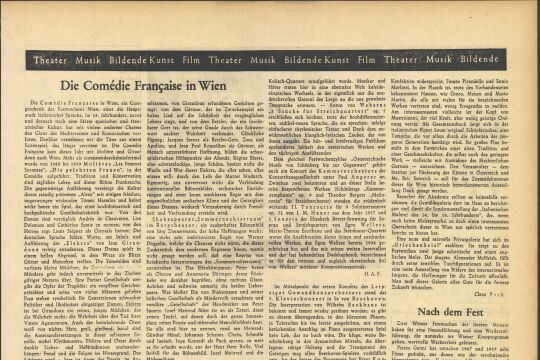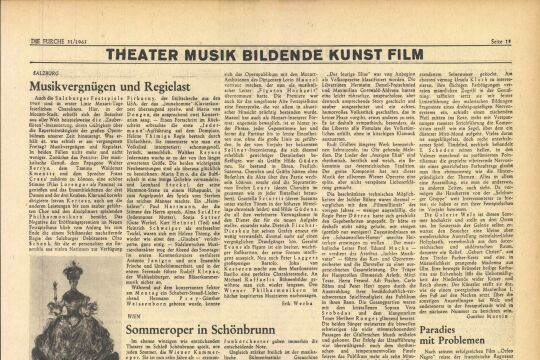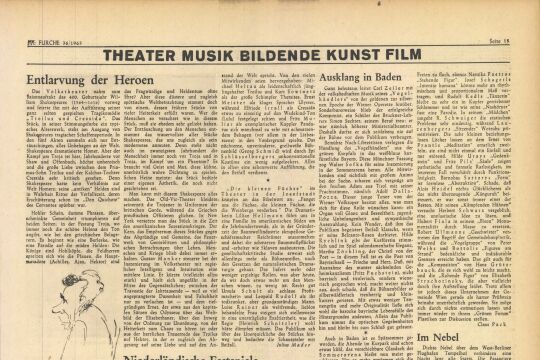Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Berlin erinnert an seine große Zeit
Die Stadt — der Ausdehnung nach mit ihren 46 Kilometern Durchmesser die größte der Welt — ist klein geworden. Wir meinen das „kulturelle“ Berlin mit dem Zentrum Kurfürstendamm, dessen Betrieb und Neonglanz yon dem Mahnmal der zerbombten Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche überragt wird. — Man mag, was hier seit etwa 1950 ausgestellt und dargeboten wird, als Kulturfassade bezeichnen. Aber es ist eine elegante und geschmackvoll-moderne Fassade. Und wieviel Arbeit, wieviel ehrliche Ambition verbirgt sich hinter ihr!
Nirgend in der Welt werden heute vier Wochen lang dauernde Festwochen ausschließlich mit zeitgenössischen Werken bestritten. Auch in Berlin nicht, dessen Theater- und Musikfestival, mit seiner Fülle von Schauspielpremieren, Opern- und Ballettaufführungen, Ausstellungen und Dichterlesungen am ehesten mit den Wiener Festwochen verglichen werden kann. Neben Klassikeraufführungen und bewährten Meisterwerken der Opernliteratut gibt es viel Neues, Zeitgenössisches. Aber die interessantesten Aufführungen scheinen uns jene zu sein, die an die große Zeit des Berliner Kunstlebens anknüpfen: die zwanziger und den Beginn der dreißiger Jahre.
Man eröffnete im Schillertheater mit „D o n Carlos“ in der Inszenierung von Gustav Rudolf Seilner mit Walter Frank, Erich Schellow, Rolf Henniger, Joanna Maria Gorwin und Aglaja Schinid in den Hauptroilen. Am gleichen Abend zeigte die Städtische Oper eine erstklassig-solide Repertoireaufführung von Verdis „O t h e 11 o“, von Richard Kraus temperamentvoll geleitet und von Ita Maxi-mowna mit orginellen, aber infolge der zu geringen Beleuchtung nicht ganz zur Geltung kommenden Bühnenbildern ausgestattet (Regie: Carl Ebert. in den Hauptrollen Elisabeth Grummet, Sieglinde Wagner, Hans Beirer, Tomislav Neralic und Horst Wilhelm). Aber bereits der zweite Abend brachte ein Erlebnis, auf das, man nicht vorbereitet war: Tschaikowskys für antiquiert gehaltenes „Dornröschen“- Ballett bekommt durch die Choreographie Tatjana Gsovskys mit den duftigen, traumschönen Bühnenbildern und Kos'ü-men des jungen Jean-Pierre Ponelle neues Leben. Hervorragende Tänzer, die zu den besten der deutschen Bühnen gehören (Suse Preisser und Gert Reinholm) stehen inmitten eines klassisch geschulten Ensembles, das zwar noch nicht den letzten, aber wohl den vorletzten Schliff hat und das im letzten Bild (einer Tanzparade aller bekannten Märchenfiguren bei der Hochzeit der Prinzessin Aurora) rund einem Dutzend respektabler Einzeltänzer Gelegenheit zur Entfaltung gibt.
„Krieg und Frieden“, nach Tolstois grandiosem Roman, für die Bühne nacherzählt von Alfred Neumann, Erwin Piscator und Guntram Prüfer, erinnert in der pazifstisch-humanitären Tendenz, in der Lehrhaftigkeit des Vortrages und in der Inszenierung Erwin Piscators mit den Bühnenbildern H. W. Lenneweits an das heroische Zeitalter des epischen Theaters mit tieferer politischer Bedeutung. Zufall oder Schicksal, Krieg oder Frieden, der kleine Einzelne mit seinem Menschenschicksal oder die großen gewalttätigen Agierer der Weltgeschichte — das ist hier die Frage. Gespielt wird auf drei Ebenen: einer historischen, zum Hintergrund schräg ansteigend, schraffiert, wie ein Brettspiel, von unten erleuchtet und mit stets wechselnden Projektionen der Aufmarschpläne der großen, todgeweihten Armeen, darauf die großen Akteure: Napoleon, der Zjfr, General Kutusow und die hohen Offiziere. Auf der mittleren Ebene spielt das Schicksal'von Tolstois Romanfiguren; und nach vorn, an die Rampe rechts und links oder auf eine in den Zuschauerraum vorgeschobene Loggia, treten — von einem Sprecher gerufen und eingeführt — einzelne Personen und eröffnen dem Zuhörer ihre Gedanken und Gefühle. — Dazu schrieb Boris Blacher eine sehr sparsame, stark russisch gefärbte Musik für fünf Instrumente, die dem Ideal einer Bühnenmusik insofern nahekommt, als man sie nur hört, wenn man speziell auf sie achtet. — Das breitangelegte Stück, das ein ruhiges und geduldiges Publikum voraussetzt, hat seine Geschichte. Es wurde 1932 von Piscator „für die Deutschen“ geplant und kam damals — zu spät. 1942 inszenierte Piscator das Stück in New York in geschlossener Aufführung „als Nachweis eines anderen Deutschland“; 1952 bis 1955 wurde die vorliegende, stark erweiterte Fassung geschaffen.
Ebenfalls zu spät — und nur an zwei deutschen Bühnen — kam seinerzeit, 1933, das Wintermärchen „Der S i 1 b e r s e e“ von Georg Kaiser mit Musik von Kurt Weill. Soziale Anklage und die Ueberwindung des Hasses im Gnadenakt der Erleuchtung, Menschenwürde und die Verbrüderung des Opfers mit seinem Verfolger — dafür war damals die Zeit vorbei. Weill, dessen Name zu Unrecht ausschließlich an die „Dreigroschenoper“ geheftet ist, erweist sich in den mehr als 20 Musiknummern dieses Stückes (Vor- und Zwischenspiele, Lieder, Chöre und melodramatische Szenen) als ein hochorigineller Komponist, der die verschiedenartigsten Töne sicher und suggestiv zu treffen versteht. Unter der Spielleitung von Hans Lietzau (Bühnenbilder von Lenneweit, am Dirigentenpult Herbert Baumann, in den Hauptpartien die singenden Schauspieler Wilhelm Borehert, Hans Dieter-Zeidler, Berta Drews, Liana Croon und Aribert Wäscher) wurde diese Aufführung zu einer Neuentdeckung einer interessanten Dichtung für Musik — und eine Rehabilitierung des 1950 in den USA verstorbenen Komponisten. Boris Blacher hat die für etwa 32 Instrumente geschriebene und zum erstenmal ungekürzt aufgeführte Partitur mit Geschick auf eine kleine Besetzung reduziert, Wobei allerdings vom sonoren Reiz des Weilischen Orchesterklanges einiges geopfert werden mußte.
Die Idee zu dieser Aufführung ging, ebenso wie die zu dem folgenden E i n a k t e r a b e n.d, den der Verfasser dieses. Berichtes leider nicht mehr sehen konnte, vom umsichtigen und kultivierten Leiter der Berliner Festwochen, Dr. Gerhart von Westtr-m a n aus. „D ie Leistung des deutschen Ostens“ war das Leitmotiv einer Reihe von Veranstaltungen der heurigen Festwochen (Kunstausstellungen, Lesungen, Kulturgespräche, Konzerte und Filmpremieren). Drei deutsche Dichter wurden beauftragt, in je einem Einakter unter dem
Motto „Unterwegs“ das Schicksal der Heimatvertriebenen zu gestalten. „Und will sie durchs Feuer führen“ ist Thema und Titel des 1945 spielenden Kurzdramas von Joachim Tettenborn; „Name unbekannt“ heißt der das Schicksal eines Flüchtlingskindes von 1950 behandelnde Einakter von Karla Höcker: „Die Schleuse“ von Oskar Wuttig schildert Net, Verzweiflung und neue Hoffnung eines Oderkahnschiffers im Berlin von 1955.
Von den vielen Konzerten erwähnen wir nur eine eindrucksvolle Aufführung der „A u f e r s t e h u n g s-symphonie“ von Gustav M a h 1 e r durch das Berliner Philharmonische Orchester, den Kammerchor Waldo Favre und die Solisten Elfriede Trötschel und Lore Fischer unter dem früher in Berlin tätigen Pionier der neuen Musik Fritz S t i e d r y. — Da wir im vergangenen Jahr an dieser Stelle die Choreographin der Berliner Oper, Tatjana G s o v s k y, als Interpretin zeitgenössischer Werke ausführlich gewürdigt und einige ihrer Schöpfungen auch an der Wiener Volksoper gesehen haben, sei ihr Abend mit zeitgenössischen Balletten hier nur erwähnt. Zwischen „Souvenirs“ nach Musik von Offenbach und „Ballade“ von Dohnany wurden zwei kühne zeitgenössische Werke erstaufgeführt: „Signale“ nach Musik von Giselher Klebe und „Labyrinth“, Musik von Klaus Sonnenburg. Die Fülle des Gebotenen, die vielen gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen und der notgedrungen sich nur auf eine Woche erstreckende Aufenthalt des Referenten gestatteten nur einige Streiflichter, die wenigstens die Konturen des Komplexes „Berliner Festwochen“ ableuchten sollten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!