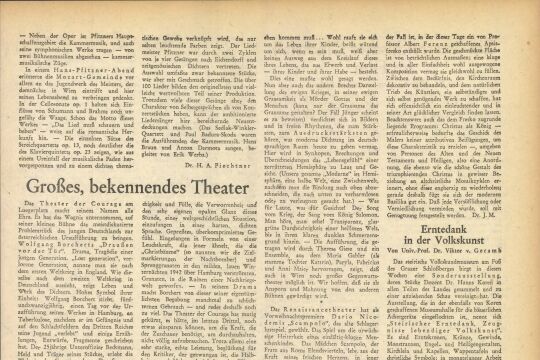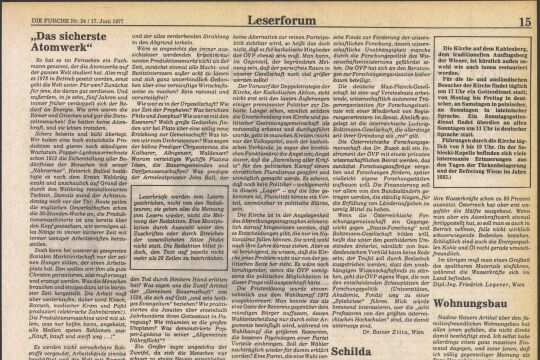Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der mißglückte Aufstand
Das erste Thema in dem letzten Stück von Günther Grass wird recht exakt durch seinen Titel bezeichnet: Die Plebejer proben den Aufstand. Zu sehen auf der Bühne ist eine dramatisch bündige, historisch glaubhafte Darstellung von wichtigen Ereignissen, mehr noch von entscheidenden Stimmungen, Wünschen, Hoffnungen und Enttäuschungen des 17. Juni 1953 in Ost-Berlin.
Leider behandelt Grass noch ein zweites Thema: der Dichter und die Macht; oder, konkreter: Brecht und die DDR. Und da wird sein Stück fad, redselig, hohl. Was bei den Plebejern kräftiger Rhythmus war, wird gestelzter Vers, aus lebensechten Personen werden Bonmotträger und Stichwortbringer.
Förderlich ist zunächst der Ansatz des Stückes. So wie Weiß nicht ein Auschwitzstück schrieb, sondern durch den auf der Bühne direkt wiedergegebenen Prozeß hindurch das Lager sichtbar machte, wie derselbe Autor in seinem Marat nicht die französischen Revolutionäre und ihre Taten auf die Bühne brachte, sondern Schauspieler (noch dazu Insassen einer Irrenanstalt), die diese Revolution nur spielen (wenn auoh innerlich beteiligt), genauso zeigt Grass nicht die Revolutionäre des 17. Juli auf der Stalin-Allee, zeigt er nicht die offiziellen Ansprachen vom Balkon des roten Rathauses herab, sondern läßt eine Arbeiterdelegation vor dem Chef eines Theaters auf der Theaterbühne agieren. Dieser Chef ist mit den Proben zu Shakespeares Corio- lan beschäftigt, er inszeniert einen Aufstand gegen eine römische Tyrannis. Die Arbeiter sind ihm hochwillkommenes Studienobjekt: während sie ihn überzeugen wollen, seine Hilfe bei der Abfassung eines Aufrufes fordern, studiert er ihr Gehaben, um es in künstlerische Wirklichkeit umzusetzen. Diese Begegnung aber ist bei Grass über weite Strecken der ersten beiden Akte hin eine gekonnt ge- handhabte Methode, um eben den Aufstand des 17. Juni einzufangen.
Leider wird Grass bei seinem zweiten Thema direkt. Hier soll wirklich ein Theaterchef vor uns stehen, so soll er sprechen, so soll er proben, so soll er nachdenken, so soll er dichten. Schlimmer noch: nicht irgendein Chef irgendeines Theaters wird uns gezeigt: das Ostberliner Schiffbauerdammtheater mit seinen Rampenlogen ist auf der Bühne aufgebaut, es ist Bertolt Brecht, der sich mit seinen Assistenten, seiner Frau Helene Weigel, seinen Besuchern unterhält. Auch wenn der Name Brecht nie genannt und besagter Theaterleiter immer nur als Chef bezeichnet wird: das ist peinlich, weil der Anspruch der Wirklichkeit niemals auch nur annähernd erreicht wird. Es Wird um so peinlicher, je genauer Brecht charakterisiert wird; wenn der Chef etwa von Gedichten spricht, die er bald schreiben wolle, vielleicht vom Rudern. Grass spart nicht mit seinen Kenntnissen: minu- ten weise läßt sich jedes Chef wort aus Brechts Werken belegen. Aber das wird nicht eine Montage von Brecht-Zitaten (und damit eine künstlerische, eine indirekte Wirklichkeit), sondern wird uns als Alltagsdialog der direkten Realität geboten. Und da der Chef nun auf der Bühne gar nichts zu tun hat, kann er nur reden: er wird, trotz mancher Weisheiten, geschwätzig, fad.
Die Regie von Hansjörg Utherath unterstreicht hier noch: ständig ist der Chef an der Rampe, wird er als Hauptfigur herausgestellt. Zwar war man offensichtlich um „Verfremdung” bemüht: weder läßt sich in Rolf Henniger Brecht, noch in Gisela Mattishent Helene Weigel erkennen: aber weil der Zuschauer sie nun heilt doch kennt, die Weigel noch mehr als den Hausherrn, ergibt das keine künstlerische Distanz, sondern nur ein schreiendes Mißverhältnis, zumal beide nun auch noch einen genauen Realismus spielen, dabei aber niemals eigenes Bühnenleben gewinnen, sondern immer nur aus ihrer Beziehung zur Wirklichkeit Brecht—Weigel interessant werden. Frau Mattishent ist hier noch schlechter dran: während der Chef noch einige Pointen servieren kann, auch schließlich noch große Entscheidung mimen darf, ist sie wie Dramaturg und Regieassistenten zum unprofilierten Stichwortbringer degradiert.
Ungeschickt also die künstlerische Formung, die es mit der direkten Abschilderung versucht — und unbe- wältigt das Thema, das Grass wahrscheinlich auch für sich selbst noch nicht geklärt hat: das Verhältnis vom Dichter zur Macht, vom kommentierenden zum handelnden Wort. So ist das Stück, soweit es Brecht betrifft, eher eine persönliche Skizze als objektive Darstellung. Leider aber beansprucht dieser Chef nun soviel Eigengewicht, daß er im vierten Akt das Stück schließlich allein an sich reißt, wenn er in der direkten Konfrontation mit dem kabarettistisch aufgeputzten Vertreter der Macht, dem Staatsdichter Kosanke-Kuba gezeigt wird. — Dabei könnte man die Brechtsche Ansicht über einen Volksaufstand (wie der Chef sie hier nach Grass ahnen läßt) durchaus verstehen: ein höchst ehrenwerter Versuch, aber zum Scheitern verurteilt, weil zu unklar, ohne Beherrschung der Technik, ohne Wissen um Möglichkeiten und Ziele, allzuleicht ein Spielball werdend, vom Zorn geführt und nicht vom Nachdenken, unrational, wenn auch sehr achtenswert und anziehend. Und auch die Moral ist beherzigenswert: das Heldentum des Nachdenkens ist größer als das des Dreinschlagens. Diese Moral sollte auch wohl in jenem grausig mißglückten dritten Akt gezeigt werden, in dem der „Held” erscheint, der die Fahne vom Brandenburger Tor holte, kommentiert von einer theaterbegeisterten Friseuse: auch da gelingt Grass keine Distanz, er schildert, zwar gebrochen, aber doch direkt das Ereignis und treibt gerade dadurch den Zuschauer in die Distanz der Peinlichkeit.
Inkonsequenz also bei der Klärung des Themas Nr. 2, vor allem aber in der Methode haben das Stück verdorben. Grass scheint das zu wissen: seine nächste Theaterarbeit soll von Stalingrad handeln, spielt aber 20 Jahre nach den Ereignissen auf dem Hof einer deutschen Fabrik, wo ein ehemaliger General in einer Stalingrad-Attrappe hartnäckig und verzweifelt mit fiktiven Soldaten die Schlacht immer aufs neue durchspielt. Hier scheint alles konsequent auf die indirekte Darstellung angelegt; von der realen Schlacht bleibt das Publikum verschont — um so besser kann es darüber nachdenken.
Von der Presse wurden die Plebejer zumeist verrissen; das Publikum strömt inzwischen hinzu. Beide haben recht: das Stück ist schlecht, aber man muß es spielen, sehen und darüber sprechen (Das Wiener Burgtheater hat es für die nächsten Wochen angekündigt).
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!