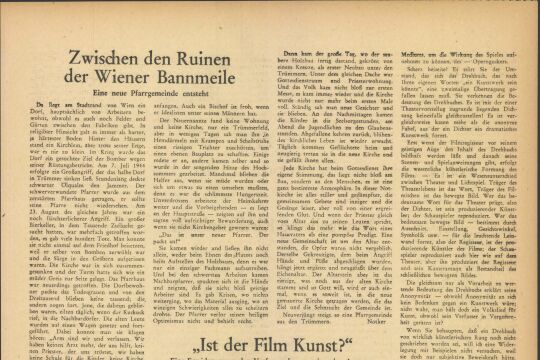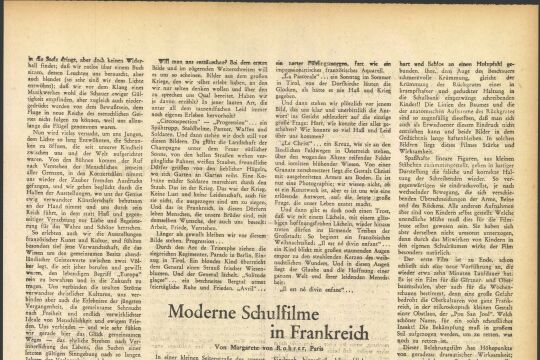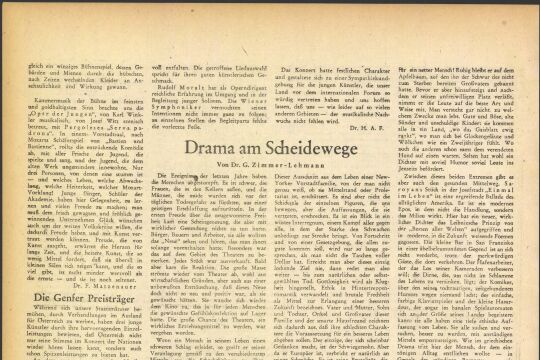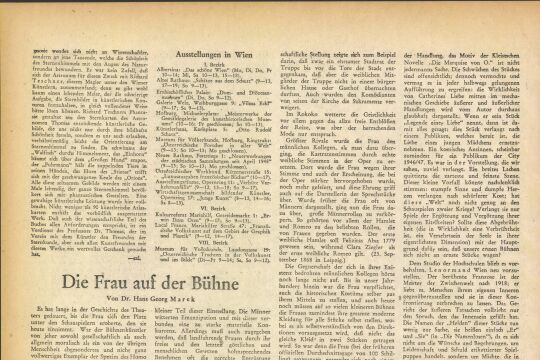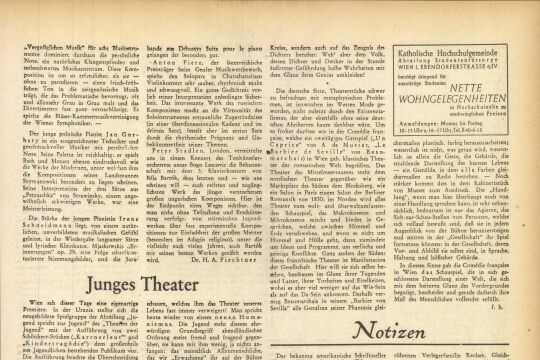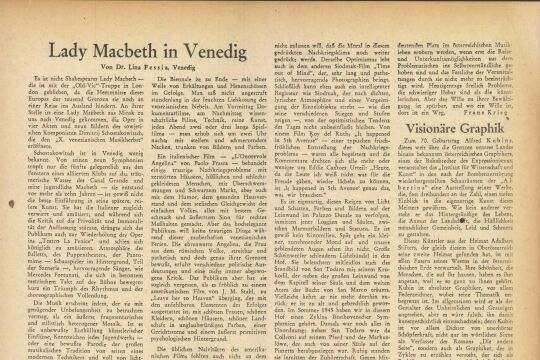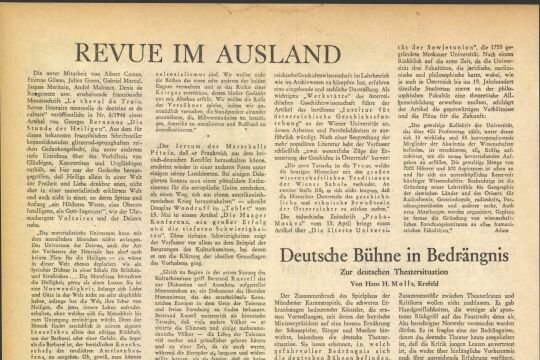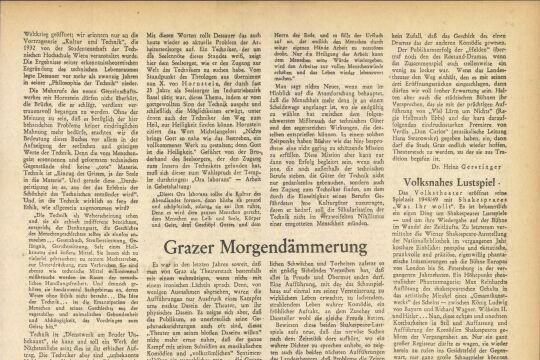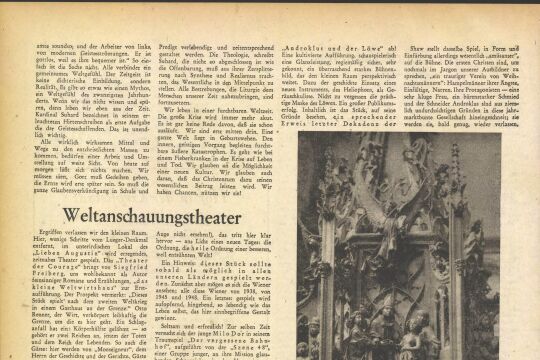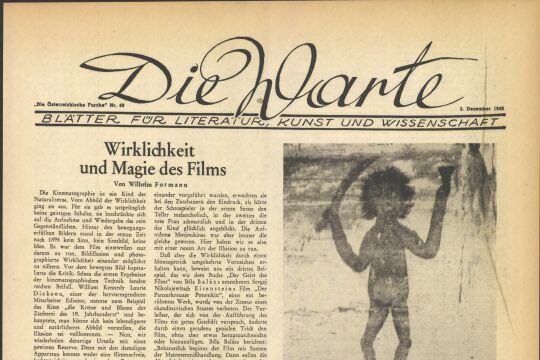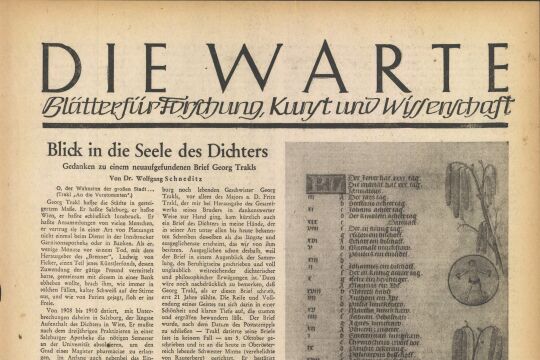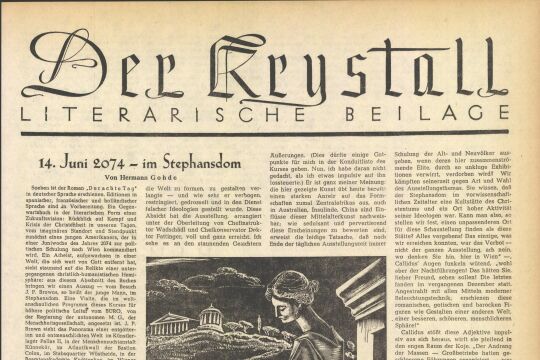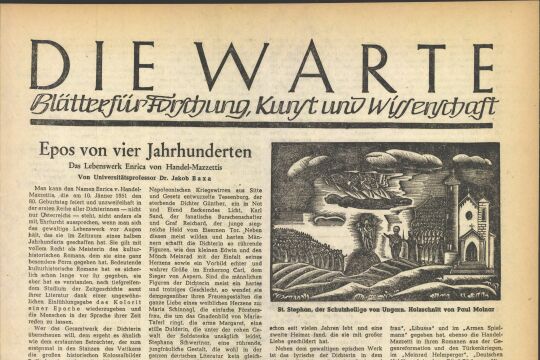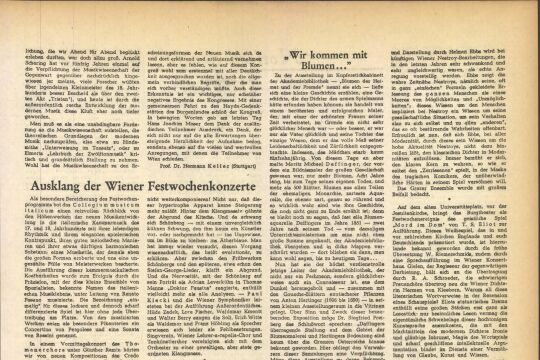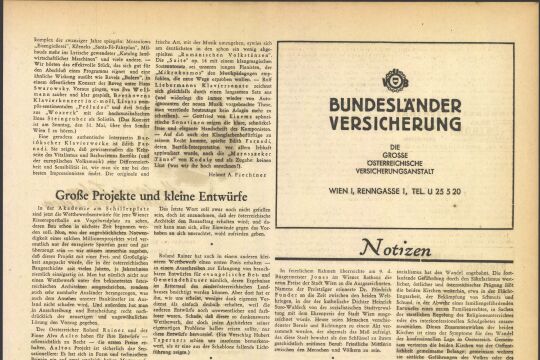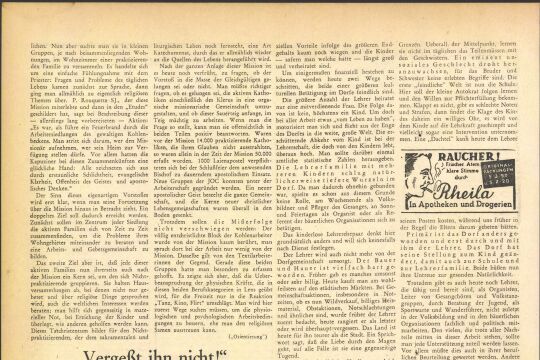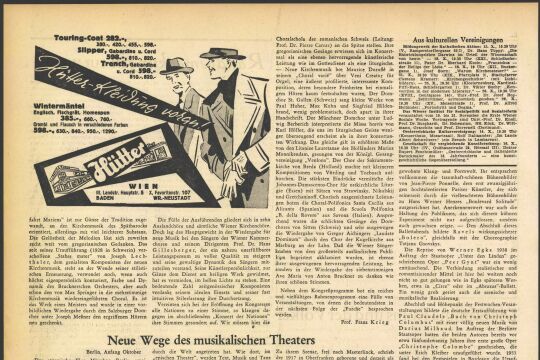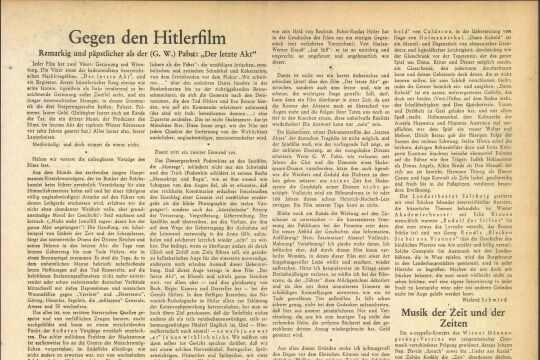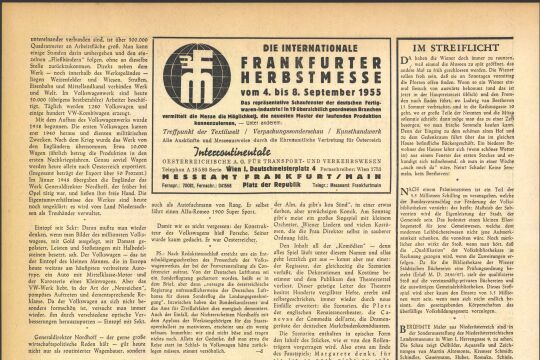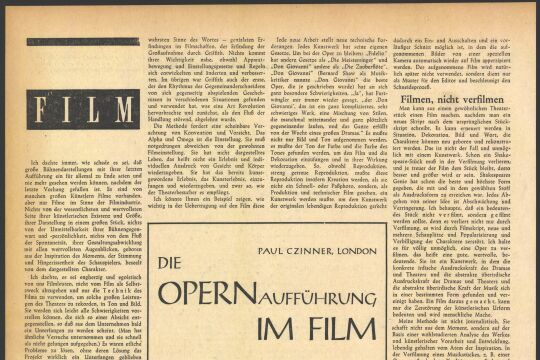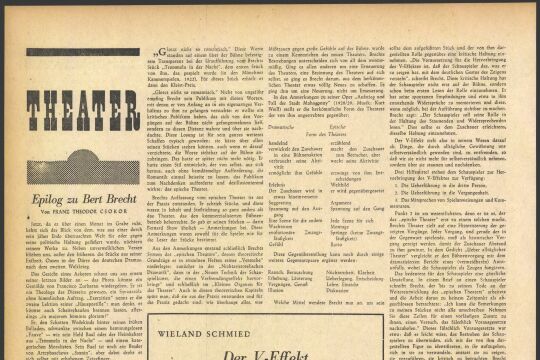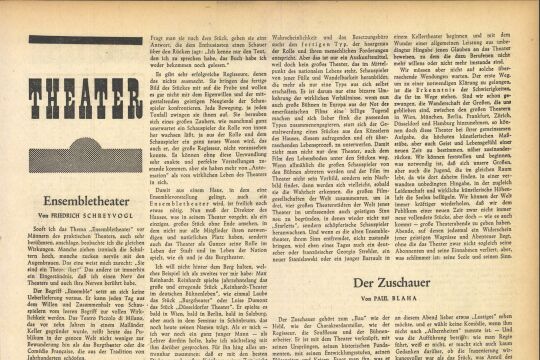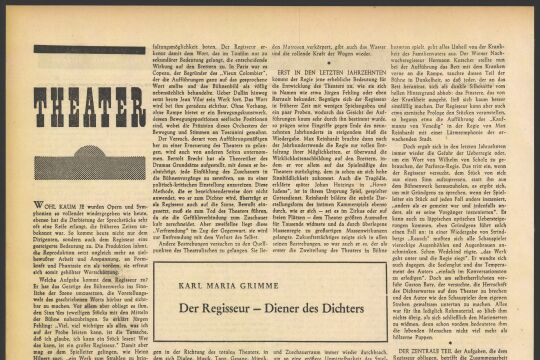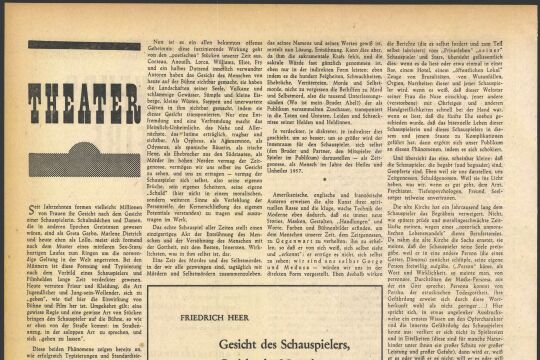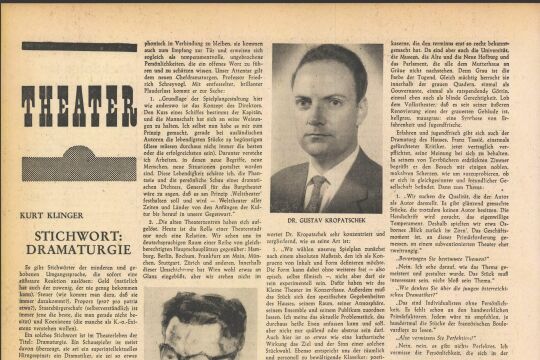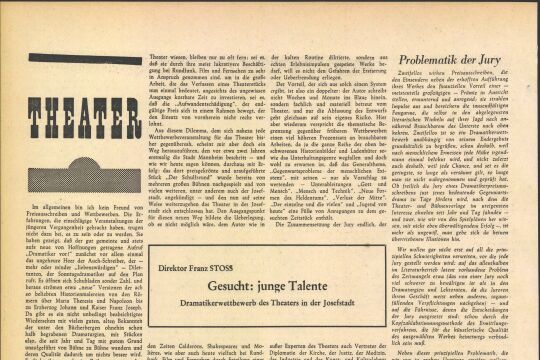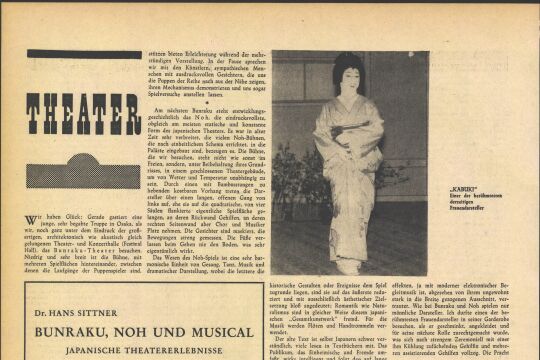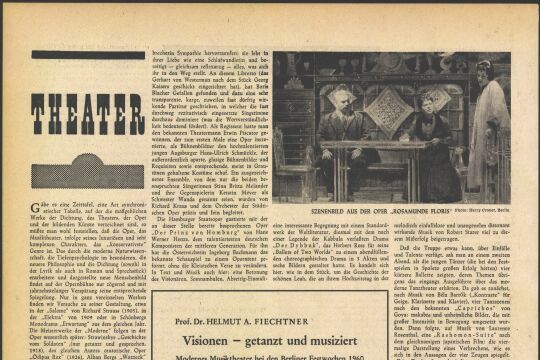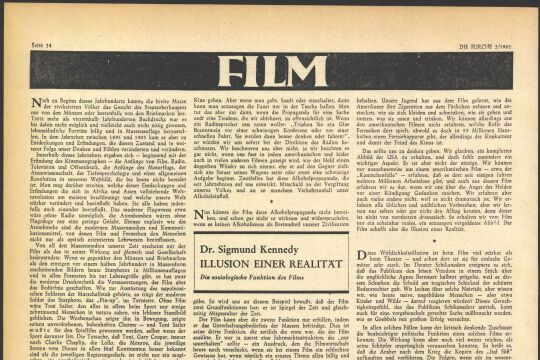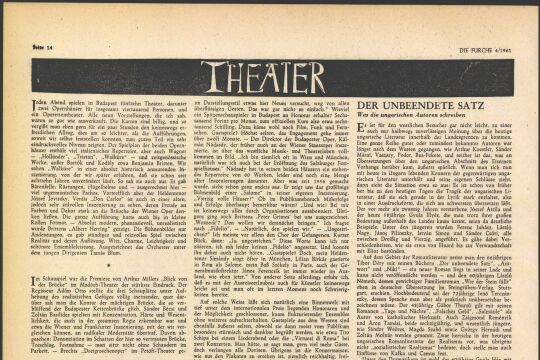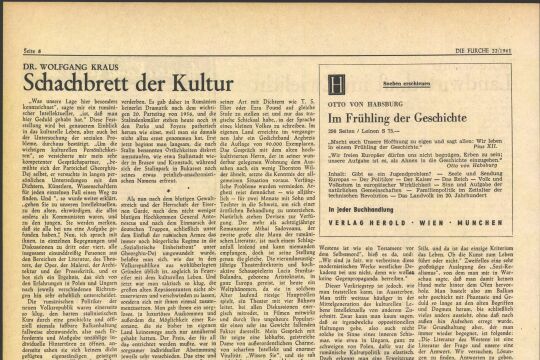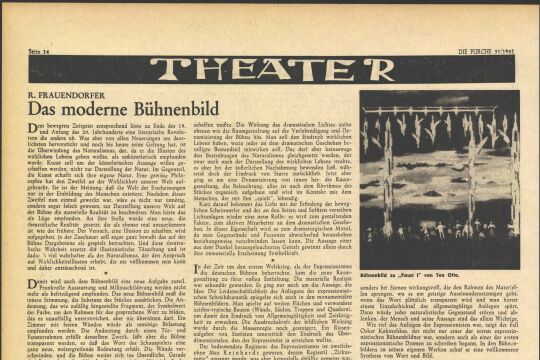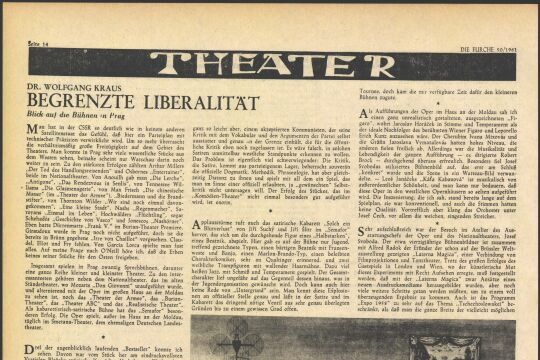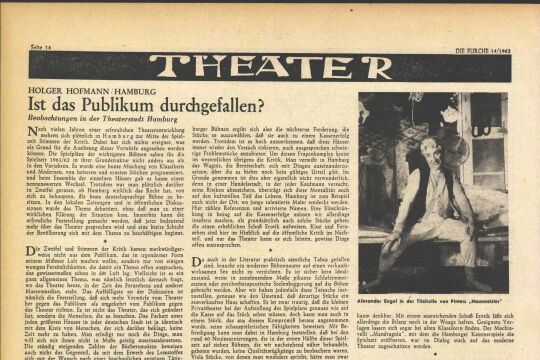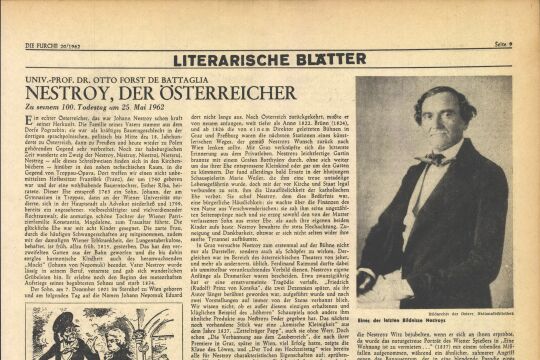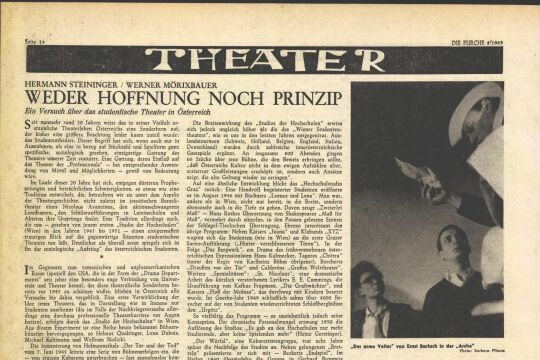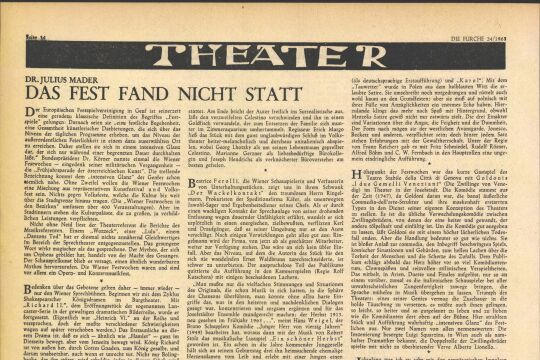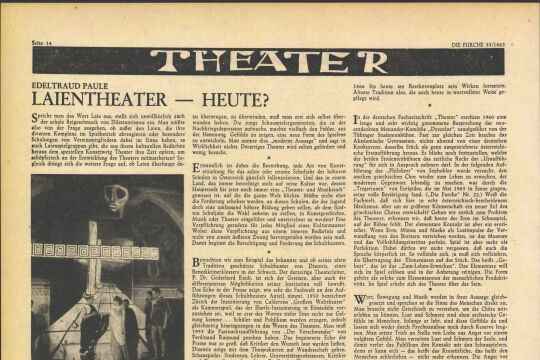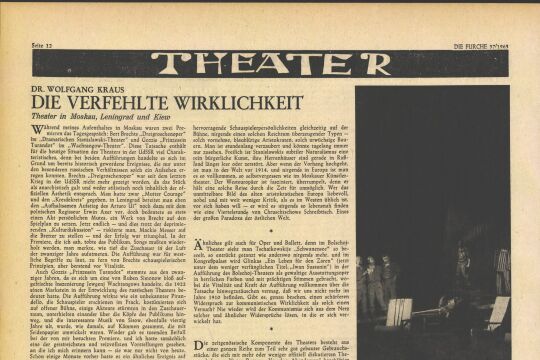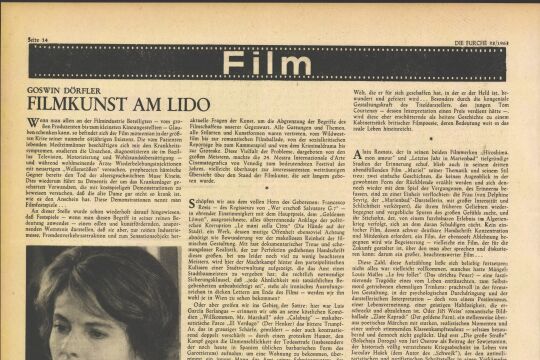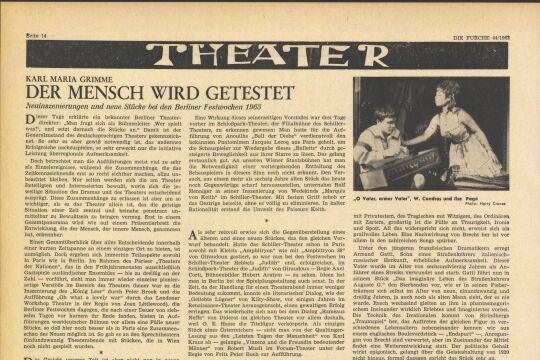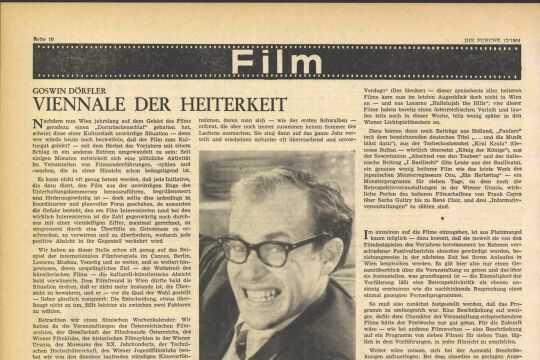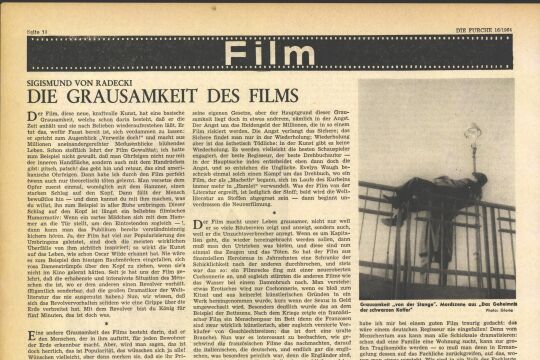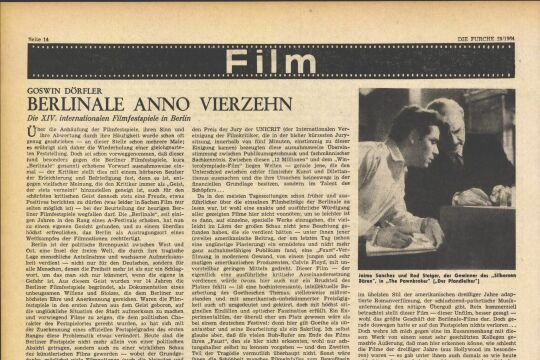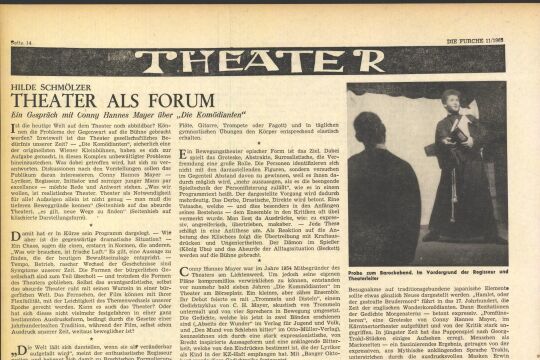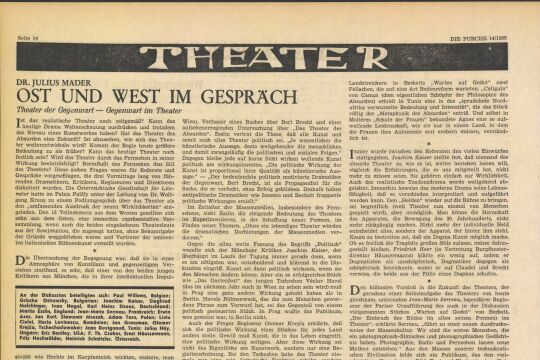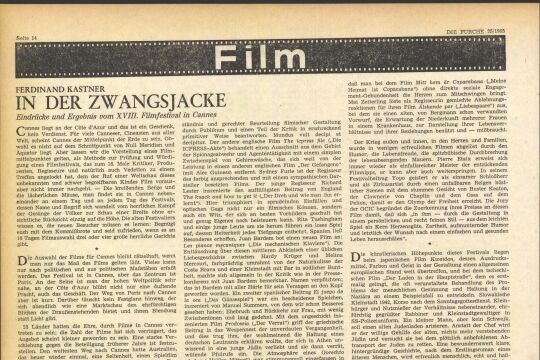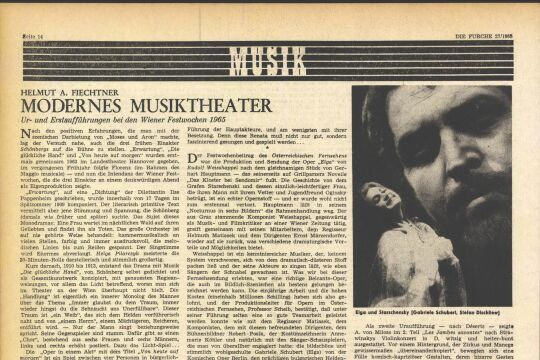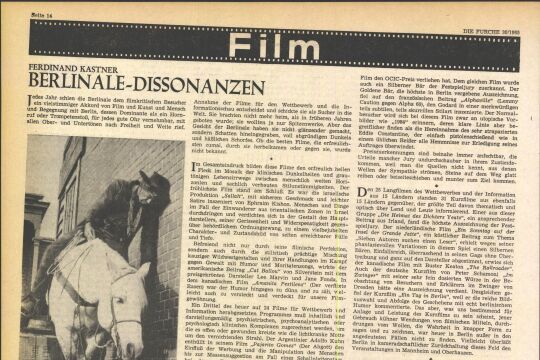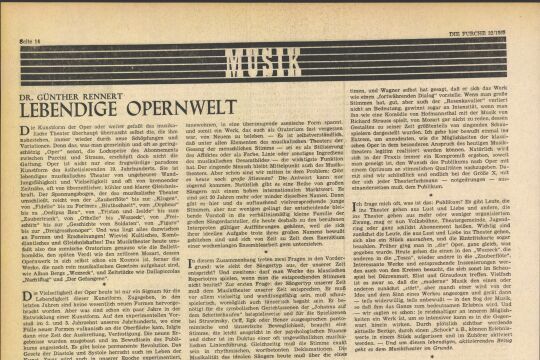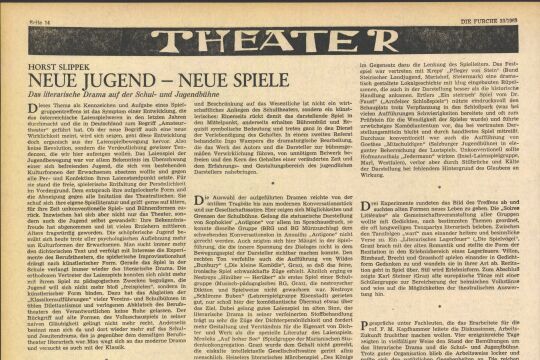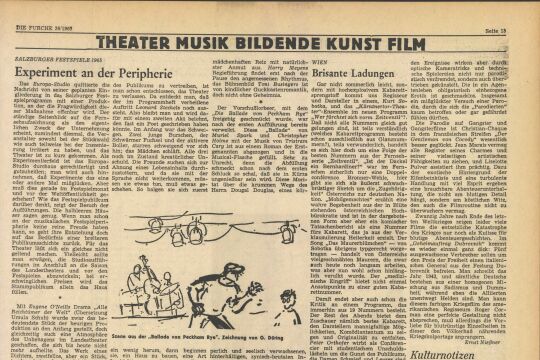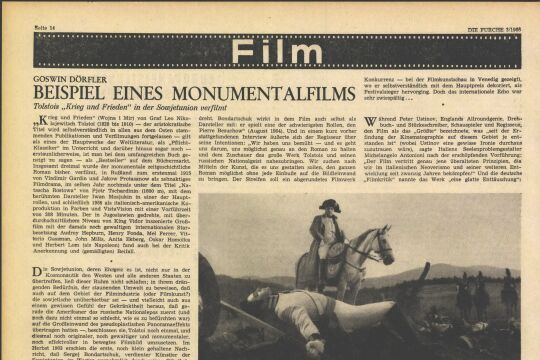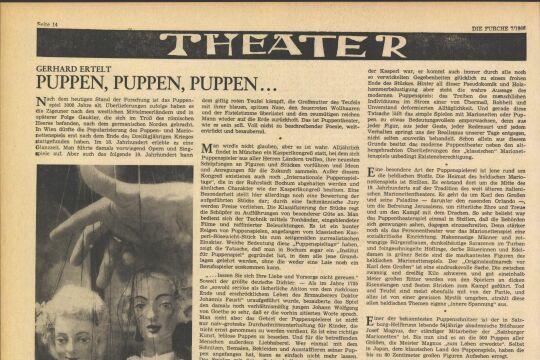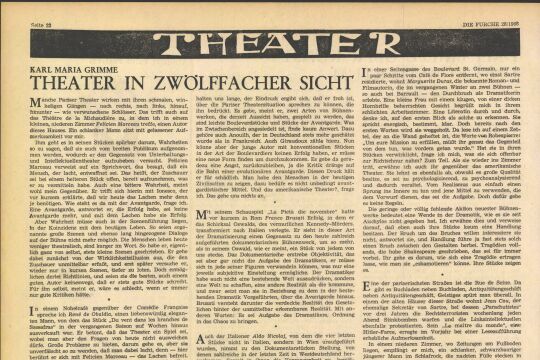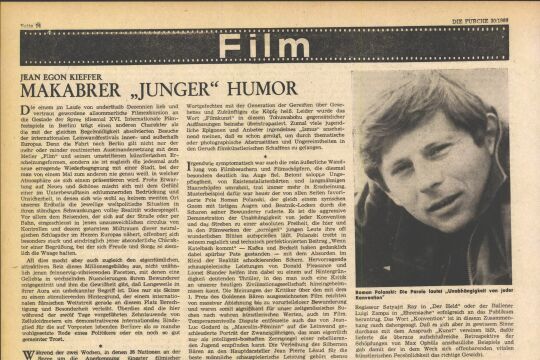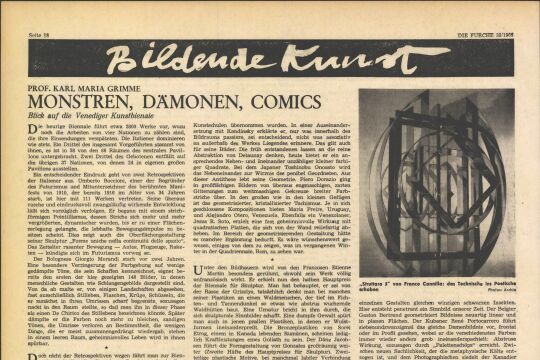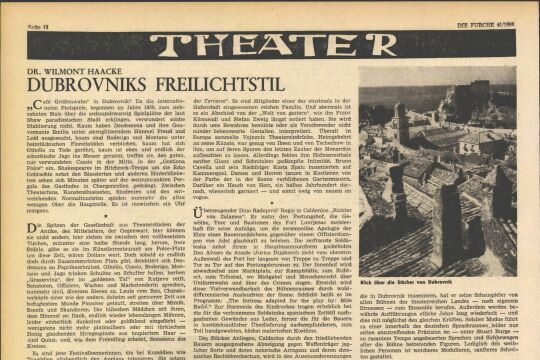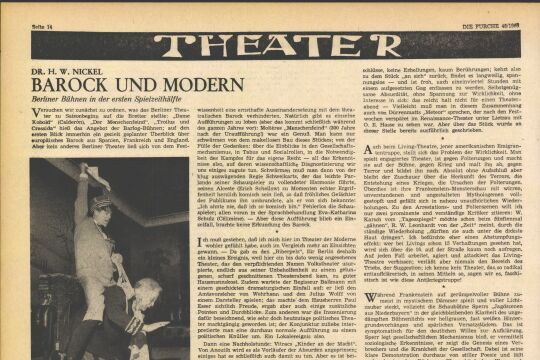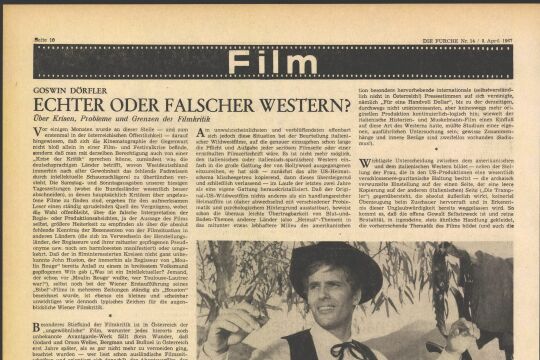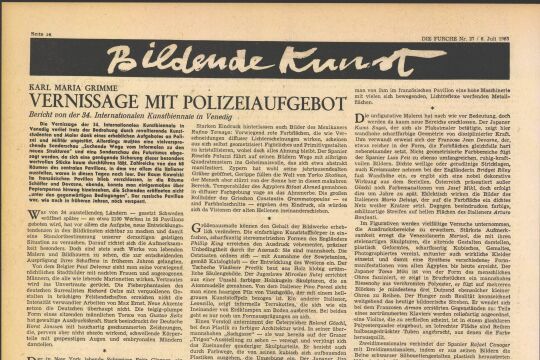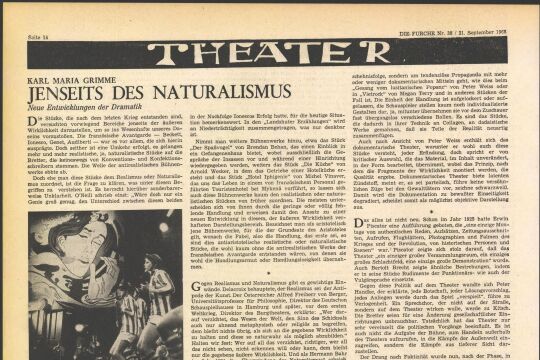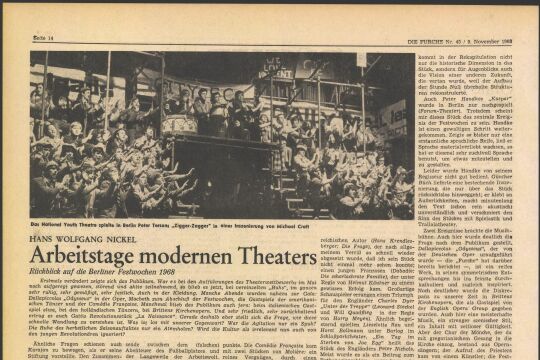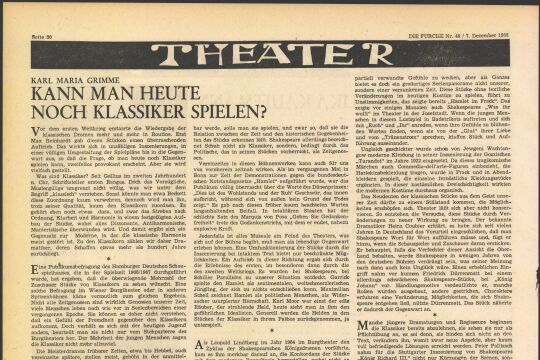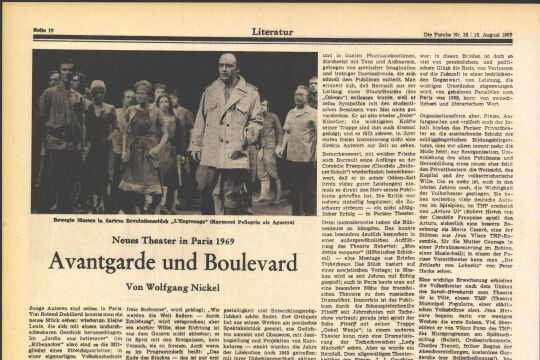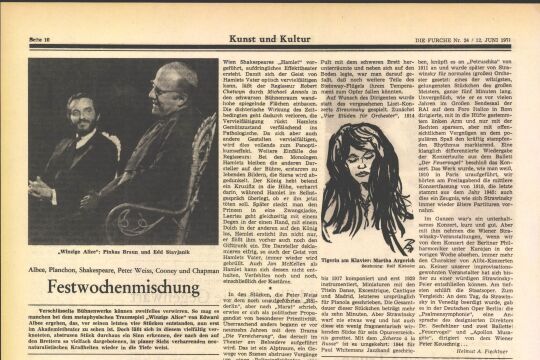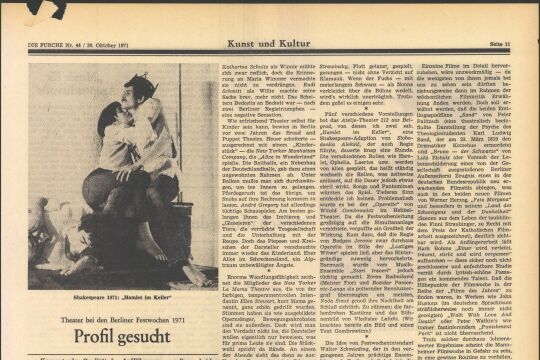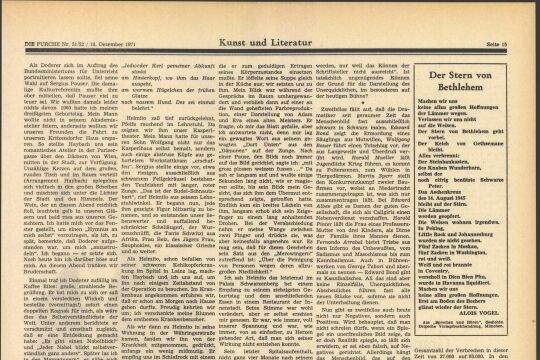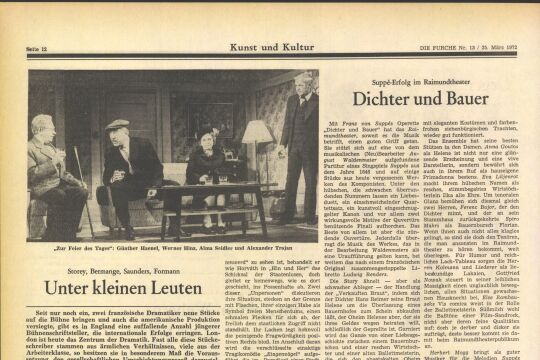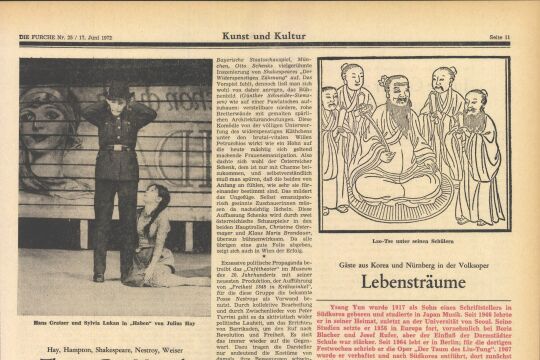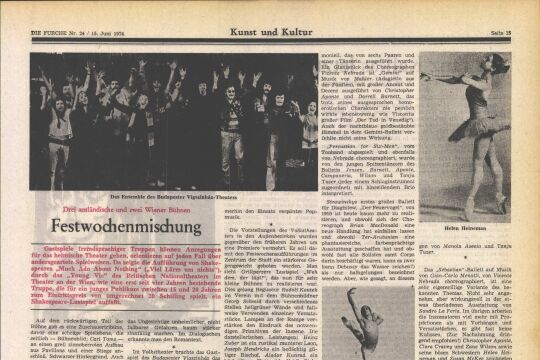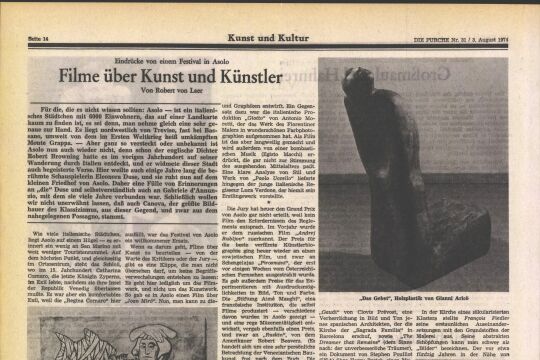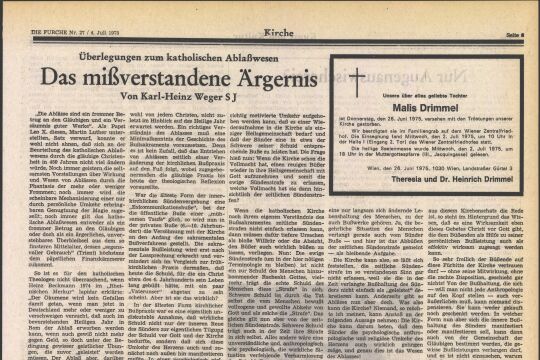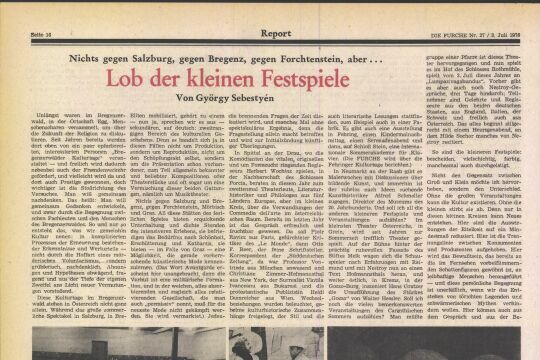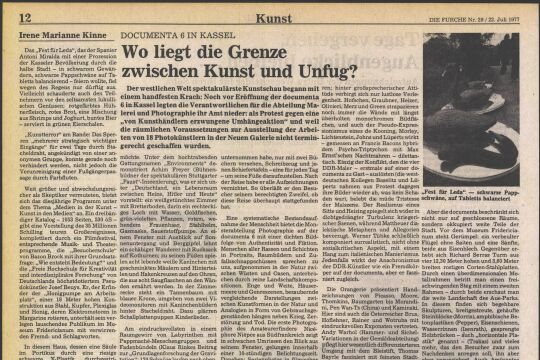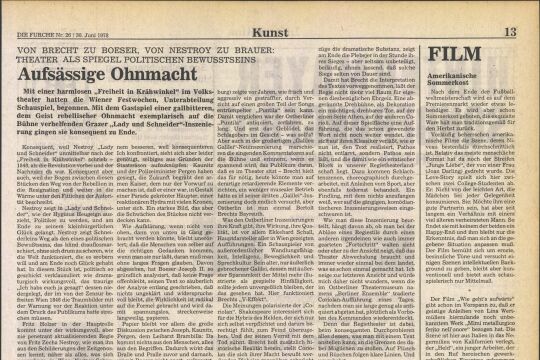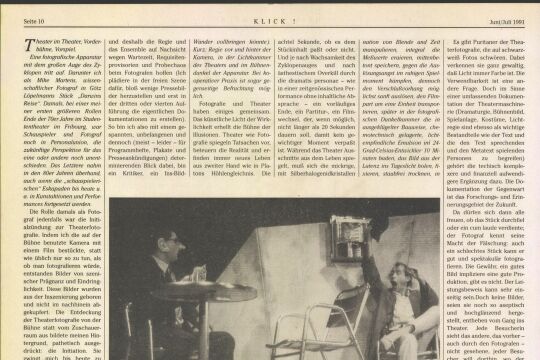Episch-Episodenhaftes
Zum Start unter ihrem neuen künstlerischen Leiter Christophe Slagmuylder bieten die Wiener Festwochen schwere Kost: „Diamante“ von Mariano Pensotti und „3 Episodes of Life“ von Markus Öhrn.
Zum Start unter ihrem neuen künstlerischen Leiter Christophe Slagmuylder bieten die Wiener Festwochen schwere Kost: „Diamante“ von Mariano Pensotti und „3 Episodes of Life“ von Markus Öhrn.
Die Eröffnungsproduktion war mit Bedacht gewählt. Zum einen fand „Diamante“, die erste von insgesamt 45 Produktionen, mit der Halle 3 der Erste Bank Arena in Wien-Donaustadt an einem von den Festwochen bisher nicht berücksichtigten Spielort statt. Zum anderen ist das Stück, das der argentinische Theatermacher im letzten Jahr für die Ruhrtriennale entwickelt hat, auf mehreren Ebenen ungewöhnlich. Nicht so sehr was die epische Länge von fast sechs Stunden angeht (da ist man bei den Festwochen aus der Vergangenheit doch einiges gewohnt, Stichwort Castorf), sondern vielmehr was das szenische Set, die Anzahl der Darsteller und vor allem die Narration der Geschichte betrifft. Denn Mariano Pensotti und seine Mitstreiter der „Grupo Marea“ haben in die 1.300 Quadratmeter große Halle ein kleines Dorf gebaut, bestehend aus zehn kleinen Häuschen, einem Festplatz sowie einem etwas abseits am Eingang zur fiktiven Stadt namens Diamante geparkten Auto. An diesen Spielorten laufen die Szenen parallel ab. Die Zuschauer verpassen dadurch aber nichts. Denn die exakt achteinhalb Minuten dauernden Szenen werden immer wiederholt, so dass jeder Zuschauer die Möglichkeit hat, jede Episode in beliebiger Reihenfolge durch die Fensterfronten der detailverliebt eingerichteten Häuser zu beobachten und die Erzählstränge individuell zusammenzuführen. Tatsächlich fügen sich die kleinen, fein aufeinander abgestimmten Episoden aus dem Leben der Bewohner, einem Puzzle ähnlich, allmählich zu einem Gesamtbild.
Vom Miteinander zum Gegeneinander
In drei Teilen erzählt Pensotti eine Verfallsgeschichte. Vor hundert Jahren wurde die Stadt von einem deutschen Unternehmer am Rande des Dschungels im Norden Argentiniens gegründet. Alle Einwohner der nach außen abgeschirmten Retortenstadt sind Angestellte bei der Firma „Goodwind“, einem einstigen Öl- und Schwerindustrieunternehmen und gegenwärtigen Softwareentwickler. Die Löhne waren besser als im Durchschnitt und es gab soziale Ideen. So sollte jeder Einwohner ein Instrument spielen und regelmäßig miteinander musiziert werden. Aber die soziale Musterstadt hat Risse bekommen, die Harmonie von einst scheint verflogen. So manch eine Biografie ist anders verlaufen als geplant, Ehen zerbrechen, berufliche Träume platzen, Vorstellungen vom Leben entwickeln sich auseinander und durch härtere wirtschaftliche Bedingungen und neoliberale Ideen wird aus dem solidarischen Miteinander ganz allmählich ein Gegeneinander, das schließlich umschlägt in Flucht, Drogenexzesse, Intrigen, Verrohung, Hass und Gewalt.
„ Öhrn lenkt die Aufmerksamkeit auf die strukturellen Bedingungen der Gewalt und bringt nicht zuletzt den Kunstbetrachter dazu, seine Rolle zu reflektieren. “
Anfänglich macht es Spaß, sich zusammenzureimen, wie die Figuren zueinander stehen, und aus all diesen Mikrogeschichten schließlich den Gesellschaftswandel zu konstruieren. Aber sehr schnell wird es sehr mühsam. Das liegt an einer eigentümlichen Schwäche von Pensottis Konzept: Um die epische Tiefe zu erlangen, werden auf die Schaufensteroberflächen Texte eines allwissenden Erzählers projiziert. Eine Menge Text: Geschichten, Gedanken und Gefühle der Figuren, Kommentare und theoretische Exkurse. So ist der Betrachter vor allem mit Lesen beschäftigt, was so viel Aufmerksamkeit von den hinter Glas spielenden Darstellerinnen und Darstellern abzieht, dass die einem bald so lebendig vorkommen wie Schaufensterpuppen. Der Mehrwert des Theaters, der lebendige Schauspieler, wird unterlaufen.
Drastik und Überzeichnung
Der schwedische Künstler Markus Öhrn verzichtet bei seinem „Silent Movie Theatre“ auf Darsteller auf der Bühne. In „3 Episodes of Life“ zeigt er an drei aufeinander folgenden und aufbauenden Abenden im Studio Molière jeweils einen Stummfilm, begleitet durch die schaurig-schöne Musik von Dorit Chrysler am Theremin und Arno Waschk am Klavier. Was Öhrn bei den letzten Festwochen mit „Häusliche Gewalt Wien“ angefangen hat (wofür er einen „Nestroy“ erhielt), dehnt er nun auf das Feld der Kunst aus. Es geht um Machtmissbrauch und Gewalt, darum, dass wer Macht hat, Menschen manipulieren und sie dazu bringen kann, Grenzen zu überschreiten, die sie eigentlich nicht überschreiten wollen. Und Öhrn tut das auf drastische Weise. Am ersten Abend eine Probenszene: Vier Tänzerinnen mit Pappmaché-Köpfen werden vom beobachtenden, von sich selbst ergriffenen Künstler angewiesen, sich zu verrenken und zu räkeln, während die Kamera ihre Körper abtastet bis in die intimsten Öffnungen. Dann der Zwischentitel: „Fickt den Boden. Fickt ihn! Fickt!“ Im Namen der Kunst werden Tabus gebrochen, beginnt sich die Spirale des Obszönen zu drehen. Bald sind alle vier nackt, beschmieren sich mit Sperma („Quelle der Schöpfung“), Kot („Was die Erde nährt“) und Menstruationsblut („Der Saft von Leben und Tod“). Mit der Drastik und der Überzeichnung lenkt Öhrn die Aufmerksamkeit auf die strukturellen Bedingungen der Gewalt und bringt nicht zuletzt den Kunstbetrachter dazu, seine Rolle zu reflektieren. Der Gedanke an die Fortsetzung macht einem Bange.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!