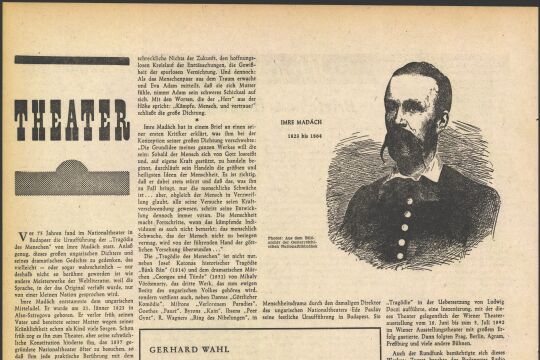Fehlende Augenblickswirkung
Intendant Martin Kušej inszeniert als seine erste hauseigene Arbeit am Burgtheater Heinrich von Kleists selten gespielte „Hermannsschlacht“ – allerdings ohne rechte Überzeugung.
Intendant Martin Kušej inszeniert als seine erste hauseigene Arbeit am Burgtheater Heinrich von Kleists selten gespielte „Hermannsschlacht“ – allerdings ohne rechte Überzeugung.
Am 1. Januar 1809, dem Tag, an dem Kleist das Manuskript der „Hermannsschlacht“ hoffnungsvoll nach Wien schickt, schreibt er seinem Förderer, dem damaligen preußischen Finanzminister Karl von Stein zum Altenstein, er wolle von nun an lauter Werke schreiben, die „in die Mitte der Zeit hineinfallen“. Das Stück verstand der Autor dabei schon als eine solche operative Dichtung, in der er „die großen politischen Linien der Zeit aufzudecken […] und den Zeitgenossen zu Bewusstsein zu bringen“ gedachte. Das Stück um die Schlacht im Teutoburger Wald, in der der germanische Anführer Hermann sich kompromisslos jeder humanen Besonnenheit entledigt und mit Methoden des totalen Krieges die Römer besiegt, konnte als verdeckte Agitation gegen die Franzosen verstanden werden. Deutschland sollte dem Beispiel Spaniens folgen und sich ebenfalls gegen die napoleonische Fremdherrschaft erheben. Die Hermannsschlacht fand ihren Weg auf die Bühne zu Lebzeiten des Dichters allerdings nicht, und es sollten bis zur Uraufführung noch einmal fünfzig Jahre verstreichen. Nicht nur wegen seiner unsäglichen Instrumentalisierung durch die Nationalsozialisten hat so mancher Leser wie Thomas Mann bei der Lektüre „erschrocken die Fühler“ eingezogen. Das Stück galt schlicht als unspielbar.
Nach der Premiere am Burgtheater, mit der Martin Kušej seine erste hauseigene Arbeit vorlegt, sieht man sich darin eher bestätigt und man fragt sich, auf welche Augenblickswirkung es der Hausherr denn angelegt hat. Es ist indessen kaum möglich, darauf eine Antwort zu finden. Auf der von Martin Zehetgruber entworfenen Bühne ist es meist dunkel und neblig. Auf den mächtigen Panzersperren, die sowohl an unwegsames waldiges Gelände wie an Krieg erinnern lassen, versammeln sich die fünfzehn langhaarigen germanischen Stammesfürsten am offenen Feuer oder jagen mit Pfeil und Bogen. Oder aber es irrt der römische Feldherr Varus (Falk Rockstroh im Anzug) verloren umher, bevor er wie Wild erlegt wird. Auch wenn es drastische Szenen gibt, wirkt das alles wenig inspiriert und ohne eigentliche Idee. Vielleicht ist es zu abwegig, aber gleichwohl kann man sich des Eindrucks nicht ganz erwehren, Kušej wandere auf Claus Peymanns Spuren, der 1986 seine dreizehn Jahre währende Intendanz just mit diesem Stück eröffnet hat.
Obwohl auch damals ausgiebig erörtert wurde, ob es für das skandalträchtige Stück überhaupt einen Weg auf die zeitgenössischen Bühnen gebe, wurde die Inszenierung mit Gert Voss und Kirsten Dene in den Hauptrollen legendär. Das lag vor allem auch daran, dass Peymann die Ambivalenz und Vielschichtigkeit herausgearbeitet hat. Er inszenierte die „Hermannsschlacht“ nicht als einen Krieg, der Identität stiftet. Es konnte schon gelesen werden als Modell für einen anti-imperialistischen Befreiungskampf, als Mobilisierung zu einer Revolution in einem asymmetrischen Krieg gegen einen übermächtigen Gegner. Was Peymanns Zugriff aber so speziell gemacht hatte, war, dass er das Stück gleichzeitig als Ehe-Drama inszenierte, in dem ein spießiger Familienvater zum totalen Krieger wird. Und er denunzierte das als Wunschtraum eines Biedermanns „des sich Blähens ins überdimensionale Alles-Können“, wie Peymann das beschrieben hat.
Bestialischer Hass
In Kušejs Inszenierung ist Hermann weniger komplex als ganz einfach als finstere Gestalt angelegt. Markus Scheumann spielt ihn emotionslos, glatt, als kalten Ideologen, ein intellektueller Scharfmacher mit leicht sadistischen Neigungen, ein Schreibtischtäter, der selbst nicht handelt. Seinen bis zur Bestialität hochgetriebenen Hass befeuert er mit Worten, die täuschen und lügen, mit dem Zweck, dass andere handeln: „Nur reden will ich Dolche, keine brauchen.“ Aber das Handeln im Großen geht nicht ohne Verluste im Privaten. Die Szenen mit Bibiana Beglau als willfähriger Thusnelda gehören denn auch noch zu den gelungensten des Abends. Auf einem Karussell mit weißen Pferdchen überzeugt Hermann seine Frau, die er beständig verkleinert und im Diminutiv als „Thuschen“ anspricht, von der Notwendigkeit des absoluten Kampfes. Er erzählt ihr, dass die Römer nur ins Land gekommen seien um sie, die blonde Germanin, ihrer Haare zu berauben, für die Perücken der römischen Damen. Aber ihre Instrumentalisierung hat ihren Preis. Die Ehe wird zerstört sein und die einfältige Seele Thusneldas unwiederbringlichen Schaden nehmen. Nach ihrer schrecklichen Rachetat an Ventidius, sie hat ihn einem Bären zum Fraß vorgeworfen, ist sie verwirrt und stumm: „Verhaßt ist Alles, / Die Welt mir, Du mir, ich. Laß mich allein.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!