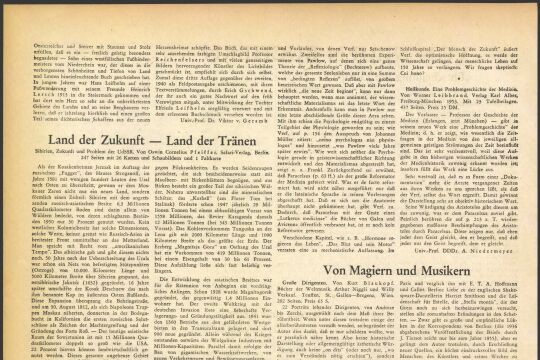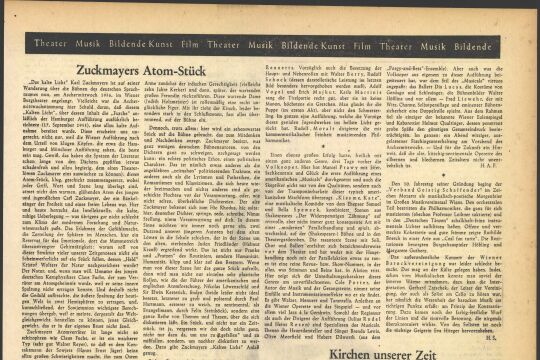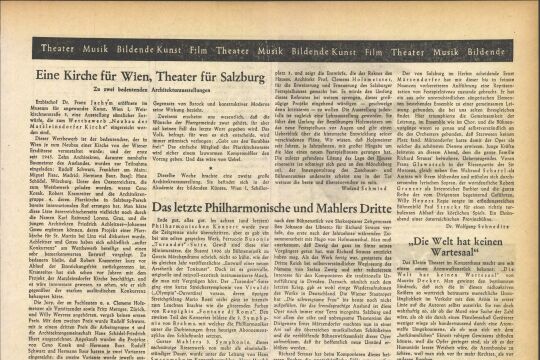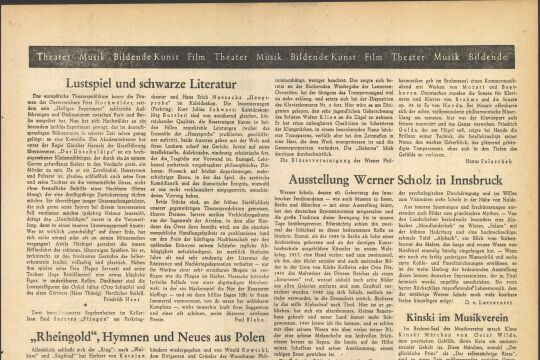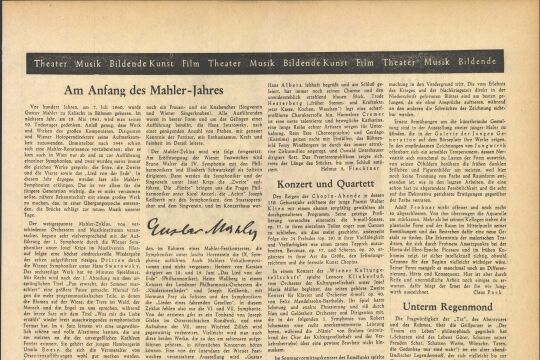Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Julietta” und „Die schweigsame Frau”
Heimo Erbse, Jahrgang 1924, ist kein Neuling auf dem Theater. Er war Opernregisseur an mitteldeutschen Bühnen, Hauskomponist des Theaters am Kurfürstendamm und ist der Autor der bei den Berliner Festwochen 1952 uraufgeführten Kammeroper „Fabel in C” sowie des an der Wiener Staatsoper zum erstenmal gezeigten Balletts „Ruth”. — Trotz dieser bedeutenden Theaterpraxis ist es erstaunlich, mit welcher Geschicklichkeit Erbse die unlösbar scheinende Aufgabe, aus Kleists klassischer Meisternovelle „Die Marquise von O.” ein Operntextbuch zu formen, gelöst hat. — Der heikle Stoff — eine unbewußte Empfängnis und die sich daraus ergebenden Komplikationen — ist mit Dezenz behandelt. Auch das muß dem Textautor Erbse zugestanden werden. (Die betreffende Szene ist durch eine Ballettpantomime angedeutet.) Auch dafür, daß er parodische und persiflierende Elemente eingeführt hat, könnte er gute Gründe anführen (es gibt Äeußerungen Kleists in dieser Richtung, die freilich nicht leicht zu interpretieren sind). Von dieser „Verfremdung” bleiben Julietta, der Vater ihres Kindes (bei Erbse: Graf Freiherr von Falkenberg) und Juliettas Mutter unberührt. Vater und Bruder werden stark ironisiert, die Randfiguren (mit Ausnahme des Arztes) sind bereits komische Typen, während die Chöre der Sippe und der Diener die realistisch-sarkastische Gegenwelt zu dem merkwürdigen romantischen Elternpaar Verkörpern. Erbse hat die Handlung in 33 Kurzszenen gegliedert, denen 33 Musiknummern (nebst zwei Zwischenspielen) entsprechen. Hiervon sind 15 Szenen für Ensemble oder Chor gesetzt. Das ist — in der löblichen Absicht, eine richtige Sängeroper zu schreiben — zuviel des Guten und ermüdet, obwohl die Singstimmen gut geführt und die Chöre meisterhaft gesetzt sind. Die Manier der allzuhäufigen Tonwiederholung kommt wahrscheinlich aus der Blacher-Schule, die Erbse anderseits durch allzu dick aufgetragene Farben und minutenlanges Lärmen verleugnet. Auf weite Strecken ist Erbses Musik rein tonal und, wo es um die Zeichnung des spießbürgerlichen Milieus geht, auch banal. Dann geht es aber, ohne Uebergang, plötzlich wieder sehr dissonant zu, ohne daß man genau wüßte, weshalb (dabei ist Heimo Erbse ja kein Vertreter der Dodekaphonik, wo es diese Unterscheidungen praktisch nicht gibt). Kurz: der Personalstil des jungen Komponisten ist, zumindest was seine Harmonik betrifft, nicht eindeutig ausgeprägt. Dafür versteht er, Kontraste zu schaffen und ganze Szenen hindurch auch fesselnd zu unterhalten. In Oskar W a e 11 e r 1 i n als Spielleiter, Caspar N e h e r als Bühnenbildner, Yvonne Georgi als Choreographin und Antal Dorati als Dirigenten hatte er jedenfalls ausgezeichnete Helfer, die aus dem Libretto und der Partitur ein Maximum an Effekt herausholten. Erstklassig war auch die Besetzung sämtlicher Haupt- und Nebenrollen sowie die Leistung des Chores. Die Leistungen von Rita Streich in der schwierigen, koloraturreichen Titelrolle und von Walter Berry, der als heftiger und zugleich dumpfer Obristlieutenant einer feindlichen Streitmacht auch darstellerisch hervorragend war, sind besonders hervorzuheben. (In den übrigen Partien: Rudolf Knoll, Sieglinde Wagner, Gerhard Stolze, Alois Pernerstorfer, Elisabeth Höngen, Erich Majkut und Alfred Jerger.) Das Premierenpublikum hat alle Ausführenden, nicht zuletzt das Orchester der Philharmoniker sowie Chor und Ballett der Wiener Staatsoper, lebhaft gefeiert.
Die Leidensgeschichte der Oper „Die schweigsame Frau” haben wir anläßlich der Besprechung des Briefwechsels zwischen Richard Strauss und seinem Librettisten Stefan Zweig in der „Furche” vom 10. Jänner 1959 erzählt. (Wer dieses groteske Kapitel deutscher Kulturgeschichte genau kennenlernen will, dem sei die Lektüre dieser im S.-Fischer- Verlag erschienenen Korrespondenz empfohlen.) Daß es aber auch in unserer Zeit Merkwürdiges und Ungereimtes gibt, dafür zeugt unter anderem die Tatsache, daß seit jenem mißglückten Start am 24. Juni 1935 an der Sächsischen Staatsoper dieses Meisterwerk volle 25 Jahre so gut wie unbekannt blieb. Es war höchste Zeit, und daher doppelt erfreulich, daß bei den Salzburger Festspielen 1959 dieses übermütige, mit jugendlichem Elan geschriebene „Alterswerk” auf den Spielplan kam und in einer so glänzenden Besetzung einem interessierten Publikum präsentiert wurde.
Das virtuose Libretto, mit unüberhörbaren Anklängen an Hofmannsthals Stil und den Bedürfnissen des Musikers Strauss mit fast schon tiefenpsychologischem Verständnis angepaßt, schrieb Stefan Zweig nach einem Stück Benjonsons. Er hat den ziemlich groben Stoff pointiert und verfeinert; aber einen .Grundfehler hät er nicht Jierauseskätti6’ffei-en köfmetri Biede’Ä/Wfe’i’rte W gufÄttHjet,9ftnAi3r ÄdÄ1W abgedh)0Hfe!’A0įjflj.Į(j’iii1itsl ruhmvoller Vergangenheit, so gezwickt und gezwackt, ja man könnte sagen: auf eine fast sadistische Art gequält wird. Denn er will ja die junge Frau, um die er nachher von seinem erbschleicherischen Neffen betrogen wird, gar nicht haben! Dieser Fehler wird von Akt zu Akt immer peinlicher spürbar, trotz der geistvollen, ironischen, mit allerlei Zitaten und Anklängen spielenden Musik von’ Richard Strauss. Die Aufführung unter Karl Böhm, der auch seinerzeit die Dresdener Premiere dirigierte, ließ keinen Wunsch offen und war das Glanzstück der heurigen Festspiele. (Inszenierung: Günther Rennert, Bühnenbild: Theo Otto, Kostüme: Erni Kniepert; in den Hauptrollen: Hans Hotter, Hilde Güden, Georgine von Milinkovic und Hermann Prey.) Wir werden auf das Werk anläßlich seiner Liebersiedlung an die Wiener Staatsoper — die hoffentlich nicht allzu lang auf sich warten lassen wird — noch zurückkommen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!