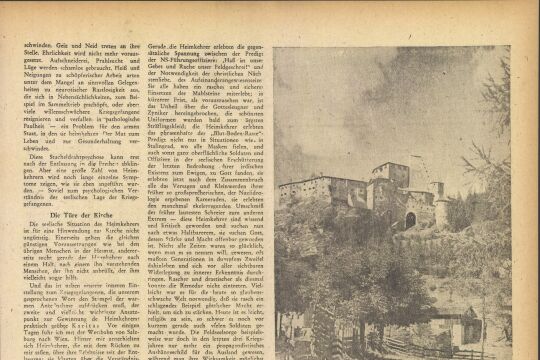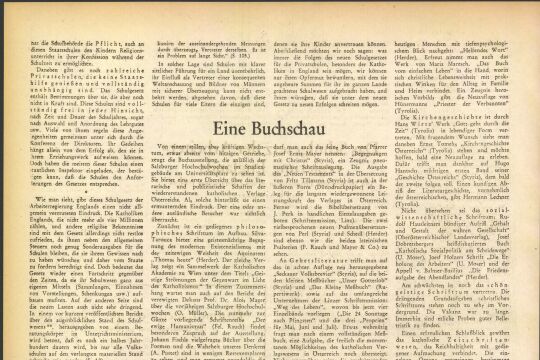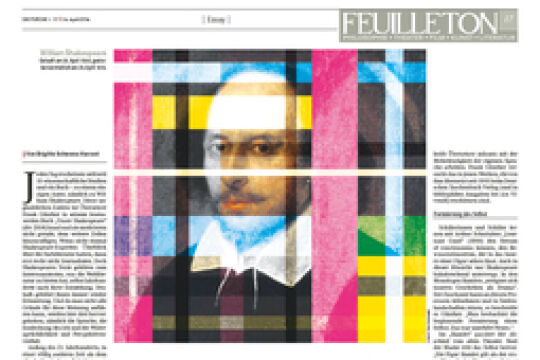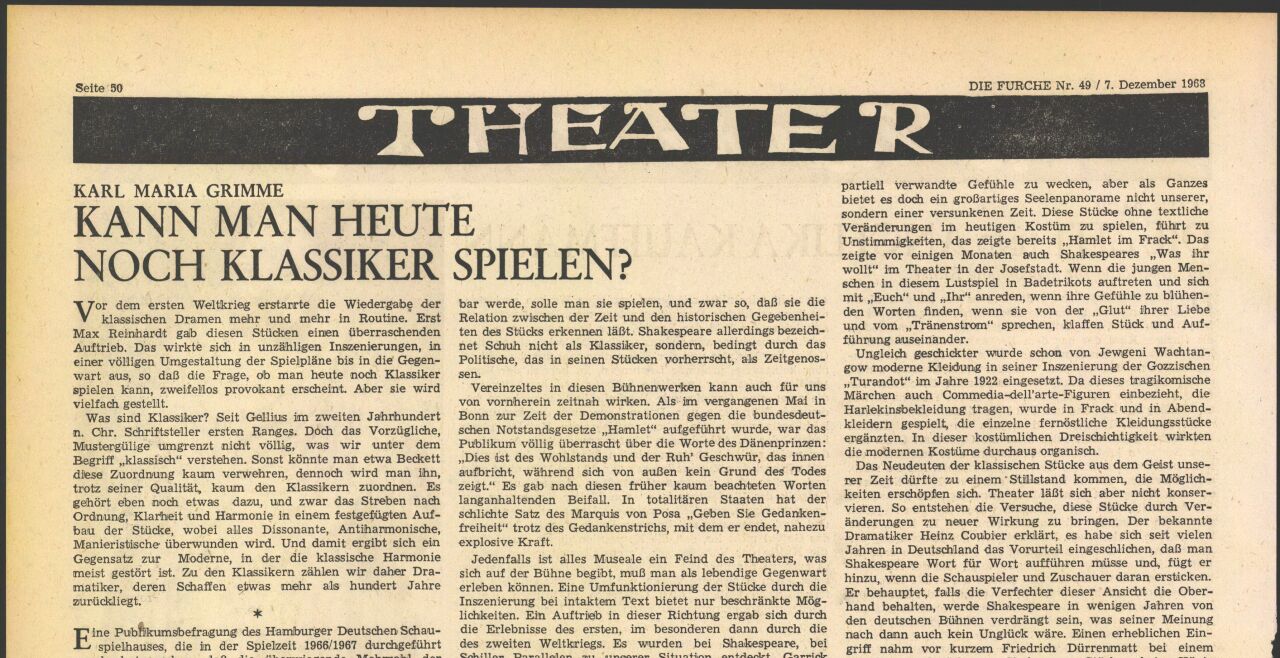
Vor dem ersten Weltkrieg erstarrte die Wiedergabe der klassischen Dramen mehr und mehr in Routine. Erst Max Reinhardt gab diesen Stücken einen überraschenden Auftrieb. Das wirkte sich in unzähligen Inszenierungen, in einer völligen Umgestaltung der Spielpläne bis in die Gegenwart aus, so daß die Frage, Ob man heute noch Klassiker spielen kann, zweifellos provokant erscheint. Aber sie wird vielfach gestellt.
Was sind Klassiker? Seit Gellius im zweiten Jahrhundert n. Chr. Schriftsteller ersten Ranges. Doch das Vorzügliche, Mustergülige umgrenzt nicht völlig, was wir unter dem Begriff „klassisch“ verstehen. Sonst könnte man etwa Beckett diese Zuordnung kaum verwehren, dennoch wird man ihn, trotz seiner Qualität, kaum den Klassikern zuordnen. Es gehört eben noch etwas dazu, und zwar das Streben nach Ordnung, Klarheit und Harmonie in einem festgefügten Aufbau der Stücke, wobei alles Dissonante, Antiharmonische, Manieristische überwunden wird. Und damit ergibt sich ein Gegensatz zur Moderne, in der die klassische Harmonie meist gestört ist. Zu den Klassikern zählen wir daher Dramatiker, deren Schaffen etwas mehr als hundert Jahre zurückliegt.
Eine Pubfekumsbefragung des Hamburger Deutschen Schauspielhauses, die in der Spielzeit 1966/1967 durchgeführt wurde, hat ergeben, daß die überwiegende Mehrzahl der Zuschauer Stücke von Klassikern zu sehen wünscht. Eine solche Befragung im Wiener Burgtheater oder in anderen Spitzenbühnen käme vermutlich zum gleichen Ergebnis. Nicht alle Zeitgenossen sind wirklich Genossen unserer Zeit, viele Menschen leben nach wie vor in Seelenfoereichen einer vergangenen Epoche. Sie können es daher nicht verstehen, daß ein Gefühl der Fremdheit gegenüber den Klassikern aufkommt. Doch verhält es sich mit der heutigen Jugend anders, beurteilt man sie nicht nur vom Stehparterre des Burgtheaters her. Der Mehrheit der jungen Menschen sagen die Klassiker nicht mehr allzuviel.
Die Meisterdramen früherer Zeiten, etwa bis Hebbel, auch vereinzelte spätere, stellen meist, gehöht in der unmittelbaren äußeren Wirklichkeit, eine innere Wirklichkeit dar. Aber nicht der oftmals angewandte Vers ist für die Höhung allein entscheidend, sondern das Sich-Aussprechen der Gestalten über das in der gleichen Situation im Alltag Ausgesagte hinaus sowie bei fast jeder Gesprächswendung der Ausblick ins Allgemeine. Dadurch wird ein sowohl breiteres wie dichteres Lebensbild geboten, als dies in den heutigen Stücken der Fall ist. Hiezu kommt bei dem von Szene zu Szene erfolgenden Situationswechsel der Figuren fast stets das Vorführen eines Konflikts, der Tiefen aufrührt, Schicksalsmächte werden spürbar. Zur größeren waagrechten Dimension kommt die lotrechte. Das sind die gewaltigen Vorzüge der klassischen Dramen gegenüber den in den letzten Jahrzehnten entstandenen Stücken.
Die Meisterdramatiker von einst schrieben vorwiegend Tragödien. In unserem Dasein gehäufter Tragödien rückt das Theater aber davon ab. Nach Pearl Harbour prophezeite Maxwell Anderson: „Wir gehen einer Wiedergeburt der Tragödie entgegen.“ Es kam nicht dazu. Was dagegen Tennessee Williams erklärte, läßt sich bestätigen: „Wir haben die Intensität unserer eigenen Gefühle, die Sensibilität unserer Herzen so vortrefflich vor uns verborgen, daß tragische Stücke uns allmählich unwahr erscheinen.“ Bei der Lösung der Probleme werde eine Abbiegung zum Grotesken hin helfen. Groteskes haben die großen Dramatiker von früher aber nur sehr selten geschrieben.
Die Stücke dieser Meisterdramatiker spielten schon zur Entstehungszeit meist in der Vergangenheit. Nun sind wir Heutige durch rasante Entwicklungen auf so vielen Gebieten dermaßen gegenwarts- und zukunftsbesessen, daß die Geschichte nicht mehr die gleiche Bedeutung hat wie noch am Anfang dieses Jahrhunderts, mögen auch wissenschaftliche Kärrner mehr als früher mit seltsamem Eifer völlig Belangloses der Vergangenheit zu entreißen und zu analysieren bestrebt sein. Außerdem führen die Klassiker fast ausschließlich Könige, Staatsmänner, Feldherren vor. Zweifellos verdichtet sich auch heute in den Führenden der Völker das Schicksal, aber unser Kollektivzeitalter hat so sehr den Durchschnittsmenschen hochgespielt, daß sich die Aufmerksamkeit ihm fast allein zuwendet. Die Machthaber werden nahezu nur aus dem Blickwinkel der Pikanterie betrachtet. Das begann schon bei Bernard Shaw.
Hiezu kommt die gehobene Sprache, die reich mit Bildworten durchsetzt ist. Sie sei besonders „schön“, wird als ihr Vorzug gerühmt. Zweifellos ist sie keineswegs nur Zierat, ihre Plastik bewirkt eine besondere Eindringlichkeit. Aber die dichterische bilderreiche Sprache von einst war Höhung der damaligen Sprache in Briefen, Urkunden, auf den Kanzeln. Sie hat kaum noch Bezug zu unserer Sprache. Immer mehr verstärkt sich ein leises Befremden.
Es ist daher eine Art der Darbietung nötig, die sich im Lauf der Jahre, bei jeder neuen Inszenierung dem Zeitgefühl entsprechend verändert. Paul Hoffmann, der Direktor des Burgtheaters, spricht davon, daß man die Klassiker auf die Zeit beziehen müsse, in der wir leben. Aber ohne Transparente, ohne Verfremdung und moderne Kostüme. Man brauche nur die Partitur auszudeuten, da stehe alles drin. Und Ernst Lothar erklärt zu dieser Frage, es dürfe die Substanz nicht angetastet, nicht verrückt, nicht verfälscht werden. Wer es tue, sei kein Konventionsbrecher, sondern verfehle sich wider die Natur des Werkes.
Nun ist Oscar Fritz Schuh der Meinung, daß sich der Klassikerkonsum auf die Dauer nicht werde aufrechterhalten lassen. Es sollte, erklärt er, an größeren Bühnen nicht üblich sein dürfen, diese Stücke als Abonnementfutter oder lediglich zur Erfüllung von Schauspielerverträgen, wie dies so häufig der Fall ist, anzusetzen. Es gebe Bühnenwerke, die schlecht in der Zeit liegen. Nur wenn ein neuer Aspekt sichtbar werde, solle man sie spielen, und zwar so, daß sie die Relation zwischen der Zeit und den historischen Gegebenheiten des Stücks erkennen läßt. Shakespeare allerdings bezeichnet Schuh nicht als Klassiker, sondern, bedingt durch das Politische, das in seinen Stücken vorherrscht, als Zeitgenossen.
Vereinzeltes in diesen Bühnenwerken kann auch für uns von vornherein zeitnah wirken. Als im vergangenen Mai in Bonn zur Zeit der Demonstrationen gegen die bundesdeutschen Notstandsgesetze „Hamlet“ aufgeführt wurde, war das Publikum völlig überrascht über die Worte des Dänenprinzen: „Dies ist des Wohlstands und der Ruh’ Geschwür, das innen aufbricht, während sich von außen kein Grund des Todes zeigt.“ Es gab nach diesen früher kaum beachteten Worten langanhaltenden Beifall. In totalitären Staaten hat der schlichte Satz des Marquis von Posa „Geben Sie Gedankenfreiheit“ trotz des Gedankenstrichs, mit dem er endet, nahezu explosive Kraft.
Jedenfalls ist alles Museale ein Feind des Theaters, was sich auf der Bühne begibt, muß man als lebendige Gegenwart erleben können. Eine Umfunktionierung der Stücke durch die Inszenierung bei intaktem Text bietet nur beschränkte Möglichkeiten. Ein Auftrieb in dieser Richtung ergab sich durch die Erlebnisse des ersten, im besonderen dann durch die des zweiten Weltkriegs. Es wurden bei Shakespeare, bei Schiller Parallelen zu unserer Situation entdeckt. Garrick spielte den Hamlet als sentimentalen, weltschmerzlerischen Jüngling, der sich zu nichts entschließen kann. Maximilian Schell zeichnet Hamlet als politischen Menschen, als Widersacher usurpierter Herrschaft. Karl Moor war einst der edle Räuber, der strahlende Held, heute sieht man in ihm den gefährlichen Idealisten. Generell werden die Helden in den Stücken der Klassiker in ihrem Pathos zurückgenommen, ja unterspielt.
Als Leopold Lindtberg im Jahr 1964 im Burgtheater den Zyklus der Shakespearschen Königsdramen vorführte, kam es ihm merkbar darauf an, die Konkordanz der Stücke mit dem modernen Bewußtsein herzustellen, wobei nicht an die Bereiche des Absurden gedacht werden darf, die Peter Brook in der Londoner Inszenierung des „König Lear“ herausholte'. Lindtberg trieb die Entwicklung nicht einseitig weiter, weil er darin einen Verlust an Ausgeglichenheit gesehen hätte. Kennzeichnend für ihn ist der Ausspruch: „Ein Regisseur darf alles in Szene setzen, nur nicht sich selbst.“
Das schwierigste Problem bildeten die Kampfszenen. Mit dem Film, der da in seiner Realistik unüberbietbar Eindrucksvolles geschaffen hat, kann das Theater nicht konkurrieren. Deshalb beschränkte sie Lindtberg auf ein Minimum, das heißt, es wurden Fechtszenen nur zwischen jenen Figuren vorgeführt, bei denen es der Dialog erfordert. Das blutige Geschehen imaginierten Mittel des Lichts, des Todes, der Farbe. So ergab die Schlacht von Azincourt in „König Heinrich V.“ einfach dadurch einen starken Eindruck, daß sich locker gehängte Stoffbahnen bei rasch wechselndem Licht und bei entsprechender Geräuschmusik lebhaft bewegten.
Die Geschehnisse und Konflikte, die bei den Klassikern fast stets historisch bedingt sind, lassen sich nicht in die Gegenwart verlagern. Daß Versuche in dieser Richtung als notwendig erachtet werden und man sie mehrfach unternahm, zeigt den immer offenkundiger werdenden Abstand zu ihnen. Sie besitzen bei aller Gegensätzlichkeit mehr Gemeinsames untereinander als mit uns. Selbst Schillers „Kabale und Liebe“ führt eine Handlung vor, die sich heute keineswegs gleichartig ereignen kann, dieses Trauerspiel wird zum Rückblick in die Vergangenheit, es vermag in uns gewiß partiell verwandte Gefühle zu wecken, aber als Ganzes bietet es doch ein großartiges Seelenpanorame nicht unserer, sondern einer versunkenen Zeit. Diese Stücke ohne textliche Veränderungen im heutigen Kostüm zu spielen, führt zu Unstimmigkeiten, das zeigte bereits „Hamlet im Frack“. Das zeigte vor einigen Monaten auch Shakespeares „Was ihr wollt“ im Theater in der Josefstadt. Wenn die jungen Menschen in diesem Lustspiel in Badetrikots auftreten und sich mit „Euch“ und „Ihr“ anreden, wenn ihre Gefühle zu blühenden Worten finden, wenn sie von der „Glut“ ihrer Liebe und vom „Tränenstrom“ sprechen, klaffen Stück und Aufführung auseinander.
Ungleich geschickter wurde schon von Jewgeni Wachtangow moderne Kleidung in seiner Inszenierung der Gozzischen „Turandot“ im Jahre 1922 eingesetzt. Da dieses tragikomische Märchen auch Commedia-dell’arte-Figuren einbezieht, die Harlekinsbekleidung tragen, wurde in Frack und in Abendkleidern gespielt, die einzelne fernöstliche Kleidungsstücke ergänzten. In dieser kostümlichen Dreischichtigkeit wirkten die modernen Kostüme durchaus organisch.
Das Neudeuten der klassischen Stücke aus dem Geist unserer Zeit dürfte zu einem " Stillstand kommen, die Möglichkeiten erschöpfen sich. Theater läßt sich aber nicht konservieren. So entstehen die Versuche, diese Stücke durch Veränderungen zu neuer Wirkung zu bringen. Der bekannte Dramatiker Heinz Coubier erklärt, es habe sich seit vielen Jahren in Deutschland das Vorurteil eingeschlichen, daß man Shakespeare Wort für Wort aufführen müsse und, fügt er hinzu, wenn die Schauspieler und Zuschauer daran ersticken. Er behauptet, falls die Verfechter dieser Ansicht die Oberhand behalten, werde Shakespeare in wenigen Jahren von den deutschen Bühnen verdrängt sein, was seiner Meinung nach dann auch kein Unglück wäre. Einen erheblichen Eingriff nahm vor kurzem Friedrich Dürrenmatt bei einem allerdings schwächeren Shakespeare-Stücke, bei „König Johann“ vor. Handlungsmotive verdeutlichte er, manche Rollen wurden ausgebaut, andere gestrichen, Charaktere erfuhren eine Veränderung, Möglichkeiten, die sich Shakespeare entgehen ließ, nützte Dürrenmatt. Das Stück näherte er dadurch der Gegenwart an.
Manche jüngere Dramaturgen und Regisseure beginnen die Klassiker bereits abzulehnen, sie sehen sie nur als Pflichtübung an, es sei denn, sie binden sich nicht an den Text, verändern ihn, womit zwar neue Aspekte, aber kaum voll befriedigende Lösungen erreicht werden. Peter Palitzsch nahm für die Stuttgarter Inszenierung von Shakespeares „König Richard III.“ nicht nur Kürzungen der Szenen, sondern auch Umstellungen vor, zahlreiche Verse wunden hinzugedichtet. Man sprach von einer Paraphrase über Shakespeare. Berühmt — andere sagen berüchtigt — wurde die Bremer Aufführung von Shakespeares „Maß für Maß“ durch Peter Zadek, der erklärte, er habe nur das inszeniert, was ihn wirklich interessierte. Manche Passagen ließ er dreimal bis zur Ironie wiederholen. Kritiker sprachen von einer faszinierenden szenischen Instrumentierung, wenn sie auch letztlich schiefgegangen sei. .
Bei der Inszenierung von Schillers „Räuber“ in Oberhausen durch Günther Büch, in einem Theater unkonventioneller Spielplangestaltung, wurde der nicht mehr brisante Zündstoff durch Textzusätze aus der damaligen in die heutige Zeit transponiert und dadurch wieder explosiv gemacht. Es gab Twenhöhlen mit Musikboxen und Spielautomaten, Polizeiautos und Motorräder. Die Kritik stellte geglückte Szenen fest, aber auch manches, das nicht zusammenpaßte. Bei der Inszenierung des Schillerschen „Teil“ durch Hansgünther Heyme in Wiesbaden wurden die Bauern zu Nazis, wurde Attinghausen zu Hindenburg, Stauf facher zu Goebbels. Und Peter Brook in London spielte Shakespeares „Sturm“ nicht im gegebenen Ablauf, es wurde nicht das Stück vorgeführt, sondern die Darsteller suchten die Motive für Caliban, Prospero, Ariel herauszuarbeiten.
Natürlich kann man davon sprechen, daß die Regisseure dieser Aufführungen um jeden Preis auffallen wollen und, da dies durch konventionelle Inszenierungen nicht möglich ist, durch Abnormes. Aber sollte man sich nicht fragen, weshalb dies gerade heute der Fall ist und sich nicht schon vor dem ersten Weltkrieg ereignete. Genügt die Erklärung, daß ein Verfall mancher Werte, daß zerrissene Bindungen heute fast alles ermöglichen? Liegen die Ursachen nicht doch tiefer? •
Das Historische werde bei den Klassikern akzeptiert, erklärt Leon Epp, der Direktor des Wiener Volkstheaters, aber ihre Stücke erschüttern nicht. Das zeigt, daß die Beliebtheit der klassischen Bühnenwerke bei der älteren Generation nicht aus einer unmittelbaren, echten geistigen Beziehung kommt, was gesucht wird, ist Bildungstheater. Das aber ist allen, denen die Zukunft des Theaters und seine lebendige Funktion am Herzen liegt, ein Greuel. Was gesucht wird, ist auch das Schauspieltheater. Da aber ist das Stück, auch das der Klassiker, nur noch Vorwand.
Helmut Schwarz, Leiter des Wiener Reinhardt-Seminars, spricht von der Abneigung der heutigen jungen Menschen vor großen Worten, es bestehe eine Scheu, Gefühle zu zeigen, ja, es bereite ernste Schwierigkeiten, sie ihnen zu entlocken, Klassikeraufführungen deckend zu besetzen, werde von Jahr zu Jähr schwieriger. Damit ergibt sich, daß auch die Masse der heutigen Jugend zu den Klassikern nur noch eine lose Beziehung haben kann, was sich im Theaterbesuch ausdrückt. Die Theatendirektoren klagen über das Fehlen der jungen Leute in den Zuschauerräumen. Dagegen sieht man in Wien im Ateliertheater, im Experiment am Lichtenwerd, im Theater am Belvedere, wo nur betont moderne Stücke gespielt werden, fast nur ein junges Publikum. Es ist aber nun kaum anzunehmen, daß die jungen Menschen, älter geworden, zu den Klassikern eine plötzliche Zuneigung entdecken werden.
Antonin Artaud hat behauptet: „Die Meisterwerke der Vergangenheit sind für die Vergangenheit gut, für uns sind sie es nicht.“ Nun, eine Klassikerdämmerung scheint sich tatsächlich anzukündigen, der Abstand zu diesen Stücken wird immer größer. Er liegt in der Diskrepanz zwischen ihrem Weltbild und dem unsern.-
Neues freilich, das ihrer Größe entspricht, gibt es nicht oder noch nicht. Das kennzeichnet unsere zwiespältige Situation.