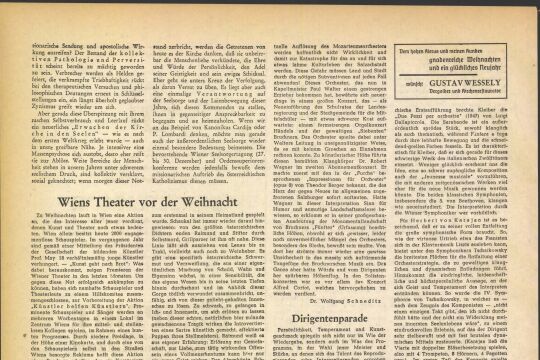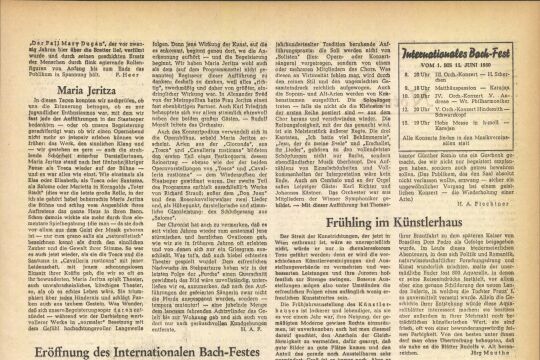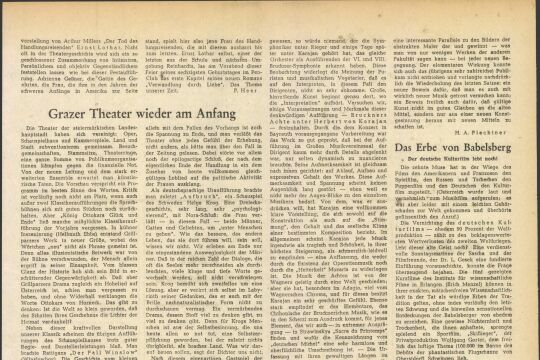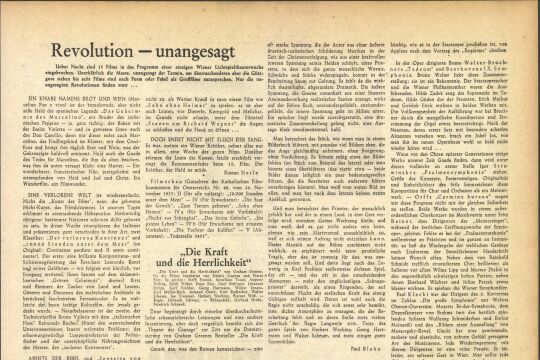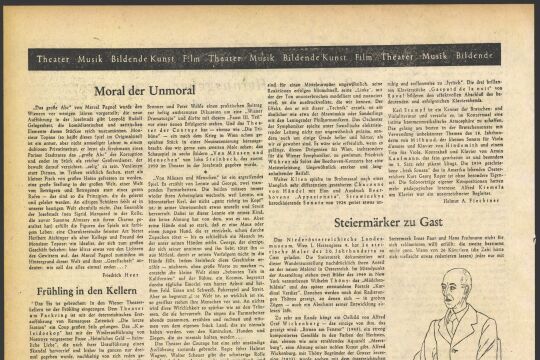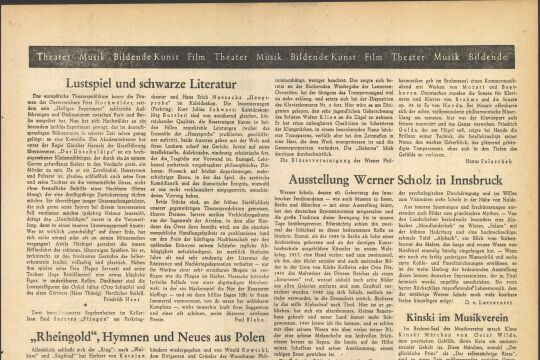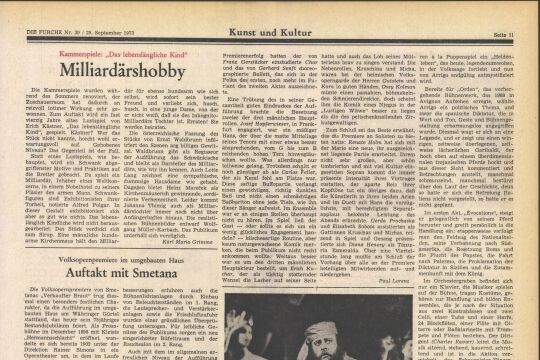Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Karajans Salzburger Festspiele
Auf der Staatsbrücke wehten die Fahnen, die großen Salzburger Hotels waren ausverkauft, nur fiel statt des traditionellen Schnürlregens ab und zu ein wenig Schnee aus niedrig hängenden Wolken. Auch fehlte, obwohl sämtliche Veranstaltungen ganz beziehungsweise fast ganz ausverkauft waren, das lebhaft-bunte Treiben in den engen Gassen und auf den großen Plätzen. Daran mag zum großen Teil die frühe Jahreszeit und das schlechte Wetter schuld gewesen sein. Oder macht eine „Walküre“ noch keinen Sommer? Allenfalls machte sie ein volles, mit Spannung erfülltes Haus. — Mit Wagners „Walküre“ nämlich begann Herbert von Karajan seine ersten Salzburger Osterfestspiele, als deren Kernstück während der nächsten drei Jahre jeweils ein Teil der Tetralogie neüinszeniert werden soll, bis der „Ring“ geschlossen ist.
Wir sahen „Die Walküre“ im Großen neuen Festspielhaus mit seiner Bühnenbreite von 32 Metern, die voll ausgenützt wurde. — Bühnenbild und Kulissen sind, mit Ausnahme des ersten Aktes, weitgehend durch . Projektionen ersetzt. Doch kann man die einen infolge der Dunkelheit nicht immer klar voneinander unterscheiden. Hundings Hütte erscheint auf den ersten Blick originell, zeigt aber im weiteren Spielverlauf gewisse Nachteile. Wir sehen nämlich nicht eine Esche im Gemach, sondern eine in den Stamm eingelassene Stube, die den ganzen Akt über nach rückwärts geöffnet ist. Aus dem gleichen Stamm wachsen, links und rechts, zwei riesige gebogene Äste, die, ihrer gekrümmten Form nach, als Symbole für einen Ring, beziehungsweise seine Teile aufgefaßt werden können.
Auch in Günther Schneider-Siemssens übrigen Bildern spielen kreisförmige Projektionen, meist aber Ellipsen, eine große Rolle. Zu den sie begrenzenden Bahnen, die manchmal wie Autostraßen aussehen, streben die Gestalten hin oder von ihnen weg, bewegen sich auf ihnen mehr als aufeinander zu; diese Ellipsen zerbrechen, ihre Teile wandern nach links oder rechts ab — doch nur selten nehmen sie Farbe an. Diese neue „Walküre“ präsentiert sich nämlich fast nur in Schwarz-weiß, beziehungsweise in Grautönen. Die dargestellten Landschaften (zweiter Akt: „Wildes Felsengebirge“, dritter Akt „Auf einem Felsenberg“) gleichen eher Sanddünen im Sturm oder, in höheren Regionen, Spiralnebeln. Das alles ist malerisch mit viel Geschmack gemacht, schafft eine große Einheitlichkeit im Optisch-Stilistischen, wirkt allerdings besonders in dem ja auch musikdramatisch nicht übermäßig bewegten zweiten Akt ermüdend, nicht zuletzt wegen der mangelnden Farben und der obligaten Dunkelheit. Auch der Feuerzauber am Schluß ist von nur mäßiger Pracht. Er hätte auf dieser Bühne anders, wirksamer ausfallen können.
Die Führung der Sänger-Darsteller wirkt im Ganzen ein wenig konventionell und ist überdies durch die enorme Breite der Bühne bestimmt und erschwert. Infoige der Bevorzugung des Statischen vor dem Dynamischen, vor allem aber wegen des mehr lyrischen als dramatischen Charakters und bevorzugten Einsatzes der meisten Stimmen entsteht auf weite Strecken der Eindruck eines „Concerto scenico“. Freilich eines solchen von höchster Qualität. — Den größten Erfolg durfte Gundula Janowitz als Sieglinde für sich buchen. Sie besitzt das, was man einen jugendlich strahlenden Sopran nennt, der auch an Führung nichts zu wünschen übrig läßt. — Im Lyrischen und im Dramatischen gleicherweise überzeugend war Jon Vickers als Siegmund, eine sehr menschliche Brünhilde gab Regine Crespin, durch den strömenden Wohllaut ihrer Stimme erfreute Christa Ludwig, dem mächtigen Wuchs Martti Talve-las (Hunding) entsprach sein sonorer Baß, Thomas Stewart war ein würdevoller Wotan, den Karajan seine große Lebensbeichte im zweiten Akt in lebhaftem Tempo teils sprechen, teils flüstern ließ — was nicht nur sehr effektvoll war, sondem auch der „inneren Logik“ entsprach. Daß sein schwieriger Text sowie der aller Hauptrollenträger bestens verständlich war, darf als ein weiterer Vorzug dieser überaus sorgfältigen und ambitionierten Einstudierung bezeichnet werden und ist auch ein Verdienst des musikalischen Leiters Karajan. Die Walküren kamen aus Stuttgart, New York, Ostberlin, Düsseldorf, Köln und Stockholm — und bildeten trotzdem ein homogenes Ensemble, das — wie alle übrigen Solisten — Georges Wakhewitsch unauffällig, geschmackvoll und dem Stil des Ganzen entsprechend gekleidet hat.
Das Beste zum Schluß: das Berliner Philharmonische Orchester, seit rund zehn Jahren gefeierter Gast bei den Salzburger Festspielen, zum erstenmal jedoch — wenn wir von seiner Mitwirkung bei dem mehr oratorienhaften „Mystere de la nati-vite“ von Frank Martin absehen — als Opernorchester tätig. Mit ihnen und durch sie konnte Karajan sein gegenwärtiges Klangideal hundertprozentig verwirklichen. Es ist das eines präzisen, transparenten, auf weite Strecken kammermaisikalischen Spielens. Seiner Realisierung diente auch die geänderte Sitzordnung im Orchester: unmittelbar vor dem Dirigenten waren die Holzbläser placiert, unter ihnen eine ganze Reihe Virtuosen ihres Faches. Die Streicher sind von kühler Brillanz, die Blechbläser von unwahrscheinlicher Präzision und Schönheit des Klanges, wenn auch etwas weniger „voluminös“ als etwa die der Wiener Philharmoniker. Daß dieses vorzügliche und hochdisziplinierte Orchester auch „anders“, nämlich klangprächtig musizieren kann, erwiesen die Vorspiele und der „Feuerzauber“ am Schluß. Es gab überaus lebhafte und langanhaltende Ovationen für den Dirigenten Karajan, die Solisten und das Orchester sowie für alle Mitwirkenden an dieser Aufführung.
Auf dem Programm des 1. Orchesterkonzerts standen die folgenden Werke von J. S. Bach: das 1. und das 3. Brandenburgische Konzert, das Konzert für Violine und Orchester E-Dur mit dem ausgezeichneten Christian Ferras als Solisten und die Suite Nr. 2 h-Moll, deren zum Teil halsbrecherischen Solopart Karl-Heinz Zöllner überaus tonschön blies. Karajan dirigierte vom Cembalo aus die minutiös einstudierten und von den Berlinern, etwa zwei Dutzend Mann, virtuos und frei vorgetragenen Stücke. Was den Stil der Bach-Interpretation betrifft, zeigt er sich nach wie vor „unentschlossen“ — doch das ist ein weites Feld, während er zu Bruckner, dessen VIII. Symphonie auf dem heurigen Programm stand, in ein immer besseres, näheres Verhältnis zu treten schien. So glaubten wir es jedenfalls während der Wiener Jahre Karajans feststellen zu können. Aber diesmal, mit den Berliner Philharmonikern, war wieder alles anders. Zunächst vom Klanglichen her: da gab es Härten, Grobheiten und dynamische Exzesse, die wir nach dem kammer-musdkalischen Vortrag der „Walküre“-Partitur nicht für möglich gehalten hätten. Plötzlich fehlte es den Streichern an Wärme, dem Ganzen aber an jener „dritten Dimension“, ohne die Bruckner eben nur ein Symphoniker unter vielen ist. „Meine Achte ist ein Mysterium“, sagte Bruckner, geheimnisvoll flüsternd, zu seinem Verehrer Göllerich. Aber von diesem Mysterium war im großen Festspielhaus keine Spur übriggeblieben. Das bewies auch der wie nach einer Verdischen Stretta losbrechende Beifallssturm der vielen Ahnungslosen...
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!