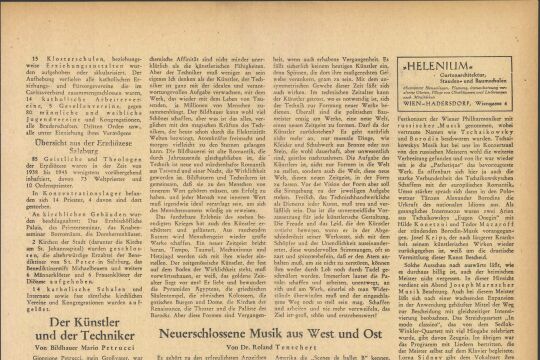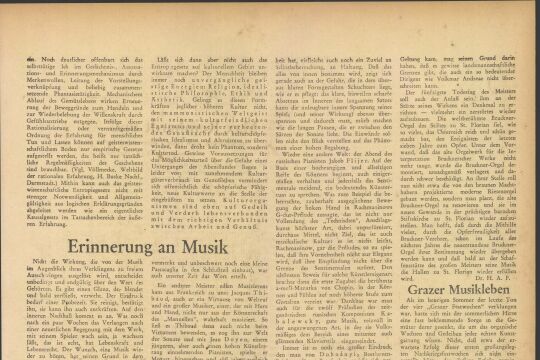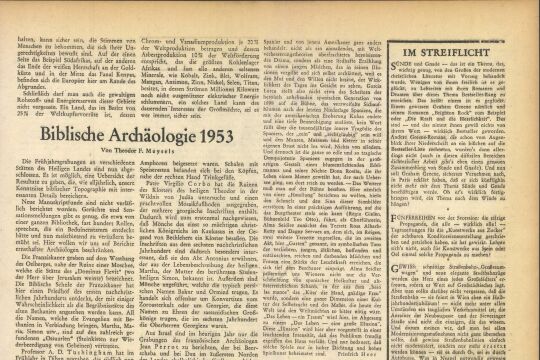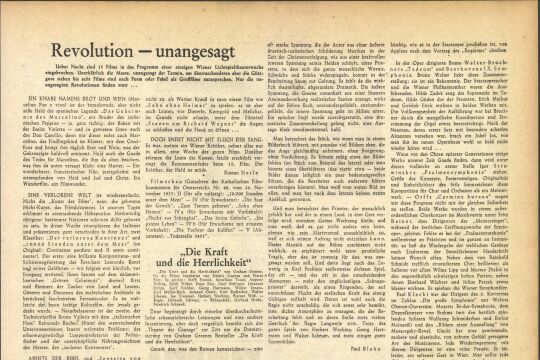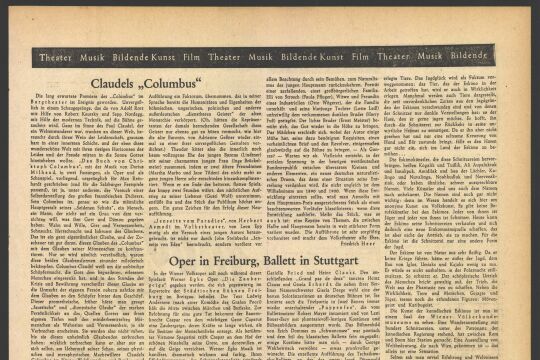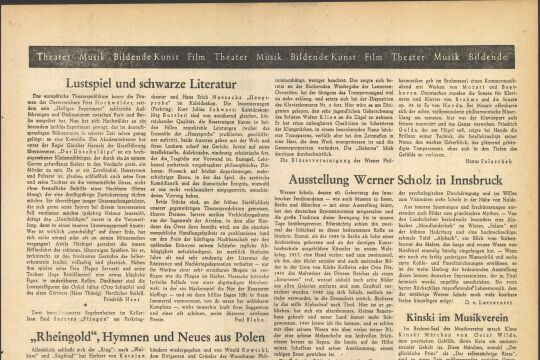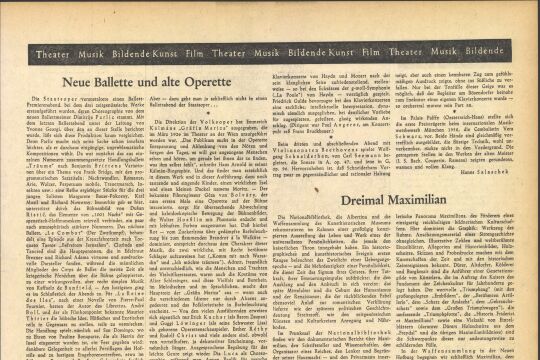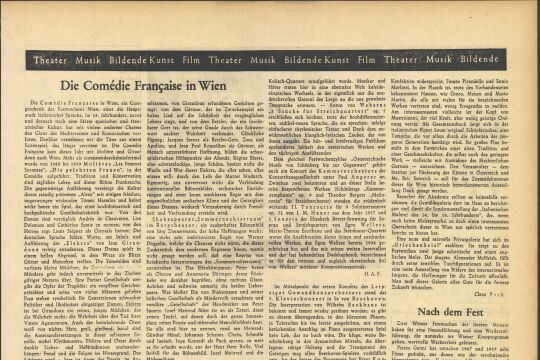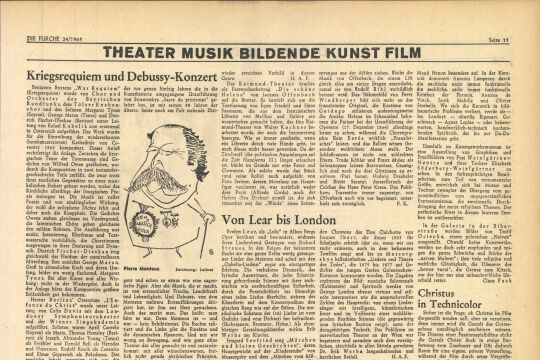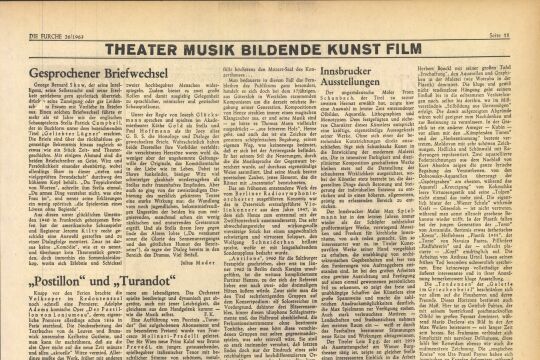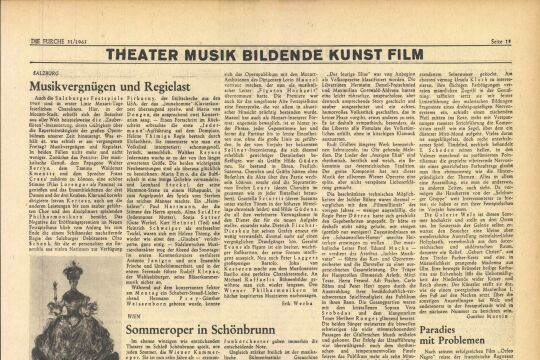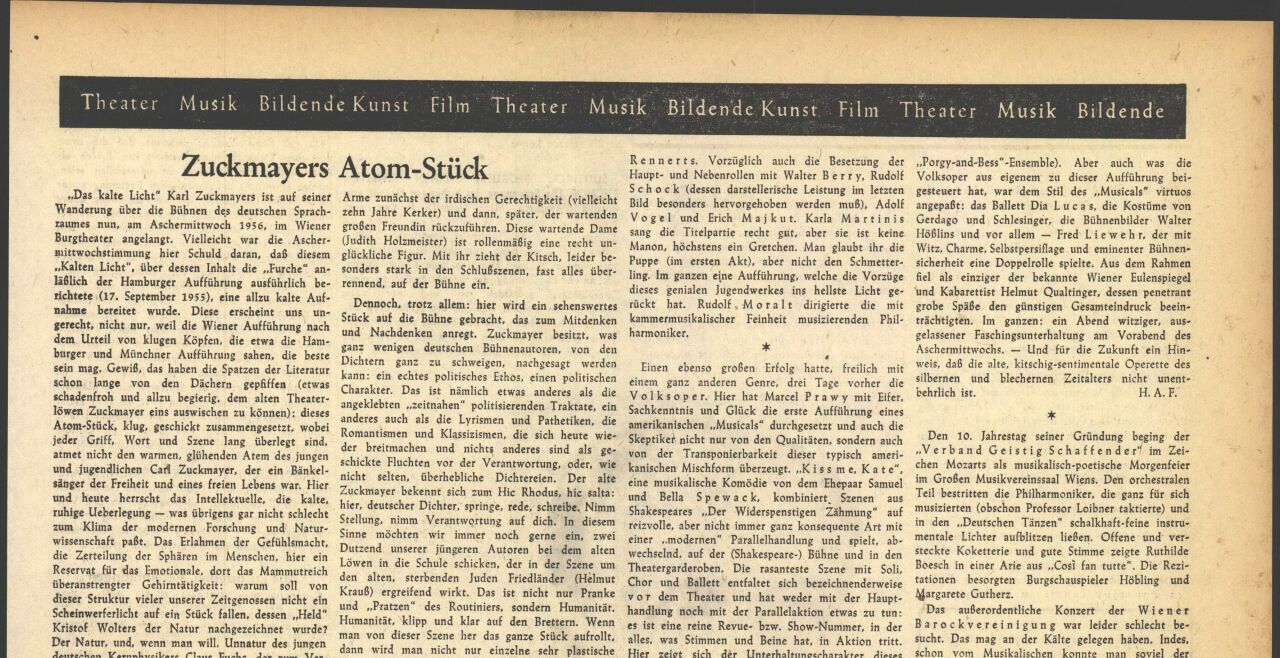
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Manon und Musical
Nicht nur ihre jüngeren Schwestern Mimi, Tosca, Butterfly und Turandot, sondern auch die um wenige Jahre ältere, gleichnamige Tochter Massenets haben den dauernden Erfolg von P u c c i n i s „Manon“ verhindert. In Wien wurde die Oper 1923 erstaufgeführt und bis 1925 insgesamt zwölfmal gespielt. Dann verschwand sie für 30 Jahre vom Spielplan, bis, ja bis sie durch Günther Renne (Regie), Stefan Hlawa (Bühnenbilder) und Erni Kniepert (Kostüme) für die Wiener Staatsoper wiederentdeckt wurde. Trotz oberflächlicher und banaler Bearbeitung durch den Librettisten war der große Roman des Abbe Prevost der Stoff für Puccini. Diese Partitur zeigt bereits alle Qualitäten des Meisters (Farbigkeit, Transparenz, Lyrismus, Sensibilität), aber ohne die Vergröberungen der späteren Werke. Alles ist jugendfrisch, unverbraucht, zart und von ebenso reicher wie feiner melodischer Erfindung. — Wir können uns keine schöneren und stimmungsvolleren Bühnenbilder dazu vorstellen als diejenigen, die Stefan Hlawa für die erste Neuinszenierung nach dem Opernfest geschaffen hat: einen in zarten Pastellfarben gehaltenen Platz in Amiens, einen echt pariserischen Salon, den in impressionistische Farben getauchten Hafen von Le Havre und die trostlose Todeslandschaft der Wüste von New Orleans. Ebenso meisterhaft sind die noblen und mit größter Sorgfalt ausgeführten Kostüme von Erni Kniepert. Zusammen mit den Szenenbildern von Hlawa ergeben sie Farbwirkungen, deren sich kein Maler von Rang zu schämen brauchte. Intelligent, genau und lebendig ist die Regie Günthe:Rennerts. Vorzüglich auch die Besetzung der Haupt- und Nebenrollen mit Walter Berry, Rudolf Schock (dessen darstellerische Leistung im letzten Bild besonders hervorgehoben werden muß), Adolf Vogel und Erich M a j k u t. Karla Martinis sang die Titelpartie recht gut, aber sie ist keine Manon, höchstens ein Gretchen. Man glaubt ihr die Puppe (im ersten Akt), aber nicht den Schmetterling. Im ganzen eine Aufführung, welche die Vorzüge dieses genialen Jugendwerkes ins hellste Licht gerückt hat. Rudolf M o r a 11 dirigierte die mit kammermusikalischer Feinheit musizierenden Philharmoniker.
Einen ebenso großen Erfolg hatte, freilich mit einem ganz anderen Genre, drei Tage vorher die Volksoper. Hier hat Marcel P r a w y mit Eifer, Sachkenntnis und Glück die erste Aufführung eines amerikanischen „Musicals“ durchgesetzt und auch die Skeptiker nicht nur von den Qualitäten, sondern auch von der Transponierbarkeit dieser typisch amerikanischen Mischform überzeugt. „K i s s m e, K a t e“, eine musikalische Komödie von dem Ehepaar Samuel und Bella S p e w a c k, kombiniert. Szenen aus Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“ auf reizvolle, aber nicht immer ganz konsequente Art mit einer „modernen“ Parallelhandlung und spielt, abwechselnd, auf der (Shakespeare-) Bühne und in den Theatergarderoben. Die rasanteste Szene mit Soli, Chor und Ballett entfaltet sich bezeichnenderweise v o t dem Theater und hat weder mit der Haupthandlung noch mit der Parallelaktion etwas zu tun: es ist eine reine Revue- bzw. Show-Nummer, in der alles, was Stimmen und Beine hat, in Aktion tritt. Hier zeigt sich der Unterhaltungscharakter dieses Genres am unverfälschtesten. Cole Porter, der Autor der Musik und der Gesangstexte, nimmt seine Einfälle und Instrumentationseffekte wo er sie findet. Es gibt Walzer, Menuett und Tarantella, Anleihen an die Wiener Operette und das Singspiel — und vor allem viel Jazz ä la Gershwin. Sowohl der Regisseur als auch der Dirigent der Aufführung (Julius Rudel und Heinz Rosen) sind Spezialisten des Musicals. Ebenso die Hauptdarsteller und Sänger Brenda Lewis, Olive Moorfield und Hubert Dilworth (aus dem Porgy-and-Bess“-Ensemble). Aber auch was die Volksoper aus eigenem zu dieser Aufführung beigesteuert hat, war dem Stil des „Musicals“ virtuos angepaßt: das Ballett Dia Lucas, die Kostüme von Gerdago und Schlesinger, die Bühnenbilder Walter Hößlins und vor allem — Fred Li e wehr, der mit Witz, Charme, Selbstpersiflage und eminenter Bühnensicherheit eine Doppelrolle spielte. Aus dem Rahmen fiel als einziger der bekannte Wiener Eulenspiegel und Kabarettist Helmut Qualtinger, dessen penetrant grobe Spaße den günstigen Gesamteindruck beeinträchtigten. Im ganzen: ein Abend witziger, ausgelassener Faschingsunterhaltung am Vorabend des Aschermittwochs. — Und für die Zukunft ein Hinweis, daß die alte, kitschig-sentimentale Operette des silbernen und blechernen Zeitalters nicht unentbehrlich ist. H. A. F.
Den 10. Jahrestag seiner Gründung beging der „Verband Geistig Schaffender“ im Zeichen Mozarts als musikalisch-poetische Morgenfeier im Großen Musikvereinssaal Wiens. Den orchestralen Teil bestritten die Philharmoniker, die ganz für sich musizierten (obschon Professor Loibner taktierte) und in den „Deutschen Tänzen“ schalkhaft-feine instrumentale Lichter aufblitzen ließen. Offene und versteckte Koketterie und gute Stimme zeigte Ruthilde Boesch in einer Arie aus „Cosi fan tutte“. Die Rezitationen besorgten Burgschauspieler Höbling und Margarete Gutherz.
Das außerordentliche Konzert der Wiener Barockvereinigung war leider schlecht besucht. Das mag an der Kälte gelegen haben. Indes, schon vom Musikalischen konnte man soviel der inneren Wärme mitnehmen, dazu kam die Interpretation. Gerhard Zatschek, der Leiter der Vereinigung, der auch als Solist am Cello zu hören war, hat nämlich die Wesenheit der barocken Musik am richtigen Punkte erfaßt: am Prinzip der Kontrastierung. Dazu kamen noch der farbig-festliche Wurf der Linien und die sinnvolle Betonung, die nirgends überakzentuiert wirkte. Von den Solisten ist noch die tüchtige Geigerin Eva Hitzger hervorzuheben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!