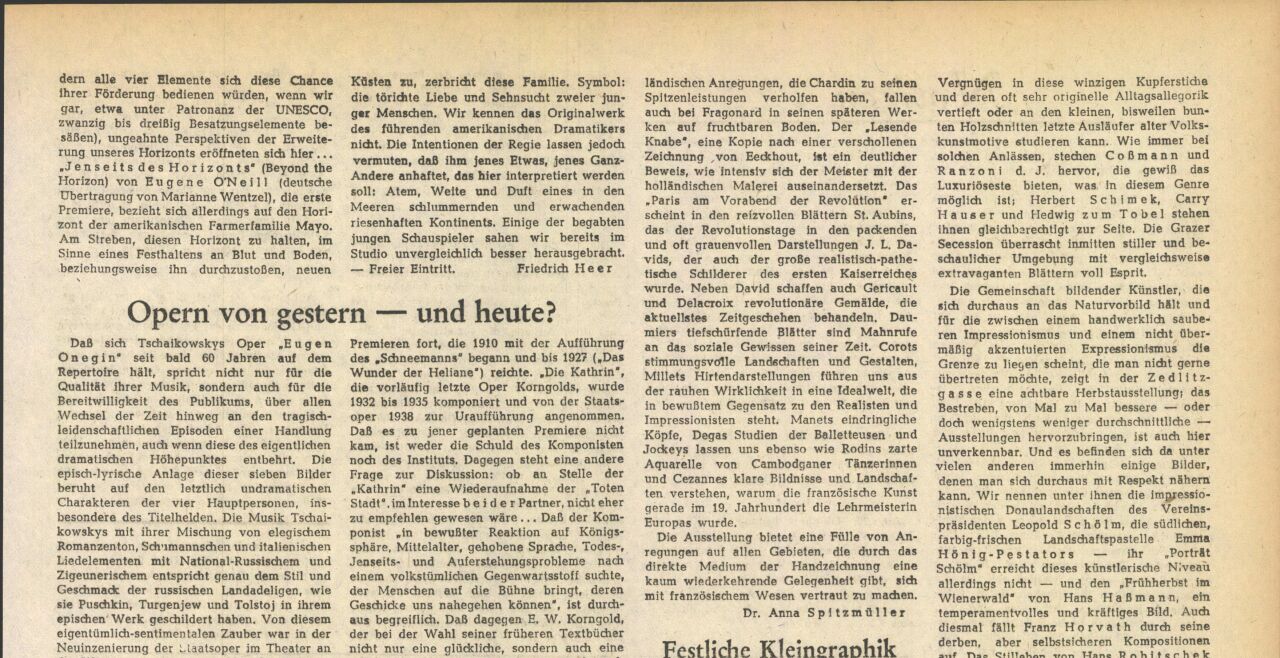
Daß sich Tschaikowskys Oper .Eugen Onegin“ seit bald 60 Jahren auf dem Repertoire hält, spricht nicht nur für die Qualität ihrer Musik, sondern auch für die Bereitwilligkeit des Publikums, über allen Wechsel der Zeit hinweg an den tragisch-leidenschaftlichen Episoden einer Handlung teilzunehmen, auch wenn diese des eigentlichen dramatischen Höhepunktes entbehrt. Die episch-lyrische Anlage dieser sieben Bilder beruht auf den letztlich undramatischen Charakteren der vier Hauptpersonen, insbesondere des Titelhelden. Die Musik Tschaikowskys mit ihrer Mischung von elegischem Romanzenton, Sdrimannschen und italienischen Liedelementen mit National-Russischem und Zigeunerischem entspricht genau dem Stil und Geschmack der russischen Landadeligen, wie sie Puschkin, Turgenjew und Tolstoj in ihrem epischen Werk geschildert haben. Von diesem eigentümlich-sentimentalen Zauber war in der Neuinzenierung der Llaatsoper im Theater an der Wien wenig zu spüren. Von den Bühnenbildern, die — nach einer Zeitmode, die zur Manier zu werden droht — in einen starren Säulenrahmen gepreßt waren, erschienen einige als viel zu massiv. Manfred Zallinger hat aus dem Orchester nicht jenes Espressivo herausgeholt und den Musikern leider auch nidit jenen Feueratem eingehaucht, unter dem gewisse melodische und harmonische Banalitäten der Partitur dahinschmelzen. Die Regie Erich Wymetals schien den einzelnen Schauspielern ziemlich viel Freiheit zu lassen, zeigte dagegen in den Gesellschaftsmassenszenen erfolgreiche Bemühungen um Auflockerung und realistisches Detail. Wenn jedoch einzelne Darsteller, wie zum Beispiel eine der Sängerinnen, kein Gefühl für ein milieugemäßes Benehmen als „Dame“ auf der Bühne hat, so muß ihr eben der Regisseur zeigen, daß e r in jeder Hinsicht ein Herr ist und seinen Willen durchzusetzen versteht. Von den vier Hauptdarstellern (George London, Ljuba Welitsch, Anton Dermota, Martha Rohs) waren die ersten drei vorzüglich. Stimmlich, darstellerisch und in der Erscheinung boten der Titelheld und Tatjana erstklassige, hocherfreuliche Leistungen und erwiesen aufs neue, daß es auf der Opernbühne mit dem Singen allein nicht getan ist.
Mit der Aufführung der „Ka th ri n“ setzte die Staatsoper die Reihe der Korngold-
Premieren fort, die 1910 mit der Aufführung des .Schneemanns“ begann und bis 1927 (.Das Wunder der Heliane“) reichte. .Die Kathrin“, die vorläufig letzte Oper Korngolds, wurde 1932 bis 1935 komponiert und von der Staatsoper 1938 zur Uraufführung angenommen. Daß es zu jener geplanten Premiere nicht kam, ist weder die Schuld des Komponisten noch des Instituts. Dagegen steht eine andere Frage zur Diskussion: ob an Stelle der .Kathrin“ eine Wiederaufnahme der „Toten Stadt“, im Interesse b e i d e r Partner, nicht eher zu empfehlen gewesen wäre ... Daß der Komponist .in bewußter Reaktion auf Königssphäre, Mittelalter, gehobene Sprache, Todes-, Jenseits- und Auferstehungsprobleme nach einem volkstümlichen Gegenwartsstoff suchte, der Menschen auf die Bühne bringt, deren Geschicke uns nahegehen können“, ist durchaus begreiflich. Daß dagegen E. W. Korngold, der bei der Wahl seiner früheren Textbücher nicht nur eine glückliche, sondern auch eine wählerische Hand bewiesen hatte, gerade nach diesem Sujet griff, ist ebenso erstaunlich wie der Name Ernst Decseys auf dem Titelblatt dieses Librettos. Die Liebes- und Leidensgeschichte des jungen schweizer Dienstmädchens, der Kathrin, wird in sieben episch angelegten Kapiteln erzählt, deren Handlung in einer südfranzösischen Garnisonstadt beginnt, in einem Wirtshause an der Schweizer Grenze und in Marseille zum dramatischen Höhepunkt führt und, sechs Jahre später, in einem Schweizer Bergbauernhaus endet. Der Stil von Korngolds musikalischer Sprache bedarf ebensowenig einer Kennzeichnung wie sein Orchestrierungskunst und die wirkungsvolle Führung der Singstimmen. Natürlich drückt dieses Textbuch beträchtlich auf das musikalische Niveau — wie andererseits ein anspruchsvoller Text den Komponisten dazu bringt, „höher zu springen“, wie Frank Martin einmal gesagt hat. Die Volksoper hatte fast ihr gesamtes Ensemble aufgeboten: außer dreißig namentlich auf dem Programmzettel genannten Sängern noch Gruppen von Mädchen, jungen Burschen, Soldaten, Studenten, Tänzerinnen, Bargästen, Kellnern, Dienern usw. Die Titelpartie war mit Maria Reining vorzüglich besetzt; ihr Partner — Francois Lorand, Soldat und Chansonnier — war Karl Friedrich. Heinz Arnold führte Regie, Rudolf Moralt dirigierte.
