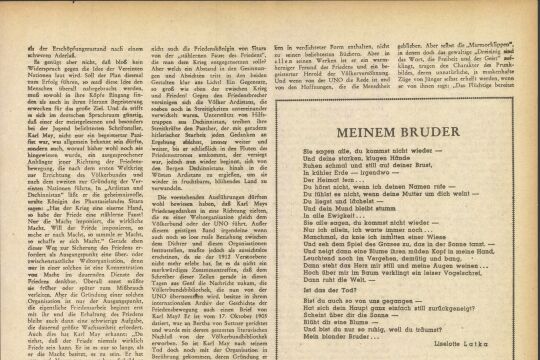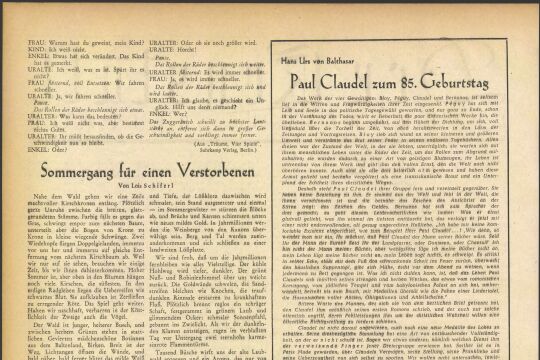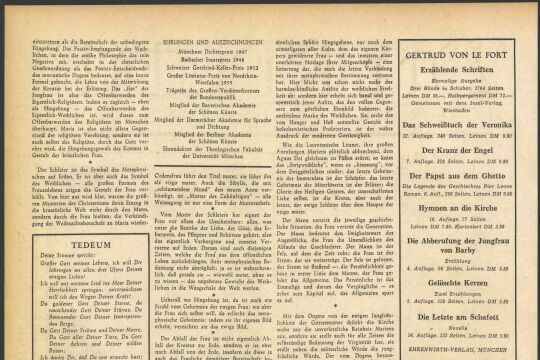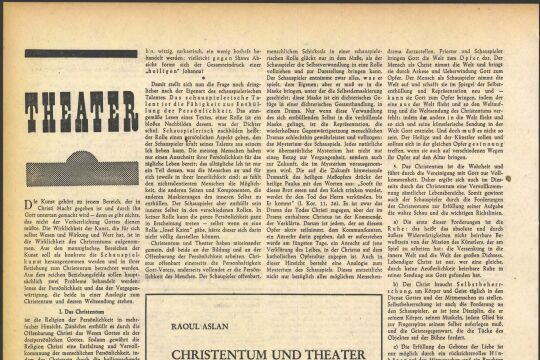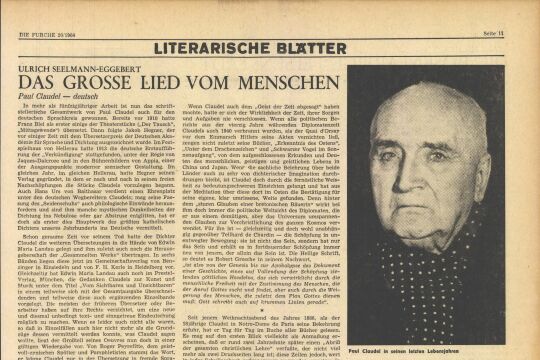Christozentrik und kühn anthropomorphe Dramatisierung des „Göttlichen Abenteuers“ in der Zeitlichkeit sind nicht die einzigen Merkmale der Claudelschen Bibelexegese. Nicht gleich auffallend, aber immerhin ständig unterschwellig und manchmal sogar vor keinem offenen Ausdruck zurückschreckend, kommen andere Leitgedanken ans Tageslicht, die eine rein menschliche Problematik illustrieren und Claudels Bibelkommentaren den Charakter einer aufregenden, aufrichtigen Konfession verleihen. Claudel hat sich bekanntlich erst am Ende der zwanziger Jahre dem eingehenden Studium der Bibel gewidmet: Er betrachtete damals sein dichterisches und dramatisches Schaffen als vollendet. Rodri- gos Demütigung und Entsagung, am vierten Tag des „Seidenen Schuhs“, bilden für den Autor das letzte Wort seiner menschlich-christlichen Aussage, den unsichtbaren Triumph der lang ersehnten, leidensvollen christlichen Freiheit der Seele, einem Kosmos und einer Frau gegenüber, deren tödliche Ambivalenz er doch schließlich durchschaut hat. Nur durch den Verzicht auf das Auge, das nunmehr nichts anderes tun darf als „horchen“; nur durch das Sich-einfügen in die Wahrnehmung der universellen „Vanitas“: nur durch die echt christliche „Umwertung aller Werte“ kann die „Ars poetica mundi“ erfaßt und verwirklicht werden. Claudel hat damals die Lehre des biblischen Qoheleth verstanden, und er ist der fruchtbaren, aber heilsamen Bedeutung des Spruchs: Quid ad aeternitatem? innegeworden.
Die Lektüre der Bibel hindert ihn aber nicht daran, ab und zu einige Stunden „ä la recherche du temps perdu“ zu verweilen. Die Bibel fordert ihn im Gegenteil sogar geradezu auf, die Vergangenheit heraufzubeschwören. Denn die Problematik der menschlichen Liebe durchzieht mehrere Seiten, sogar ganze Kapitel der Bücher des Alten Testaments. Die somatische Trennung der Geschlechter, die uns der Bericht der Genesis über die Erschaffung des Urpaares lehrt, hat Claudel zu wiederholten Meditationen inspiriert, die eine niemals vollkommen gedämpfte Sehnsucht nach einem paradiesischen Zustand der Androgynität verraten und darüber hinaus den gedanklichen Hintergrund seiner bedeutendsten Theaterstücke — Mittagswende, Der Seidene Schuh — bilden. Der Exeget unterstützt und rechtfertigt den Dramatiker; die Offenbarung bekräftigt die Erfahrung des Lebens. Der menschliche Trieb nach existenzieller Ganzheit und Einheit ist hienieden zum Scheitern verurteilt: der jetzige Zustand der Leiblichkeit und des Getrenntseins vereitelt die Kommunion. Die Liebe ist Feststellung einer verhängnisvollen Alterität und führt zur Selbstentfremdung.
Eros und Sexus wurden durch den Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen. Einerseits Ergänzung und Vollendung des Mannes, ist anderseits aber das Weib, das ihn unwiderstehlich anzieht und anlockt, für ihn auch die Erzfeindin, die ihn versucht und verführt. Mehr noch als der ganze Kosmos, der eine gefährliche Attrappe ist, stellt die Frau den Inbegriff, die prägnante Inkarnation der Ambivalenz dar. Denn durch ihre Schönheit und Komplementarität verspricht sie dem Manne das Glück der erlebten Ganzheit, die Überwindung der leiblichen und geistigen Isoliertheit, die Absolutät des existentiellen Selbstbewußtseins, die Rückkehr zum paradiesischen Urzustand, die Erlösung. Darin liegt aber eben ihre angeborene Ambiguität: ein Sakrament der göttlichen Sophia, ist sie gleichzeitig ein Werkzeug des Bösen. Sie ist also ein „Mysterium“ und die verhängnisvolle „Alternative von Gott“. Alle weiblichen Figuren des Alten Testaments, deren Schicksal Claudel in seinen Bibelkommentaren beschrieben beziehungsweise inszeniert hat, deuten auf diese unveränderliche Komplexität hin. Das berühmte Bild des Tizian „Adam und Eva“ hat seiner Phantasie mehrmals vorgeschwebt, und mitten in seinen Meditationen über das Gebet oder über die Bibel betrachtet er hoffnungsvoll, wehmütig und resigniert zugleid? das Drama der menschlichen Geschlechter, das unter dem Baum des Paradieses inittlent wurde. Evas allerletztem Blick unmittelbar vor ihrer Sünde auf den Mann, der ihr Gatte und Erzeuger ist, entspricht die zaghafte, kraftlose und schon sündhafte Geste Adams, der seine linke Hand nach der rechten Brust Evas ausstreckt, nach jenem lebenden Apfel, der mehr noch als die Frucht des Baums, die ganze Substanz des Kosmos versinnbildlicht, auf die Rodrigo, dank Prohezas Aufopferung, verzichten wird.
Noch mehr als die geheimnisvolle Prinzessin aus „Goldhaupt“, die trotz ihres Namens — „Gnade der Augen“ — weder Cebes noch Goldhaupt rettet, ist die biblische Judith, der Claudel 1928 ein bedeutendes, aufschlußreiches Gedicht widmet, das lebende Symbol der weiblichen Ambiguität. Durch ihre verführerische, zur Schau gestellte Schönheit übt sie nämlich und gleichsam im Namen Gottes eine regelrechte Erpressung auf einen Mann aus, der bei aller Roheit und Lüsternheit ein naives, unschuldiges Geschöpf ist und sein Vertrauen miit seinem Leben bezahlt. Die Claudelsche Judith ist aber gleichzeitig die Vertreterin und die lebende Inkarnation der göttlichen Sophia, die unter dieser unwiderstehlichen Vermummung dem Menschen eine einmalige Chance gibt, an der Schwelle des Todes die Wahrheit über sein Schicksal, den Sinn der conditio humana zu begreifen, im „Schwert der Gerechtigkeit“ das paradoxale Werkzeug der Liebe zu identifizieren. So mehrdeutig sind nämlich für Claudel „die Abenteuer der Sophia“: „Mit Gottes Sophia ist es nicht geraten, Scherz zu treiben Die gefährliche Sophia bedient sich der unerhörtesten Vermummungen.“ Auch in Dalila verspürt der Claudelsche Samson, allerdings zu spät, die unsichtbare Anwesenheit der göttlichen Sophia.
Am bezeichnendsten ist aber für Claudel die Doppel- bödigkeit der biblischen weiblichen Figur, über deren Sinn er am häufigsten meditiert, Betsabee. König Davids Liebesdrama hat Claudel als den Prototyp seines menschlichen, allzu menschlichen Abenteuers aufgefaßt und nacherlebt. Und in der Frau von Uri hat er das ambivalente, sakramentale Zeichen des „ewig Weiblichen“ erblicht, das durch den Abgrund der Sünde hindurch, den Menschen schließlich „hinanzieht“ und zur seelischen Befreiung führt. In Claudels Augen ist nämlich die Tatsache, daß Salomon. das uneheliche Kind von David und Betsabee, einer der Ahnherrn des Erlösers, Christus, ist, zum maßgebenden Symbol, zur prophetischen Geste geworden, und daraus hat Claudel bekanntlich eine ganze Theologie der Geschichte und der nachträglichen Sinnhaftigkeit der menschlichen Sünde her- ausgearbeitet, die im berühmten Motto des Opus mirandum — Etiam peccarta — ihren gedrängten Ausdruck gefunden hat. Betsabee ist also nicht nur und schließlich nicht wesentlich das Werkzeug von Davids ethischem Fall gewesen, sondern darüber hinaus der Anlaß seiner Bekehrung und viel mehr das vorherbestimmte Instrument einer höheren, parabolischen, prophetischen Berufung, das außerordentliche aber tatkräftige Medium der messianischen Vorsehung für die Ausführung ihres Heilsplanes in der Geschichtlichkeit.
Menschliche Freiheit und Gebrechlichkeit, Gottes Fügungen, Weisheit und Erbarmen tragen geheimnisvoll synthetisch dazu bei, aus der schablonenartigen Erbärmlichkeit eines Liebesdreieckes die exemplarische Illustration jener „Programmierung des Bösen“ und des Guten zu gestalten, die die göttlichen Computer ausführen sollen, seitdem. die Welt, unsere Welt, erschaffen wurde. „Große Männer sind lebende
Parabeln“, hat Claudel mit Bezug auf Wagner geschrieben: dieselbe Parabolik hat er aus Davids Schicksal herausgelesen und sein eigenes Leben in dieser Perspektive ausgedeutet. Daher die eigentümliche Einstellung des Claudelschen Königs David zum Weib, das ihn verführt und das er sich rechtswidrig aneignet, das ihn schließlich zu Gott zurückführt und ihn sogar zum prophetischen, zum messianischen Typ verhilft und seinem ganzen Schicksal eine exemplarische Typologie verleiht. „Der Friede ruhe auf dir, o Betsabee!“ läßt Claudel sein königliches Vorbild sagen, kurz bevor er selbst 1948 in Vézelay die Heldin der „Mittagswende“ wiedertrifft, um mit ihr endgültig Frieden zu schließen:
¡¿Der Friede ruhe auf dir, o Betsabee! Friede sei auf diesem Weib, das David durchgepflügt (labouré) und dem es endlich den Schrei abgerungen hat, der zutiefst im menschlichen Herzen verborgen ist und auf den seit dem Tage des Sündenfalls Gottes Ohr vergeblich gehorcht hatte. Traurigkeit, Melancholie, Gewissensbisse, Frustration, Demütigung, Verzweiflung, Blamage: alle diese bitteren und zerreißenden Gefühle erfährt David in seinem Herzen. Vor einigen Augenblicken, als er auf dem Gipfel des Berges der Vision in der Mittagssonne verweilte, füllte David mit seinen Augen und mit allen seinen Sinnen sich die Brust voll mit jenem unermeßlichen sichtbaren Kosmos, den Gott ihm geschenkt hatte. Nun aber ist ein Weib gekommen, das ihn bei der Hand genommen hat: ¡Inveni David servum meum!’. Nein, arme Kreatur, nicht du warst fähig, David zu finden. In dem Augenblick, in dem du glaubtest, ihn zu besitzen, zahlte er dir ein lächerliches Lösegeld. David, der echte David, das ist im tiefsten Abgrund, in Finsternis erstickend, jenes verirrte und abgeschundene Würmchen, das seine Tränen mit der Zunge wegwischt. Erst dann kann Gott, gleich einem Bildhauer, der die Vollendung seines Werkes nicht ohne Zweifel in Angriff genommen hatte, doch nun endlich den Schrei ausstoßen: Ich habe ihn, schließlich ist er doch da, Ich halte ihn! Zu guter Letzt habe ich ihn erlangt, jenen David, den ich, mir wünschte: nun ist er sich ,dessen bewußt, auf sich selbst allein angewiesen zu sein’. Über sich selbst ist er sich nun im klaren. Die Todsünde verursacht in unserer Seele, in unserem ganzen Wesen einen tiefgreifenden Schock. ,Wir leben und wir existieren in Gott1, sagt der heilige Paulus: auch ,in Gott’ sündigen wir; auch durch die Sünde entsteht zwischen Gott und dem Menschen eine personale Beziehung.“
Weder den prophetisch-messianischen noch den reuigen und bußfertigen David hat also Claudel ignoriert. Der Gläubige und der Romantiker in ihm konnten sich an der tragischen Figur des Königs nicht sattsehen, an dessen menschlichem Scheitern, an dessen überzeitlicher Sinnhaftigkeit, die der Dichter für sich selbst in Anspruch nahm. Aus einem anderen Grund aber hat Claudel diesen Assimilie- rungs- beziehungsweise Identifizierungsprozeß nicht nur akzeptiert, sondern darüber hinaus vertieft und unterstri chen: denn in Claudels Augen war von Anfang an David — und er wurde es immer mehr im Verlauf der Jahre — die paradigmatische Personifizierung des Künstlers, des Dichters, des sakralen Korybanten, der dazu fähig ist und damit beauftragt wurde, viel besser als die heidnischen Musen der 1. Großen Ode, siegreicher sogar als die Muse, die „die Gnade ist“, aus der 4. Ode, oder als die Kardinaltugenden der 5. Ode, die echte, die einzig mögliche „Ars poetica mundi“ zu verwirklichen. Die dramatische Auseinandersetzung des Dichters mit der Muse, die „die Gnade ist’", hatte damals zu keinem Ergebnis geführt: auf die Welt, auf die Besitzergreifung des sichtbaren Kosmos und des Weibes wollte er nicht verzichten. Die Spaltung zwischen der dichterischen Inspiration und der christlichen Berufung, die Unvereinbarkeit seiner aufrichtig und vollends akzeptierten ehelichen Liebe und einer immer noch in seinem Herzen lodernden Leidenschaft, die ihn zwanzig Jahre nach seiner Heirat lockt und peinigt, bereichern damals seine literarische Produktion und erschüttern zugleich sein seelisches Gleichgewicht. Erst 1925, wenn er dem „Seidenen Schuh“ den Endpunkt setzt, hat Claudel die Notwendigkeit und den befreienden Wert des Verzichts begriffen, und sein geistiges, „vergeistigtes“ Auge kann nun auf das Unsichtbare „horchen“.
Anstatt sich aber vor allem von Davids Reue und Buße inspirieren zu lassen, die doch dem König die dramatischesten Töne seiner Psalmen auf die Lippen gelegt haben, entdeckt und verwertet Claudel in seinem Prototyp andere Aspekte. Denn Claudels Seele vermag instinktiv nicht, ewig über das Geschehene nachzugrübeln: die psychische Intraversión und das „Gnotä sauton“ des Sokrates sind ihm verdächtig. Sein angeborener Hang nach Extraversión läßt ihn sich eher im Augenblick, in der Gegenwart umschauen, zur Tat übergehen, die vorhandene Situation ausnützen, um die Zukunft vorauszuahnen, vorwegzunehmen. Davids sakralem Tanz vor der Bundeslade schreibt er wohl den Sinn eines ungewöhnlichen, paradoxalen Aktes der Selbstverspottung zu, der bewußten Selbsterniedrigung, der öffentlichen Demütigung:
„Ich will mich demütigen, denn die Pyrrika, die ich ausführe, ist mir ein Mittel, den Gewinn der allgemeinen Verachtung zu erlangen. Die Erde, von der ich mich nur löse, um wieder an ihr zu haften, die Sklavenmenge, der ich ohne Zögern meine Nacktheit zur Schau stellte, sie sind es, dir mir es möglich machen, mich von der trügerischen Last meiner eigenen Wichtigkeit zu befreien.“
Es ist unleugbar, daß der zur Reife gelangte Claudel öfter versucht hat, im Bewußtsein seiner eigenen, seelischen Unwürdigkeit den Heiligenschein herabzureißen, den wohlwollende Kritiker und blinde Anhänger um seinen Kopf geflochten hatten. Claudels Lachen über sich selbst, Claudels manchmal beißende Selbstironie, der absichtlich groteske Charakter mancher seiner Theaterhelden, die unterschwellige oder ausdrückliche Komik der Bühnensituationen, in die er sie erbarmungslos, beinahe sadistisch versetzt, sind keine puren Erfindungen einer lustigen Phantasie: sie verraten die feste Absicht, endlich doch mit der sagenhaften Figur, mit dem Mythos seiner selbst Schluß zu machen und sich als atmer Sünder vor der ganzen Welt zu bekennen, durch seine „zur Schau gestellte Nacktheit die Verachtung der Menschen zu gewinnen“.
Die Hauptbedeutung von Davids Tanz vor der Bundeslade ist aber für den Dichter Claudel eine andere: denn die Selbstentäußerung der eigenen „trügerischen Wichtigkeit“ verleiht ihm die innere, vollkommene Freiheit der künstlerischen Inspiration, der schwerelosen dichterischen Trance, der verklärten Begeisterung und den Besitz der vollendeten Rhythmik, des absoluten Spiels der Lyrik und des Tanzes. Erst dann gelangt David, der „königliche Korybant“, der „göttliche Tänzer’", zur vollen Geltung: denn der „getanzte Kommentar , den der König vor der Bundeslade ausführt und erläutert, deutet viel mehr noch als der Tanz des „großen Sylphen“, Nijinskij, jener „großen menschlichen Kreatur im Zustand der lyrischen Entrückung“, auf jene Überwindung der Korporeität, auf das vollendete Freisein des vergeistigten Leibes hin, das der Wunschtraum des liebenden und dichtenden, die „wilde Hoffnung“ des gläubigen Claudel geblieben ist.
„Die Bundeslade kommt Jahwe naht heran, und Ihm voran schwingt sich der königliche Korybant empor. Er tanzt in derselben Aufmachung, in der wir ihn auf den Scheiben unzähliger Kirchenfenster sahen Ein Windstoß trägt ihn empor: um vom Tanze abzulassen, müßte er dazu imstande sein! Mit mächtigem Sprung aus den Hüften heraus reckt er sich bis zu den Sternen empor Er schießt empor zu voller Höhe, und wenn er sich von neuem der Schwerkraft überläßt, dann nicht, um sich am selben Ort wiederzufinden: die ganze Erdkugel hat sich unter seinen Zehen gedreht. Er durchbricht die Logik, hält sich nicht an die Reihenfolge, er hält die Flügel der Inspiration weit geöffnet und läßt sich plötzlich am Scheitelpunkt der Kurve fallen wie ein Stein, um unter seinen Fußsohlen die Festigkeit des logischen Prinzips wiederzufinden. Und wenn er zufällig nicht tanzt, kann man ebensowenig sagen, er schreite: sein Gang ist nur vorübergehendes Abweichen von jenem Rhythmus, den er nach und nach dem Universum mit seinen ausgebreiteten Armen aufzwingt.“
Jenseits der moralischen Erlösung und der seelischen Läuterung gelangt also der Claudelsche David durch seinen Tanz zum paradiesischen Zustand des absoluten Dichtens, des Selbsiterschaffens durch das „Mitschaffen“ mit dem „Spiel der ewigen Sophia“ an den Uranfängen des Kosmos. Denn dies ist für Claudel ein wesentlicher Aspekt der biblischen und prophetischen Aussage: Genesis und triumphale Apokalypse bilden ein einheitliches Ganzes. Die Vollendung der Askese ist lyrischer Überschwang, Herausschälen und Entfaltung der „großen menschlichen Kreatur im Zustand der lyrischen Entrückung“, überirdische Schönheit des unsterblichen Rhythmus, schöpferische Trance, existentielle Anteilnahme an der ewigen, inneren Dynamik des göttlichen Daseins und der trini- tären Circumincession.
„Wir werden nie etwas vom Wesen der Dichtung, von der Poetik der Psalmen, der Propheten oder jener lyrischen Ergießungen begreifen, die so häufig den Fluß des majestätischen Berichtes, vom ,Fiat’ der Genesis zum ,Amen’ der Apokalypse unterbrechen, wenn wir das Gefühl für diesen sakralen Tanz und für jenen Dialog mit dem Klang verlieren, das gleich einem unablässigen Rhythmus unter unserem Bewußt-sein fortlebt. Der Geist schwingt sich ungestüm auf, während unter seinen Füßen etwas weitergeht, eine Linie, eine Wegstrecke, eine Gegenwart, deren unterbrochene und wieder aufgenommene Berührung nichts anderes tut, als den Takt der Wellentäler und -gipfel zu skandieren. Oft ist es nicht nur ein einziger Ausführender, es ist ein ganzer Chor, der verschiedene Figuren ineinander verflicht, in welchen der eine dem anderen Masken,,Gleichnisse’ zureicht.“
Dieses irrationale, ästhetische Moment gehört organisch zur Claudelschen Hermeneutik, die den Rausch des dichterischen, künstlerischen, sogar choreographischen Schwungs in die rein theologischen Werte der sakralen Inspiration mit einbezieht, ihn als eine außerordentliche „Gratia gratis data“ betrachtet und ihn als solchen dem theoandrischen Prozeß der Offenbarung einverleibt. Die „Zunge“ des Psal- misten ist nicht nur „wie die Feder eines schnellen Schreibers“: die Bewegung seiner Feder auf dem Pergament ist „¡auch eine Art Tanz“. Denn der Christ selbst, der sich sei-, ner jenseitigen Berufung bewußt wird, ist ein Musiker, ein Tänzer. Der Tod ist der Ballettmeister jenes „Totentanzes“, der das ganze menschliche Schicksal versinnbildlicht und den Menschen in einen wahren Rausch der Freude und des Jubilierens versetzt. Das Mitschwingen zu den Klängen der Musik, im Takt und nach dem Rhythmus der beglückenden Vergänglichkeit, ist echt menschliche, christliche, übernatürliche Weisheit, Ethik und Ästhetik in einem. „Non impedias musieam!“‘: dies ist ein festes Denkschema der Claudelschen Weltanschauung, und in dein letzten Bibelkommentaren des Dichters hiat ihm wiederum die FUgur des „königlichen Korybanten“, David, vorgeschwebt. In ihm hat nämlich Claudel nicht nur den siegreichen Kriegsherrn „in der vollen Ausstrahlung seiner Kraft und seiner Schönheit“ gesehen und gepriesen. Viel mehr noch ist dann der Claudelsche David, der Sänger und der Tänzer, der Künstler überhaupt, der „Poeta“ par excellence: es gibt in ihm einen Gott, eine Emanation Gottes, der sich nach vollkommener Entfaltung sehnt und dem er durch den poetischen Akt, durch die Schaffung der mystischen Ode die Möglichkeit gibt, diese Geburt in einer menschlichen Seele zu erleben. Claudels durchdachte und konsequente Anthropomorphik — dichterische Phantasie und tiefer Glaube in einem — schreckt vor keinem gewagten Ausdruck zurück, und seine Theozentrik vereint sich mit einer erstaunlichen Verichlichung. Beide sind untrennbare Merkmale seiner Religion und seiner erlebten Frömmigkeit.
„Wie interessant das alles ist! sagt David. Wie schön! Wie ernst! Wie wunderdar! Die anderen Menschen sind nur Knechte, ich aber bin der König! Die anderen sind nur Vorbeigehende, ich aber bin der erdgebundene, eingewurzelte Prophet, und der Priester, der opfert und in Erkenntnis der Endursache den Daseinsgrund erkennt. Nicht genug hatte ich von all diesen Frauen, denen ich Kinder geschenkt habe, wenn es sich darum handelt, Davids Geschlecht, Daseinsgrund, Verheißung, Glauben, Hoffnung, Liebe und Gebet fortzusetzen, weiter zu erhalten und zu vermehren. Höre, Israel! Als Verwalter und Statthalter Gottes bin ich über die ganze Erde bis zum Ende der Zeiten vereidigt, um ihr Gott zu geben! Die ganze Welt wurde mir zu Füßen gelegt, auf daß nichts Gott geboren wird, wenn nicht durch David. Es lohnte sich, den Verrückten und den Gehenkten zu spielen, um den König von Geth zu ergötzen! Gott, Gott selbst hat sich selbst in meine Hände gegeben, auf daß ich Ihn besitze und verteile.
Da setzt Davids Tanz vor der Bundeslade, ein Tanz, der seither nie aufgehört hat, ein. David! Es ist die Bgeisterung, Davids Aufschrei, den unversiegbaren Schrei jener Seele, die dabei ist, sich selbst mitten in großem Wehen im Herzen des Herrn zu gebären, den könnte nicht einmal Gott selbst zum Schweigen bringen. Exsurge, gloria mea, exsurge, psalterium et cithara! Komm heraus, springe aus meinem Herzen heraus in meine Hände und Füße und stelle dich, o goldene Leier, o Bestimmung jener singenden Stimme, meiner eigenen singenden Stimme, in die Harfe herein, die die 50 Finger meiner beiden Hände umfassen! Dich habe ich doch bezwungen, o Klang! Und du, geistige Silbe, vervielfache dich gewaltig zwischen meinen Fingern! Vor mir steht meine Vision: es ist dies nicht eine Harfe. Es ist ein Bogen mit tausend Saiten, und meine Hand hat fünfhundert Finger. Fünfhundert Finger am Ende aller meiner Glieder haben sich von all dem in mir bemächtigt, was in mir Seele und Leib und Stimme und Zahl und Hören und Klang ist. Was spreche ich aber von Fingern, von der Kehle oder der Zunge? Aus meinem ganzen Wesen, von den Fersen bis zum Schädel bin ich nur vibrierende Saite, nur Aussprechen und Dithyrambus! Donner und Schlag, Schlag auf Schlag, der niederschmettert und erhellt! Donner und Donnerschlag, im Angesicht Gottes, ,Der ist’! Schlag auf Schlag, der Gott erklärt, wer Er ist.“
In der Trance des sakralen Dichters, vermischen sich untrennbar Ichbezogenheit, Weltbejahung und Gottesanbe-, tung. Losgelöst von allen menschlichen Bindungen, besitzt er die vollkommene Freiheit der „Gottessöhne“, des erlösten „neuen Menschen": das Klagelied der Großen Oden, in denen Claudel den Herrn anflehte, von seinem irdischen Ich, von der Bedingtheit des Geschöpftseins, von der Sklaverei der Freiheit, von der Zeitlichkeit, von seiner Nichtigkeit und von jener „Vergänglichkeit, der die ganze Schöpfung gegen ihren Willen unterworfen ist“, befreit zu werden, macht nun einer Entfesselung der Lyrik und der seelischen Begeisterung Platz, die den Zustand der jenseitigen Glückseligkeit vorwegnimmt und die verheißungsvolle Vision des letzten Kapitels der „Ars poetica mundi“ dichterisch-mystisch zu vollenden scheint.
Über jede literarische Gattung hinaus, wischt Claudel schließlich jedien Unterschied zwischen sakraler und weltlicher Dichtkunst hinweg und faßt alle translogischen Intuitionen und irrationalen Komponenten des künstlerischen Phänomens synthetisch auf. Die Inspiration des Claudelschen Poeta ist keine gewöhnliche katalogisierte „Gratia gratis data“, sie wird der sakralen Inspiration der biblischen Schriftsteller, des biblischen Dichters per excellence, David, gleichgesetzt. In diesem späten Rauschzustand eines Exegeten, der seiner Dichterberufung treu bleibt und kraft seiner religiösen Hoffnung die totale Erlösung des Menschen, die Losgelöstheilt der Kreatur von der Schwere der Korporeiität vorwegnimmt, erweckt Claudel, der immerhin noch 1941, als er die Apokalypse interpretierte, in den Künstlern jene „Virtuosen in der Wahrnehmung des Göttlichen“1 erblickte, die „gleichsam auf einer Harfe gekreuzigt werden, auf jener zehnsaitigen Lyra, von der in den Psalmen gesprochen wird“, schließlich doch den Anschein, endlich die irritierende Problematik der christlichen Kunst überwunden, wenn nicht aufgehoben zu haben. In David glaubte er den Typ des menschlichen, kosmischen und sakralen Dichters in einer Person verwirklicht zu betrachten, ihn existentiell vollendet mit- urud nachzuerleben.