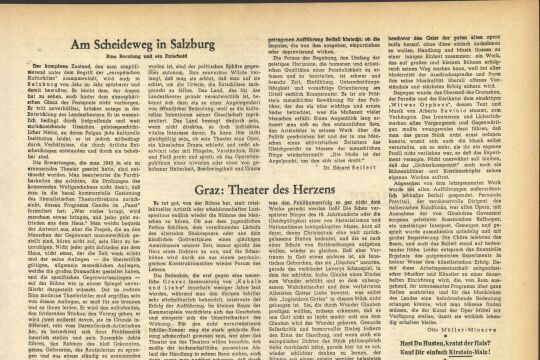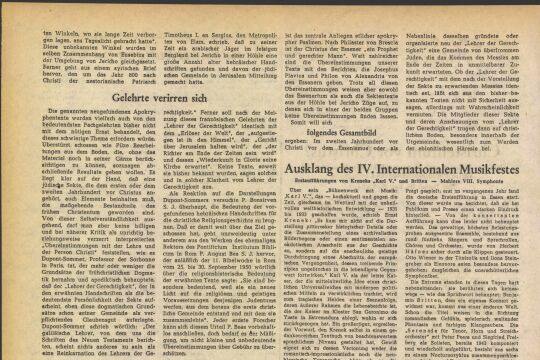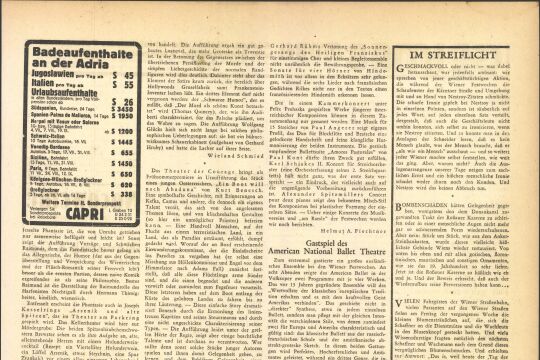Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Poppea, Mavra, Laura
Es ist ein seltener, darum um so willkommenerer Anlaß, wenn der Rezensent einmal über einen großen Abend der Staatsoper berichten kann, über ein bedeutendes Werk, eine Modellinszenierung und eine vorzügliche Besetzung. Claudio Monteverdis großes Musikdrama „L'Incoronazione di Poppea“, vor mehr ab drei Jahrhunderten entstanden, behandelt eine Episode aus der römischen Geschichte, die sich vor genau 1900 Jahren abgespielt hat: die öffentliche Sanktionierung von Neros Liebe zu Poppea und die Verstoßung seiner legitimen Gemahlin, der Kaiserin Ottavia. Über Monteverdis Größe und seine fundamentale Bedeutung in der Musikgeschichte, speziell als Begründer des Musikdramas, ist an dieser Stelle wohl nichts nachzutragen. Dagegen soll wenigstens die Vorzüglichkeit des Dramas von Busenello hervorgehoben werden, das Monte verdi sich zum Libretto wählte: seine Logik, Dramatik und Klarheit, nicht zuletzt die Lebendigkeit und die scharfe Profilierung der einzelnen mitagierenden Gestalten (Poppeas ehemaliger Gatte Ottone, die in diesen verliebte Drusilla, der Philosoph und ehemalige Lehrer Neros Seneca, der dem Tyrannen seine Willkür vorwirft und der sich auf Neros Befehl selbst tötet, und andere). In dem wenigen, das erhalten und in fragmentarischen, umstrittenen Fassungen auf uns gekommen ist, erweist sich Monteverdis Partitur (in der nur die Singstimmen und das Baßfundament notiert sind) als wahrhaft genial und lebendig, von adeliger Schönheit und magischer Anziehungsgewalt. So ist es erklärlich, daß neben seinem „Orfeo“ die „Incoronazione di Poppea“ immer wieder Bearbeiter gefunden hat, angefangen von Vincent d'Indy und Francesco Malipiero über Ernst Krenek (um nur die schöpferischen Musiker zu nennen) bis zu Erich Kraack, der im Auftrag des Regisseurs Günther R e n n e r t und des Dirigenten der Aufführung, Herbert von K a r a j a n, die freieste uns bekannte Bearbeitung geliefert hat: als Klangregisseur, wie er sich selbst bezeichnet, und Komponist.
Die musikalische Neufassung von Herrn Kraack ist sehr modern, sehr farbig und von hohem Reiz. Das Schwergewicht liegt wie zu Monteverdis Zeit bei den Streichinstrumenten, zu denen ein Holz- und ein Blechbläserquintett nebst Cembalo und Harfe treten. So modern und farbig das Orchester von Herrn Kraack klingt, so sicher und geschmackvoll bewegt er sich in dem abgesteckten Klangraum: Man hört den ganzen Abend lang nichts Grobes, Banales, Dürres oder Süßliches. Günther R e n n e r t hat mit dieser Inszenierung eine Meisterleistung vollbracht. Seine Spielführung hat ebensoviel Schwung wie Linie und läßt im Verein mit der modernisierten Musik Monteverdis nie jenes Gefühl gepflegter Langeweile aufkommen, das die meisten Aufführungen vorklassischer Bühnenwerke begleitet. Lediglich das erste Bild des zweiten Aktes (Nero feiert mit seinen Kumpanen den Tod Senecas) ist dem Regisseur zu sehr als teutsche Saufszene geraten, die allenfalls in die „Carmina Burana“, aber nicht in die immerhin kaiserliche Welt der „Poppea“ paßt. Auch Stefan H1 a w a, den wir immer als einen erstklassigen Künstler eingeschätzt haben, kann man zu seiner szenischen Lösung beglückwünschen. Der „Grundplan“ seines Bühnenbilds besteht aus einem frei gestalteten zweistöckigen römischen Halbrund mit je fünf Portalöffnungen in jedem Geschoß, in die, je nach dem Schauplatz der Handlung, verschiedene Versatzstücke und Requisiten (sehr wenige zum Glück) hineinpraktiziert werden. Auch hält der schöne Innenraum eine sehr glückliche ästhetische Mitte zwischen Antike und Renaissance. Das gleiche gilt für die vielen prächtigen Kostüme Erni Knieperts. Nur bei der Garderobe der Drusilla hat sie ihr guter Geist ein wenig verlassen. Und ein Gärtnerpaar, das da plötzlich auftaucht, scheint sich aus einem Schäferspiel des Dix-huitieme in die Monteverdische Kaiseroper verirrt zu haben.
Auf der Bühne aber war Licht, stundenlang Licht, was man nach so vielen dunklen Aufführungen ganz besonders genoß. Herbert von K a r a j a n und die P h i Iharmoniker musizierten mit großer Noblesse und brachten die großartig-elegische Musik Monteverdis, wie sie uns Erich Kraack aus den wenigen spärlichen Zeilen des Originals herausgezaubert hat, mit vollendeter Kultur zum Klingen. Auf der Bühne agierte und sang ein Ensemble, wie man es selten beisammen findet, jeder an seinem Platz, keiner überfordert: Sena J u r i n a c in der Titelrolle und Gerhard Stolze als Nerone, femer die Damen Lilowa, Janowitz, Rössel-Majdan und Mil-jakowicz sowie die Herren Wiener, Cava, Dickie und Frese.
Der österreichische Rundfunk hat die Premierenaufführung vom Montagabend aufgenommen, und wir können unseren Lesern sehr empfehlen, sie sich am 10. April um 30.15 Uhr im II. Programm anzuhören.
Gemeinsam mit dem Österreichischen Rundfunk veranstaltete die Akademie für Musik im Großen Sendesaal einen Opernabend. Zwei Einakter, wie sie — trotz der korrespondierenden Untertitel „Buffooper“ und „heitere Oper“ — kaum gegensätzlicher gewählt werden konnten, standen auf dem Programm. Strawinsky schrieb seine Buffa „M a v r a“ (nach Puschkin) im Jahre 1922 und konnte sie noch im Juni des gleichen Jahres durch das Ensemble des Russischen Balletts (das ja auch Sänger umfaßte) in der Pariser Oper uraufgeführt sehen. Die Handlung: Ein junges Mädchen, Parascha, empfängt ihren als Köchin verkleideten Verehrer, einen Husaren, den sie der Mutter gegenüber „MavTa“ nennt. Aber als Mutter und Tochter, sehr zur Unzeit, von einem Spaziergang zurückkehren, rinden sie Mavra gerade beim Rasieren. Dem durchs Fenster Entspringenden ruft Parascha angstvoll „Basil, Basill“ nach... In der unterhaltsamen, bald trocken-sarkastischen, bald gefühlvoll-melodiösen Musik Stra-winskys sind Elemente der klassischen russischen Oper, der italienischen und der Zigeunermelodik mit solchen des Jazz der zwanziger Jahre verbunden. Die Singstimmen sind auffallend kantabel geführt, die Tonart ruht auf festem Baßfundament, und die Rhythmik ist relativ einfach. Es gibt keine Rezitative, sondern nur Arien und Ensembles; dem Songstil von Kurt Weill ist Strawinsky hier näher als in irgendeinem anderen Werk. Trotz dieser Erleichterungen (die für eine Schüleraufführung nicht hoch genug einzuschätzende Vorzüge sind) war es erfreulich und im höchsten Grad respektabel, wie sich die vier jungen Sänger, Studenten der Wiener Akademie, Wendy Fine (Südafrika), Mihoko Aoyama (Japan); Suze Leal (Türkei) und Richard Turner (USA), ihrer Aufgaben entledigten.
Das Wunderkind Erich Wolfgang K o r n g o 1 d, 1897 in Brünn geboren und schon durch seinen zweiten Vornamen zum Komponisten prädestiniert, trat bereits elfjährig mit einem Ballett („Der Schneemann“, dessen Musik allerdings Alexander von Zemlinsky instrumentiert hatte) vor die Öffentlichkeit. Der Fünfzehnjährige schrieb nach dem Lustspiel des H. Tewels (hinter dem man wohl den Vater des jungen Komponisten, den bekannten Wiener Musikkritiker Julius Korngold, vermuten darf) die heitere Oper „Der Ring des Polykrates“. Schauplatz der primitiven Handlung ist eine kleine Residenz. Zwei Paare, der junge Hofkapellmeister und seine Gattin
Laura, der Paukist und Notenkopist Florian und seine Braut Lieschen, die sich ihres vollkommenen Glückes rühmen, werden durch einen alten Freund, der von einer langen Reise zurückkehrte, dazu gebracht, sich am Opferwillen des Polykrates ein Beispiel zu nehmen und ihrem Glück etwas zu opfern: dessen Sicherheit, indem die Männer die Frauen inquirieren: „Hast du mir nichts zu verbergen? Hast du vor mir geliebt?“ (Eine in dieser Formulierung allerdings doppelt schwer zu beantwortende Schicksalsfrage!) Einfacher hat es schon der weitgereiste Hausfreund, der auf die Frage „Hast du Frau, hast du Kinder?“ replizieren kann: „Das minder.“ Im Lauf des Stückes geht es mit der Reimerei rapid abwärts bis zu den Zeilen „Am schönen Donaustrand — winkt mir die kleine Hand“. Für solche Stellen gibt es allerdings auch in der Musik Entsprechendes — in dieser Partitur, die übrigens vom jungen Korngold bereits selbständig fertiggestellt wurde, und die am stärksten von Richard Strauss, aber auch von Wagner und Lehar (oder ist es Wahlverwandtschaft?) beeinflußt erscheint. Im Konversationellen und an allen Stellen, wo die Musik flott und humoristisch sein soll, wirkt sie häufig banal und wie aus zweiter Hand. Aber die großen lyrischen Partien, Liebesmonologe und -duette zeigen in Duktus, Klang und Uberschwang, die unverwechselbare Handschrift einer fast genial zu nennenden Begabung. Auch hier wieder, in freilich für die Singstimme wesentlich dankbareren Partien (Korngold versteht es ausgezeichnet, sangbar zu schreiben), haben sich fünf junge Künstler glänzend bewährt: Dimitrios Angel idis (Griechenland), Aida Poj (Südamerika), Horst Weinitschke und Jörgen Prosser (Österreich). Man muß den Initiatoren und künstlerischen Leitern dieses Abends für die interessante Ausgrabung wirklich dankbar sein: Herrn Prof. Gottfried Kassowitz als Dirigenten und Doktor
Der Freiburger Generalmusikdirektor Hans Gierster leitete als Gastdirigent der Wiener Staatsoper zwei Aufführungen: „Die Zauberflöte“ im Theater an der Wien und „Elektra im grofjen
HaUS am Ring Zeichnung von Irma Schul
Hans Sachs als Regisseur. Das große Wiener Rundfunkorchester spielte die Musik Strawinskys kühl und präzis, die Korngolds mit allem sonoren Tremolo — wie es sich gehört.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!