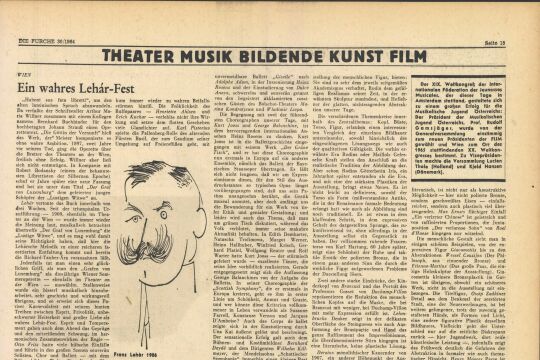Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Salome“ und „Don Quixote“
Genau ein Jahr nach der Premiere von Wieland Wagners Inszenierung von Straussens ,JSalome“ fand in der Wiener Staatsoper wieder eine „Salome“-Aufführung statt. Wieder sang Anja Silja die Titelpartie. Aber diesmal stand „In memoriam Wieland Wagner“ auf dem Theaterzettel... Dem späten Einzug des Wagnerenkels in die Wiener Staatsoper — zehn Jahre nach seinem ersten Bay- reuther „Parsifal“ — begegnete man hierorts kritisch und mißtrauisch. Aber schon ein Jahr später schaut man anders auf sein Werk: als auf das eines Frühvollendeten, der das Andere, ja das ausgefallen und abseitig Erscheinende nicht aus Originalitätssucht oder um des Effektes willen suchte, sondern der stets von künstlerischen Gründen und tiefenpsychologischen Einsichten geleitet wurde und der ein logisches Konzept mit starker und sicherer Hand auch zu realisieren imstande war, als Bühnenbildner ebenso wie als Musiker und Regisseur.
Und wieder beherrschte An ja Silja von ihrem ersten brüsken Auftreten, da sie wie ein Pfeil auf die Bühne fliegt, bis zum letzten Takt die Szene: verführerisch schön, faszinierend in Ruhe und Bewegung, mit genau durchdachter Gestaltung der schwierigen Partie, mit unfehlbarem Geschmack auch im Gewagten, im Ausdruck ausgeglichener, aber nicht weniger intensiv als beim ersten
Mal, dafür aber stimmlich gereift und mit strömendem Wohllaut singend. Ältere (und kritische) Opernbesucher beteuern, daß seit den Tagen der jungen Jeritza eine solche Salome nicht mehr gesungen und gespielt worden sei... So gerieten ihre durchweg vorzüglichen Partner ein wenig in den Schatten dieser ungewöhnlichen Leistung: Gerhard Stolze und Astrid Varnay (Herodes und Herodias), Günther Nöcker — Jochanaan und Waldemar Kmentt — Narraboth. — Am Pult stand Andrė Cluytens. Das bedeutet eine erstklassige, ebenso sensible wie präzise und klangschöne Realisierung der Strausschen Meisterpartitur.
Uber den letzten mit Spannung erwarteten Ballettpremierenabend der Staatsoper könnte man eine kleine Broschüre verfassen — oder aber man faßt sich kurz und beschränkt sich auf einiges Grundsätzliches. Auf dem Programm stand das fast 100jährige Ballett „Don Quixote“, das Marius Petipa auf die Musik des in Wien geborenen Petersburger Hofballettkompositeurs Ludwig Minkus schuf. — In einem seiner großen Romane sagt Balzac einmal von einem jungen Mädchen, es sei „sehr lieblich, aber dumm wie Ballettmusik“. Dabei mag er an Minkus und seine ungezählten, fingerfertigen Partituren gedacht haben. Und in der Tat: diese unprofilierte, langweilige, jede Inspiration entbehrende Musik zweieinhalb geschlagene Stunden lang anzuhören, ist nahezu unerträglich — besonders wenn man weiß, daß es — falls schon unbedingt der berühmte Schelmenroman des Cervantes ver- tanzt werden muß — bessere, neuere Partituren dazu gibt, etwa von Petrassi (für Aurel von Milloss), Leo Spiess (für Tatjana Gsovsky) und von Nicolas Nabokov (für Balanchine), welche letztere seit über einem Monat en suite in den USA gespielt wird.
Es zeugt von keinem wählerischen Geschmack und von geringer künstlerischer Einsicht, wenn Rudolf Nurejew diesen alten Ladenhüter vorholte, dem auch die Bearbeitung von John Lanchbery keinen neuen Glanz verleihen konnte (eine Aufgabe übrigens, an der vielleicht sogar ein Strawinsky gescheitert wäre). Das Malheur Nurejfews, der das Ballett von Petipa und Minkus inszenierte und neu choreographierte, besteht darin, daß er die während der letzten zwanzig Jahre florierende Renaissance des klassisch-romantischen Balletts im Sinne einer geistlosen Restauration mißverstanden hat. Alter Wein in alten, brü-
chigen Schläuchen — das will uns heute nicht mehr schmecken, zumal wir während der letzten Jahre an der Wiener Staatsoper unter der Leitung Aurel von MiUoss’ eine lange Reihe moderner und klassischer Ballette gesehen haben, die den höchsten Ansprüchen genügen konnten und in denen, soweit sie auf älterer Musik basierten, das Neue sowohl in der Choreographie wie in der Ausstattung zu seinem Recht kam. — Überdies wurde die Chance versäumt, in den ohnedies konservativen Spielplan der Wiener Staatsoper via Ballett wenigstens einen Abend lang Zeitgenössisches einfließen zu lassen.
Doch nun zu den Positivs dieses langen, wenig unterhaltsamen Abend: Rudolf Nurejew, der die Hauptrolle tanzte, ist auch als Barbier Basil noch ein Fürst, ja ein König der Bühne. Sein Exterieur, seine Haltung, seihe Technik und seine fast hundertprozentige Sicherheit qualifizieren ihn als einen der besten, wenn nicht gar als den besten Tänzer, den es gegenwärtig gibt. — Michael Birkmeyer hat leider in der Titelpartie nicht viel mehr zu tun, als in donquixotesker Haltung und Kostümierung immer wieder über die Bühne zu stelzen. Dagegen ist die Partie der Kitri, der schönen Tochter des Wirtes Lorenzo, ausgiebig und ergiebig. Ully Wührer wußte als Partnerin Nurejews alle ihre Chancen wahrzunehmen. Ihre Technik, ihre Anmut und ihre Sicherheit machten starken Eindruck. In kleineren Partien, aber mit den gleichen Qualitäten, brillierten Christi Zimmert, Lisi Maar, Dietlinde Klemisch, Irmtraut Haider und Susanne Kirnbauer. Sie alle, die übrigen Solisten und das Corps de ballett schienen sich bei der Musik von Minkus recht wohl zu fühlen (wohl ihnen!) und tanzten mit Elan, sichtlichem Vergnügen und bemerkenswerter Präzision. Nur die Standfestigkeit der meisten läßt noch zu wünschen übrig. — Von auserlesener Farb- schönheit waren die Kostüme und die Bühnenbilder des jungen Australiers Barry Kay (der während der Wiener Festwochen auch das von Nurejew choreographierte Tancredi- Ballett von Henze und Csobadi ausgestattet hat). Doch war sein ästhetisch stilisierter Realismus dem Sujet nicht recht angemessen, und für die Evolutionen der Tänzer ließ die Bühne oft zu wenig Raum. Der Dirigent Lanchbery mühte sich am untauglichen Objekt. Aber das Publikum war begeistert und die Galerie schrie vor Vergnügen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!