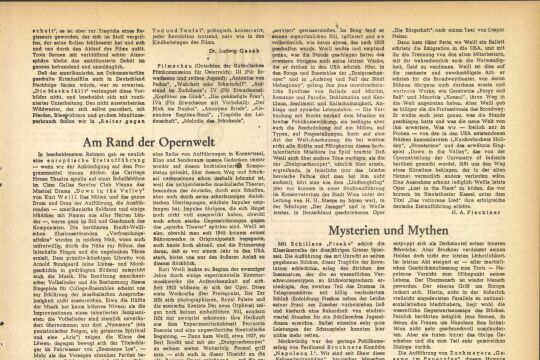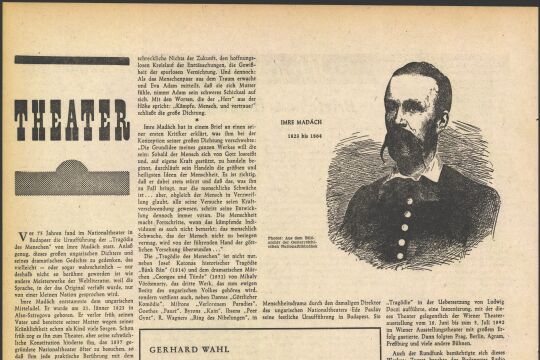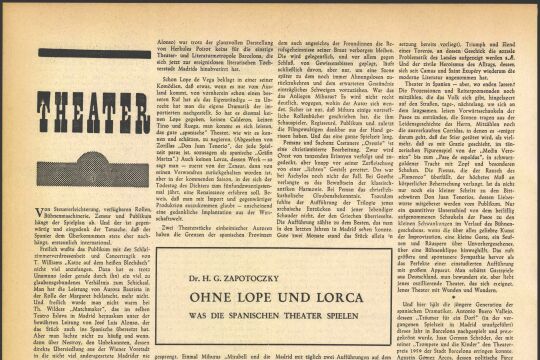Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Schiller und Sophokles
Schiller brauchte ein Dutzend Briefe über „Don Carlos“, um sich durchzuringen zu dramaturgischer Klarheit für den kühnen Entwurf, politisches Drama und menschliche Leidenschaft, Eros und Weltrevolution sich aneinander steigern zu lassen. In diesen Selbstkommentaren leistete Schiller gleichsam ins unreine jene „Riesenarbeit der Idealisierung“ nach, die den Regisseuren immer von neuem aufgegeben bleibt. Gustav Manker hielt sich in seiner Bearbeitung für die Neuinszenierung im Theater in der Josefstadt („der Intimität und Begrenzung dieses Theaters nachgebend“) an Schillers ursprüngliche Absicht, kein politisches Stück, sondern „ein Familiengemälde aus einem königlichen Hause“ zu lie fern. Nur daß Schiller im Lauf der lang aich hinzielienden Arbeit das Stück ausweitete, von Gefühlsverwirrung und Liebeshandlung, die im begrenzten Kosmos sich hätte ausrasen können, zum weit ausgreifenden Gegenspiel geschichtlicher Mächte. Wohl sollte das Drama den „enthusiastischen Entwurf“ (1783!) eines politisch glücklicheren Zustandes im Konflikt mit dem heftigsten Eros zeigen, doch aus dem Kampf um das Recht der Liebe wurde eine Auseinandersetzung um die Grundlagen aller Macht und Herrschaft.
Durch radikale Streichungen namentlich in den letzten beiden Akten und Änderung des Schlusses (Carlos erdolcht sich, um nicht dem Großinquisitor ausgeliefert zu werden) kam eine streckenweit kam- merspielhaft intime, jedenfalls unmonumentale und antipathetische Inszenierung zustande, die das schwierig verknotete Bündel aus Einzeldramen auf im Grunde nur eine menschliche Tragödie reduziert. Dementsprechend auch die Bühnenbilder von Roman Weyl, die nichts vom traditionell funebren Pomp des Escorial zeigen. Umrisse und Fluchtlinien dieses umstrittenen Regiekonzeptes kennzeichnen eine Grenze heutiger Schiller-Auffassung. Sie wäre noch diskutabel, stimmte die Besetzung. Da aber zeigen sich Unzulänglichkeiten. Lediglich Michael Heltau spielt aus idealistischem Überschwang, wenn auch nicht den Entbrannten, der sein Zeitalter in die Schranken fordert. Aber schon Gerd Seid als Posa agiert, mimisch und gebärdenmäßig unbeherrscht, ohne von einer neuen Ordnung des Menschen, des Staates überzeugen zu können. Erich Freys Philipp läßt die düstere Größe des Monarchen, der ein Weltreich regiert, nur als Schatten hinter sich aufscheinen; er ist mehr der eifersüchtige alte Mann, dessen schwankendes Gemüt bald in Gram, bald in Härte umschlägt. Ella Büchi wirkt als Elisabeth nüchtern, kühl und ohne die schöne Energie, die den ganzen Part der Königin durchstrahlen müßte, während man der Eboli von Eva Kerbler den Aufruhr der Gefühle glaubt. Leopold Rudolfs grabeskühler Kardinal-Inquisitor beeindruckt durch die Plastik seiner „toten“ Sprache. Michael Toost (Domingo) und Fritz Schmiedel (Alba) bleiben farblos.
Unwillkürlich dachte man an Sellners „König Ödipus“ im Burgtheater, an Wotrubas zyklopisches Szenenbild und Rudolf Bayrs
Sophokles-Übersetzung und kam aus dem Staunen dann nicht mehr heraus. Was uns nämlich das Schauspiel des Slowakischen Nationaltheaters aus Preßburg während seines Gastspieles im Volkstheater geboten hat, war eine Antike, in der das in den Mythos eingebaute Menschliche mit Hilfe der Schauspieler bis zum schlechterdings Ergreifenden geriet, ohne daß, wie sonst immer, etwas Statuarisches, etwas undurchsichtig Starres zurückblieb. Julius Päntik, der überragende Darsteller des Oidipus (wie sie ihn anspnechen) war kein hoheitsvoll-tragischer Held, sondern ein slawischer Fürst, hart und leidenschaftlich bewegt, dem man die Lösung der Rätsel, die Herrschaft über Theben, die Unerbittlichkeit mehr glaubte als die Ergebung ins Leiden als des Menschen eigentliche Bestimmung. Regisseur Jozeį Budskyließ auf fast kahler, seltsam archaisch anmutender Bühne spielen, über der lediglich ein Riesenmedaillon mit dem Bildnis Apolls hing und wo einige rohgewalzte eiserne Schemel als Sitze dienten. Es gab keinen Chor, sondern nur wenige Handelnde, die, wenn sich die Szene ins gespenstische Fahle verwandelte, ihre an der Brust hängenden weißen Masken vorsetzten und so ihre individuellen Züge verloren. Die Chorpartien selbst drangen als Stimmgewirr aus den Lautsprechern: litaneiartiges Gemurmel, bis zum Gesang heraufgehobenes Sprechen, klagelautgebende Singstimmen und sogar Hohngelächter.. Bemerkenswert, daß der blinde Seher Teiresias kein abgeklärter, von seinen Gesichtern gepeinigter Greis war, sondern ein zorniger, streitbarer alter Mann, daß der Bericht des Dienens über den Selbstmord der Jokaste und die Blendung des Ödipus fast komisch unterspielt anmutete. Wie überhaupt der Text der Übersetzung merklich unpathetisch klang und Feierliches mit Trivialem zu mischen schien. Es gab stürmischen Beifall für einen großen Theaterabend.
In „Antigone und die anderen“ des Slowaken Peter Karvas begräbt das Mädchen Anti gemeinsam mit anderen Häftlingen des Konzentrationslagers entgegen dem strikten Verbot der SS-Schergen einen Toten. Der Autor, von sichtlich bestem Willen geleitet, überfrachtet das in Schwarz-Weiß-Manier gehaltene
Stück mit etwas zuviel Lyrik, was den dramatischen Ablauf hemmt. Uns scheint, als sei das Thema in Hochhuths kurzer Novelle „Die Berliner Antigone“ dichterisch packender und gültiger gestaltet worden. Dem Ensemble des Volkstheaters gelang unter der Regie von August Rieger und mit Erika Mottl als Anti eine eindrucksvolle Aufführung, die ihre Wirkung in den Außenbezirken nicht verfehlen wird.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!