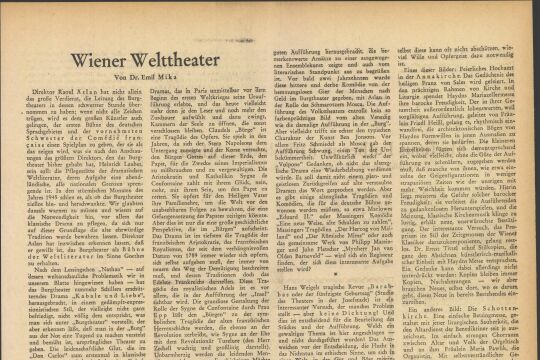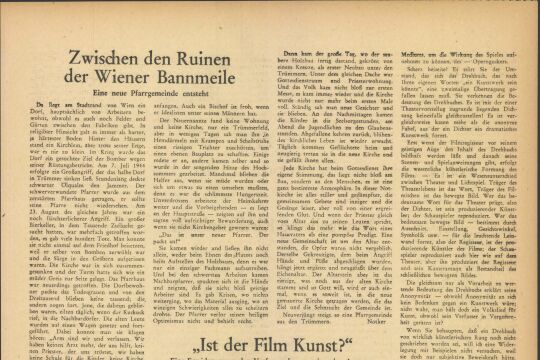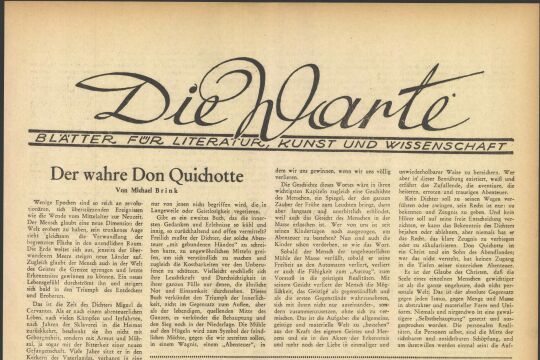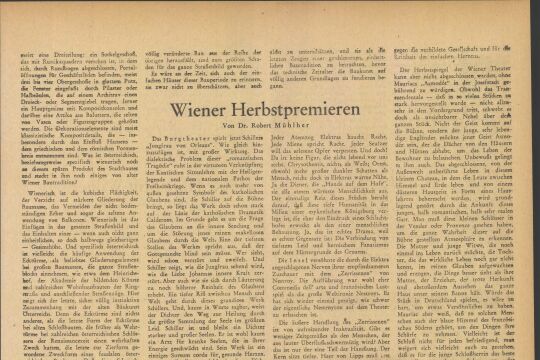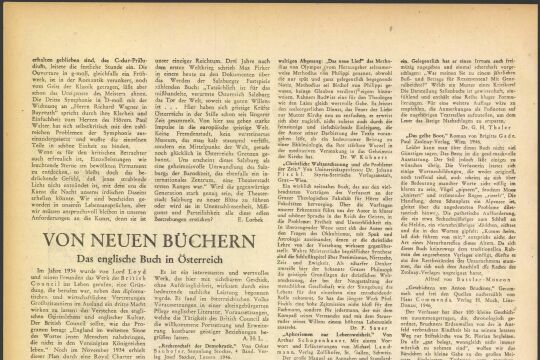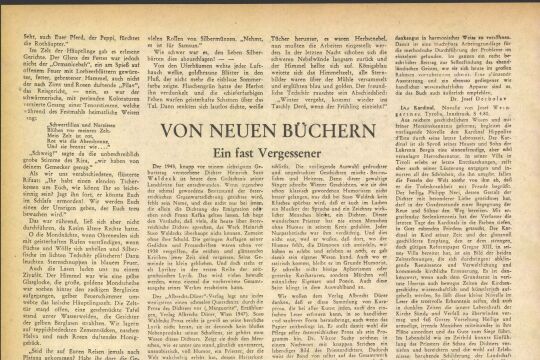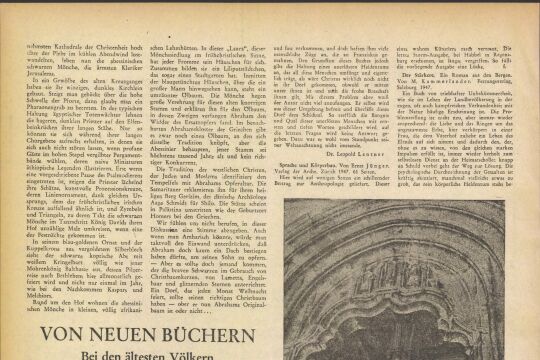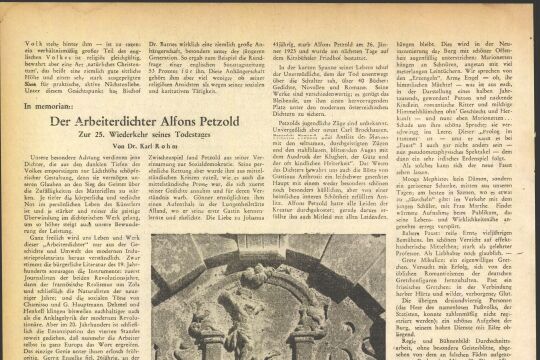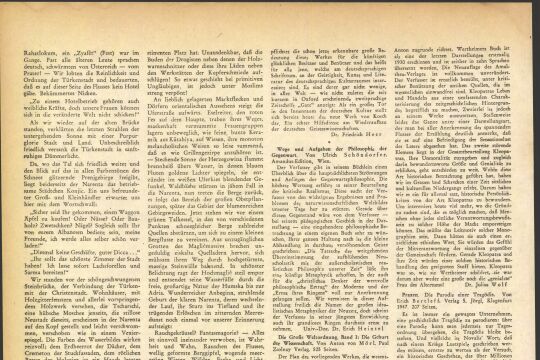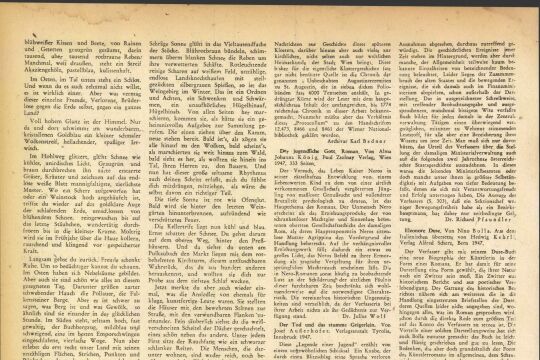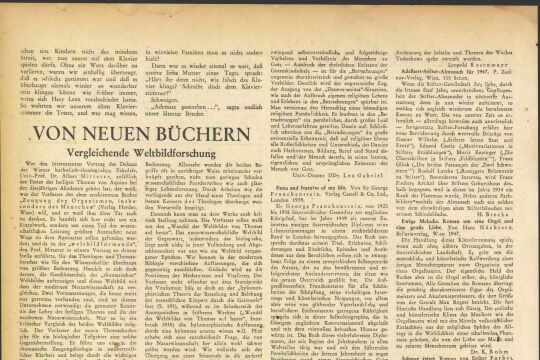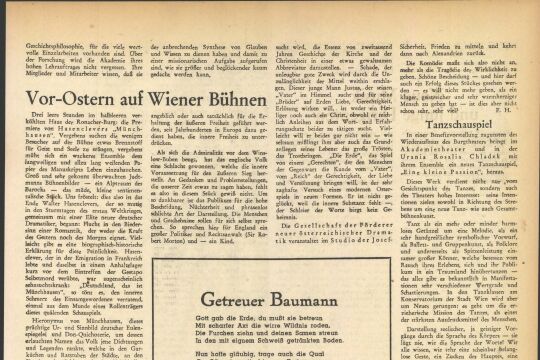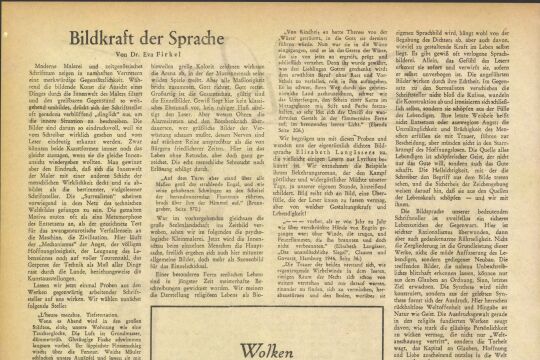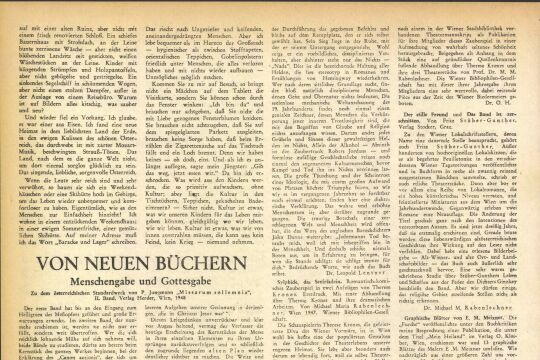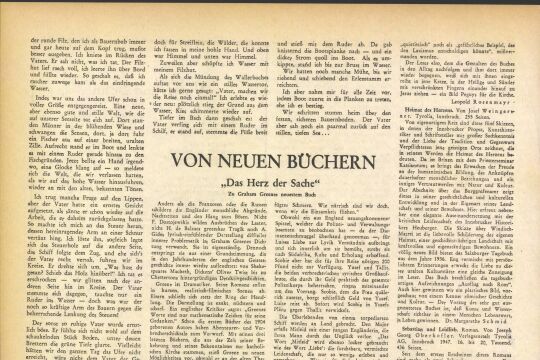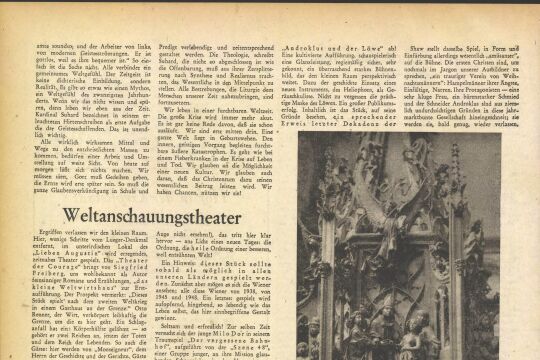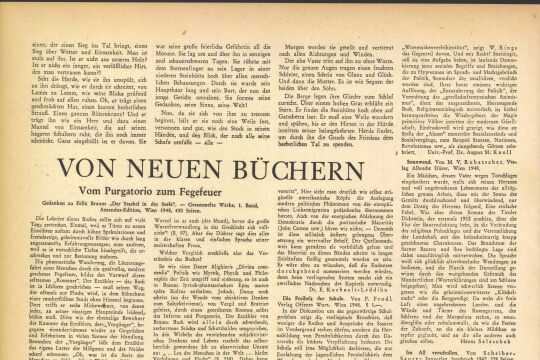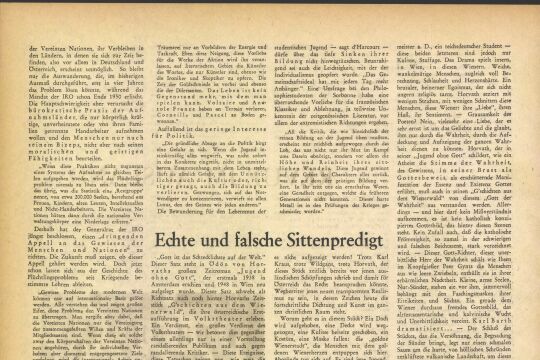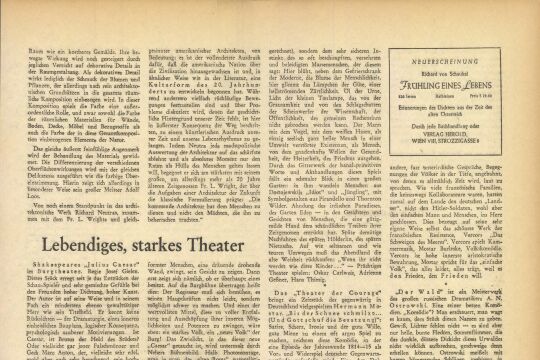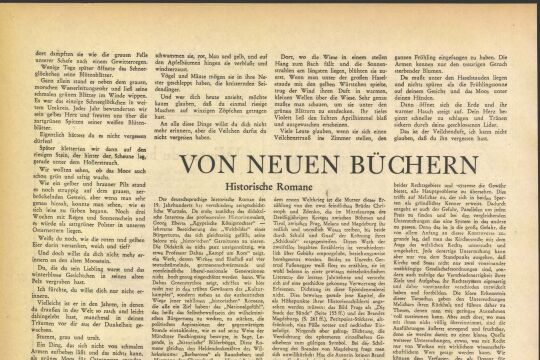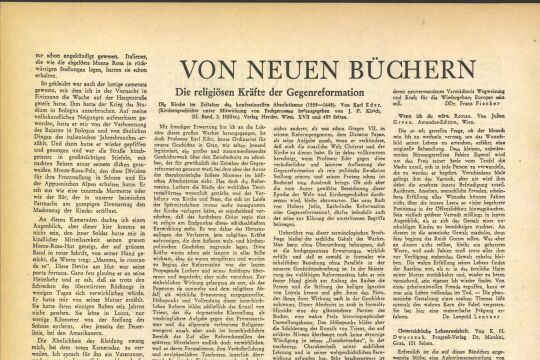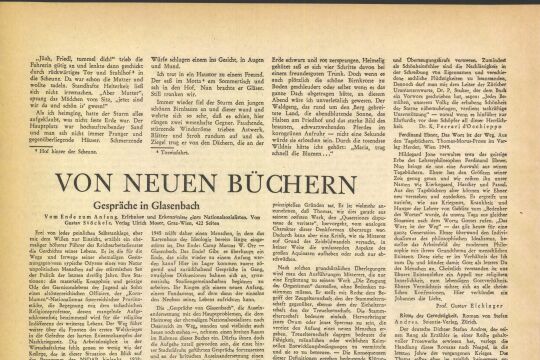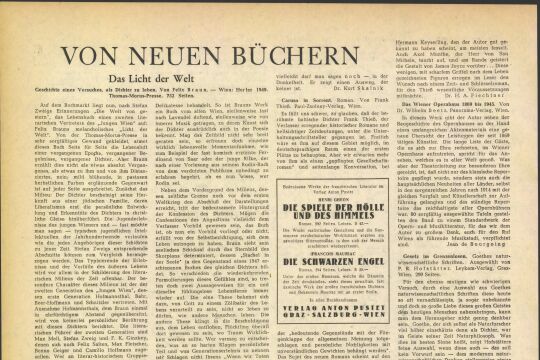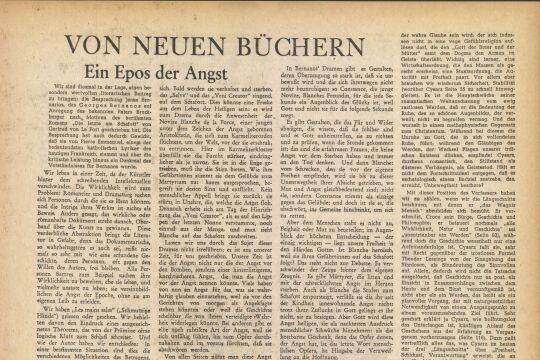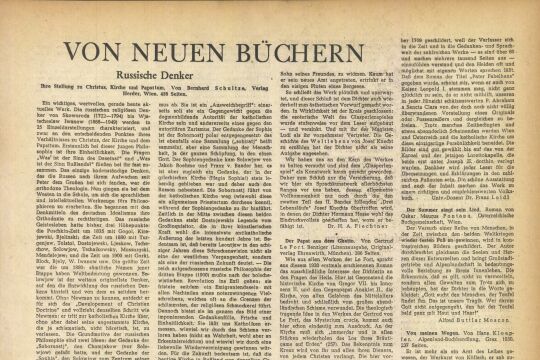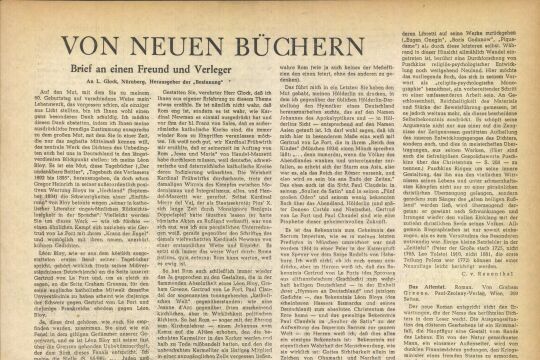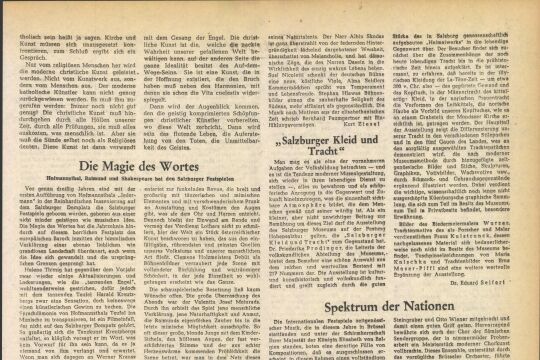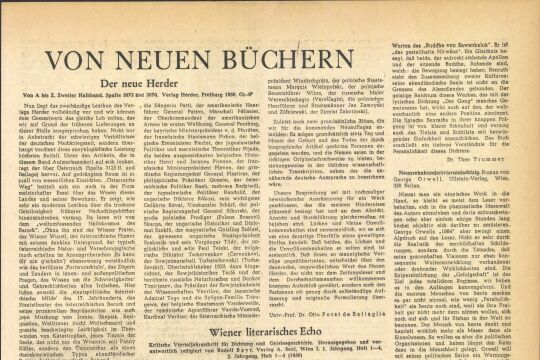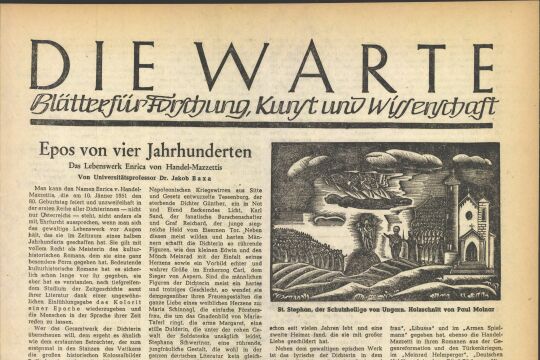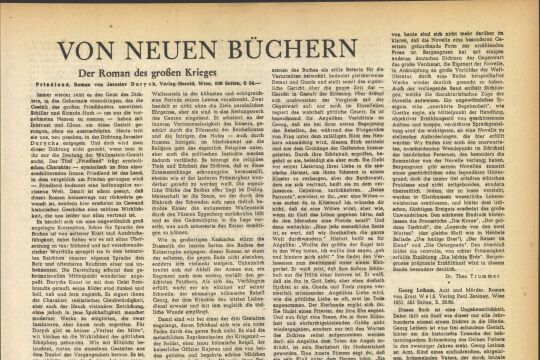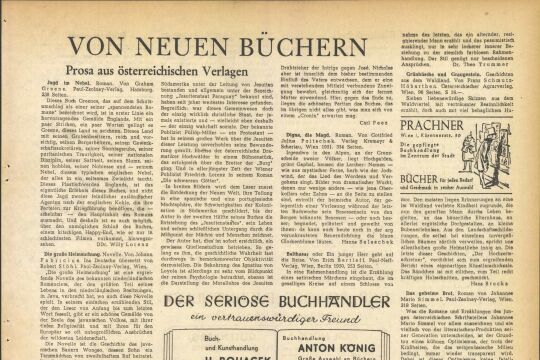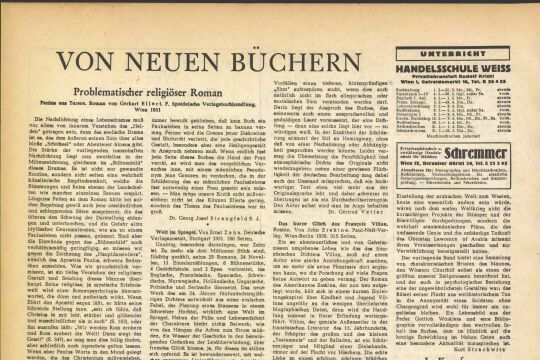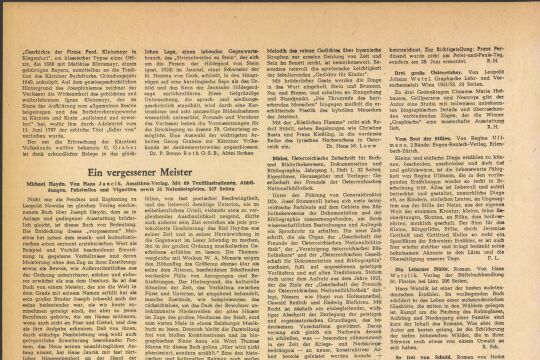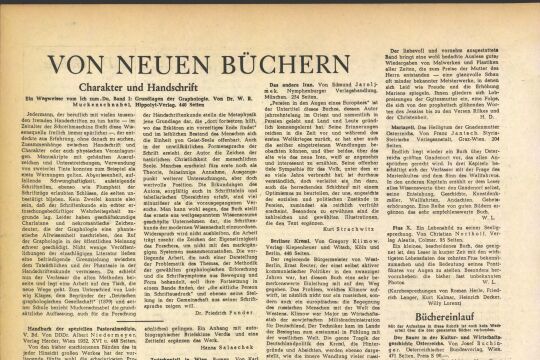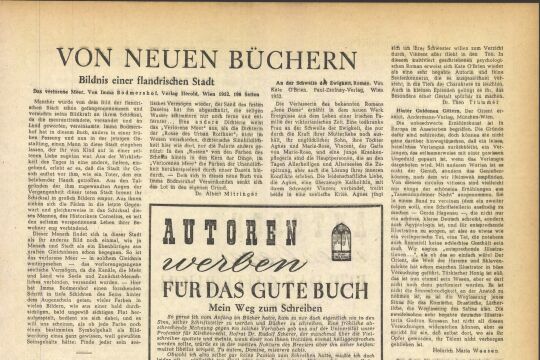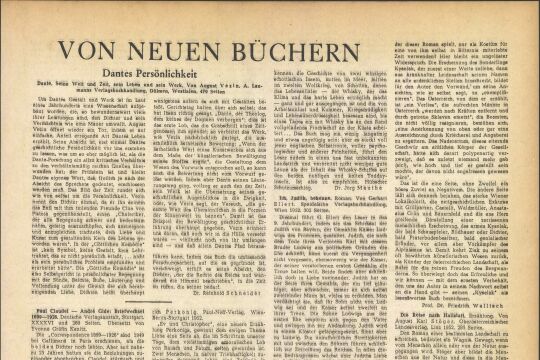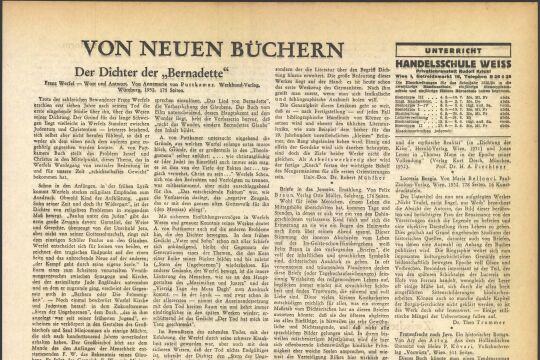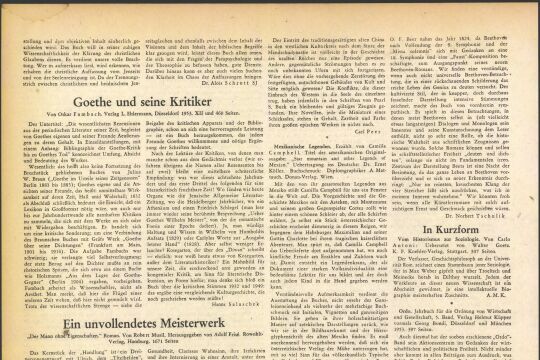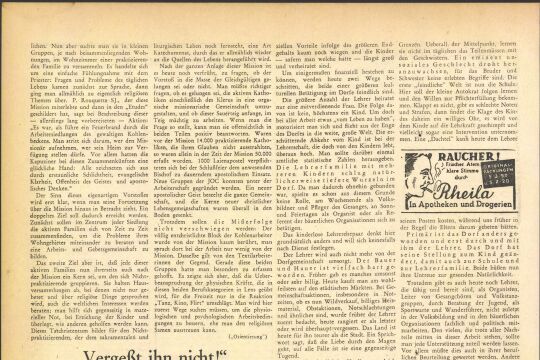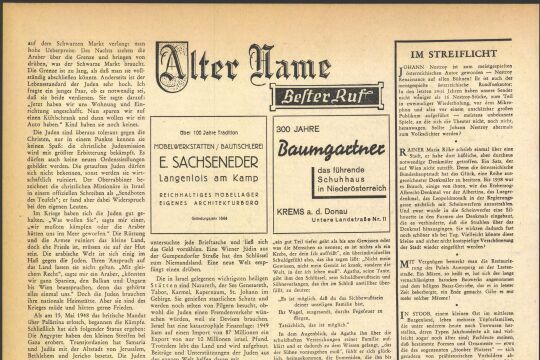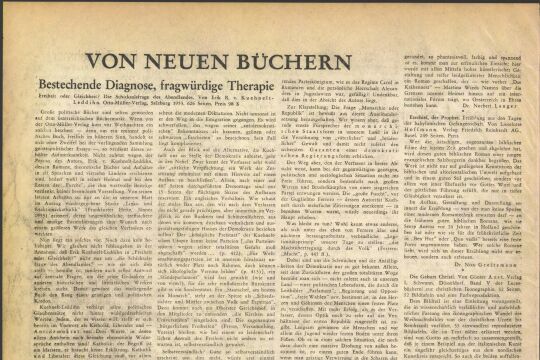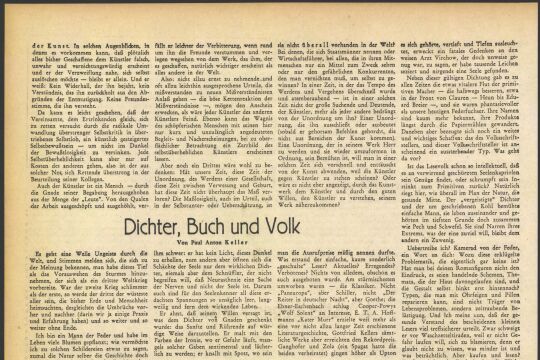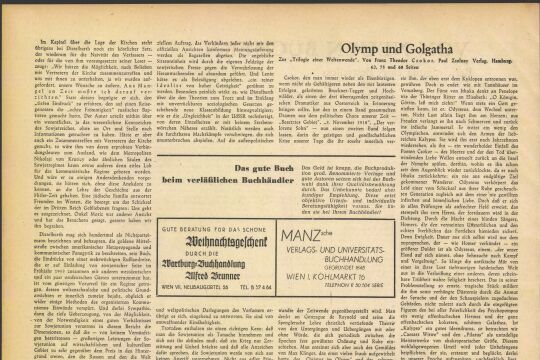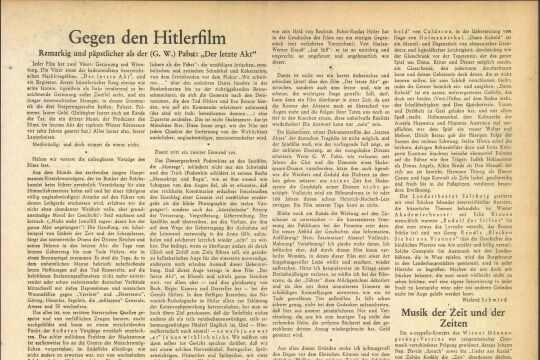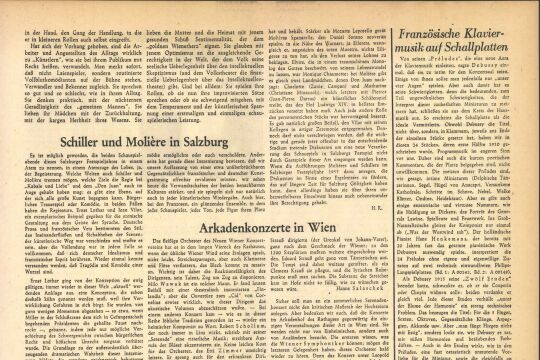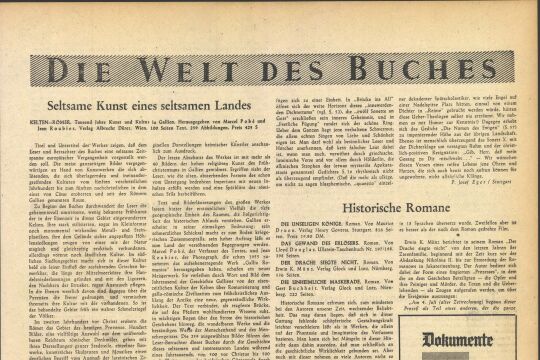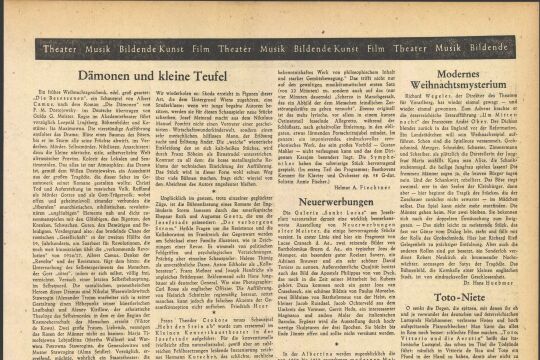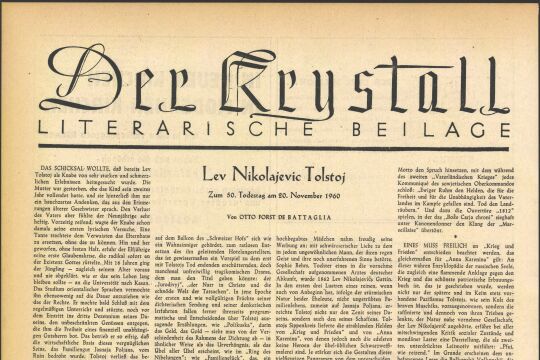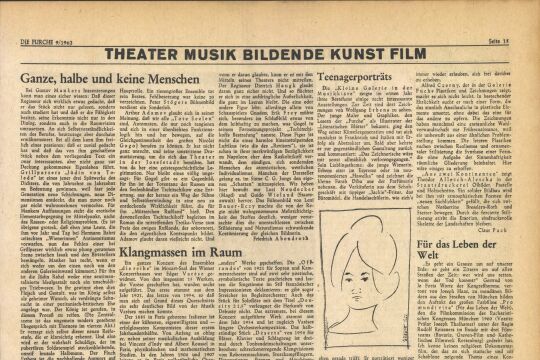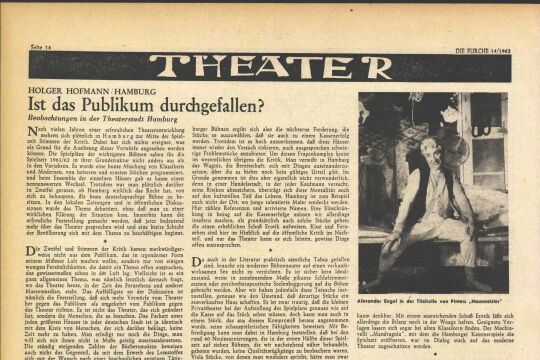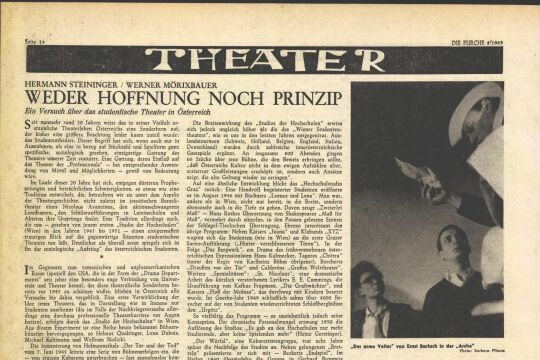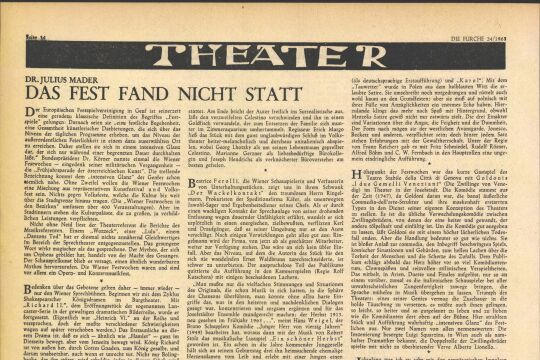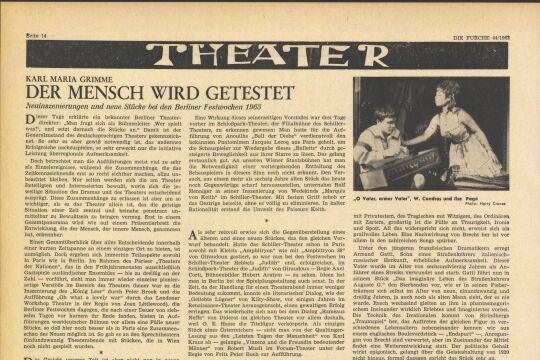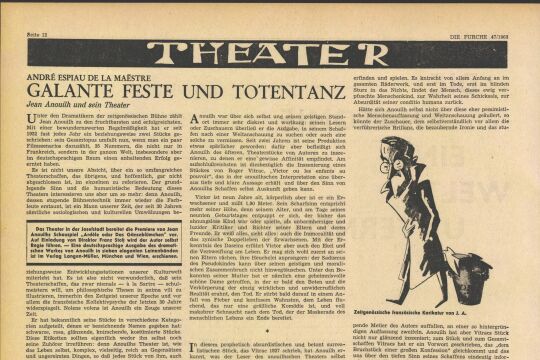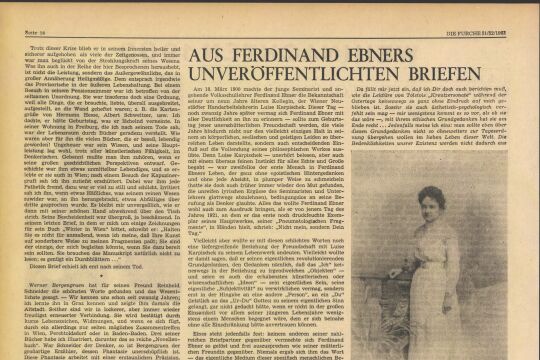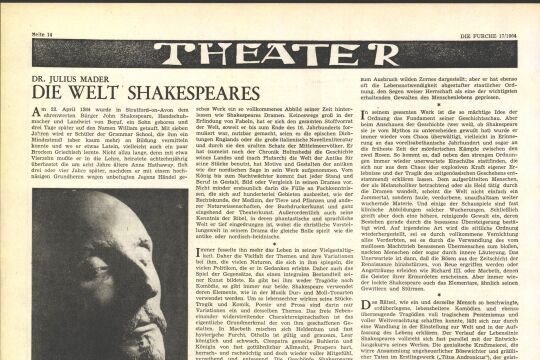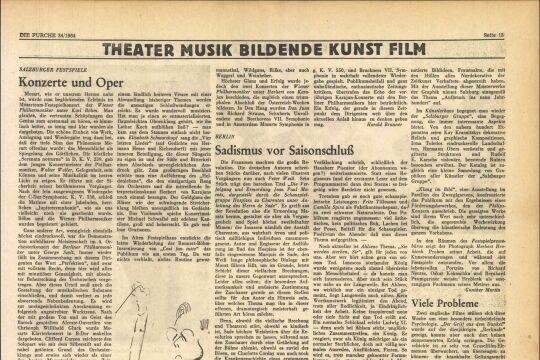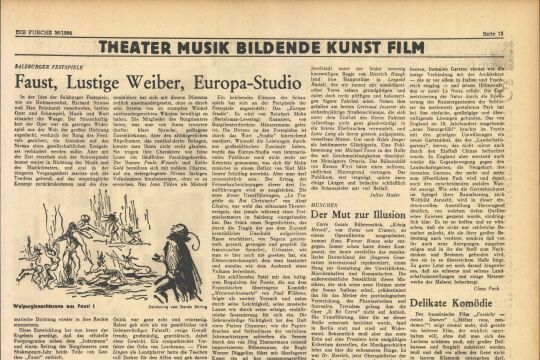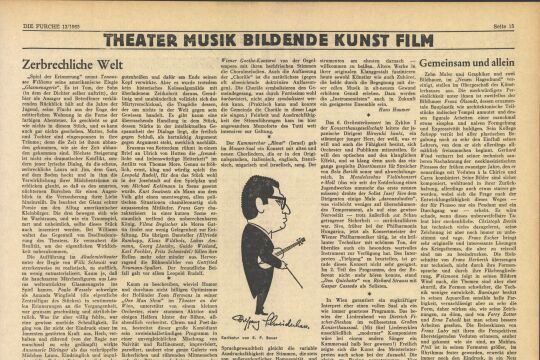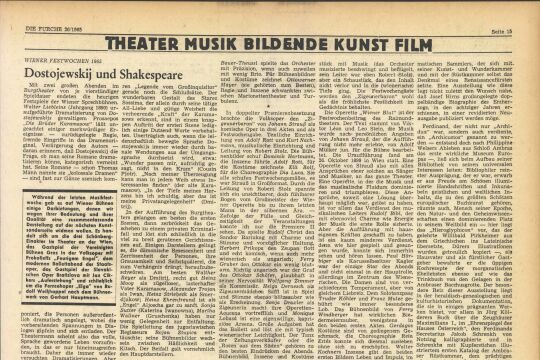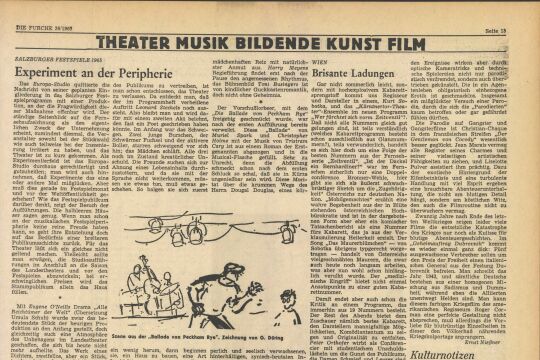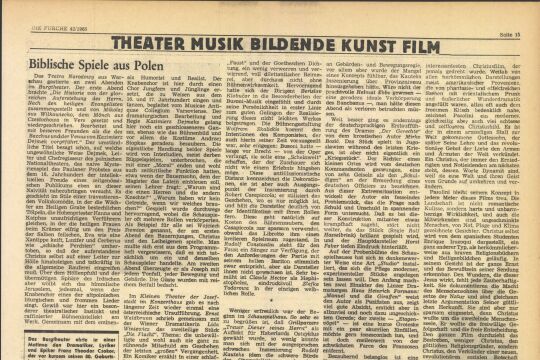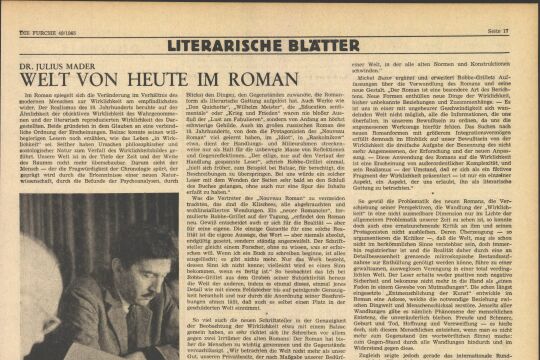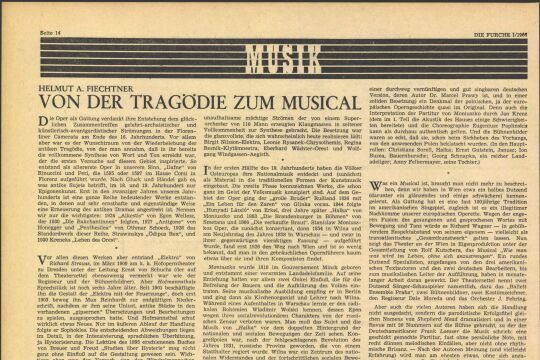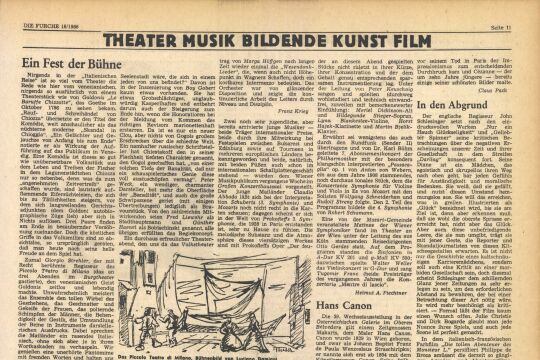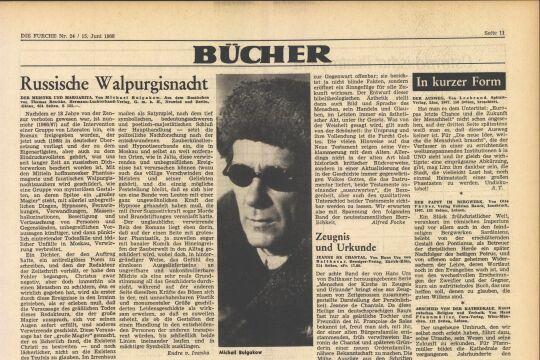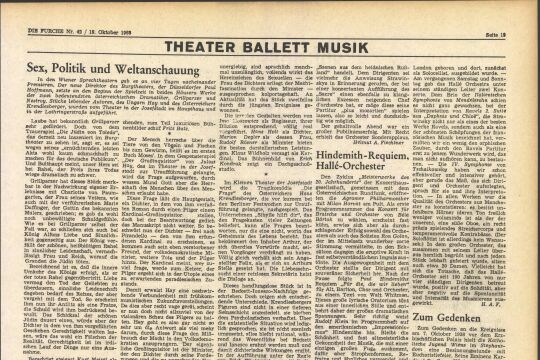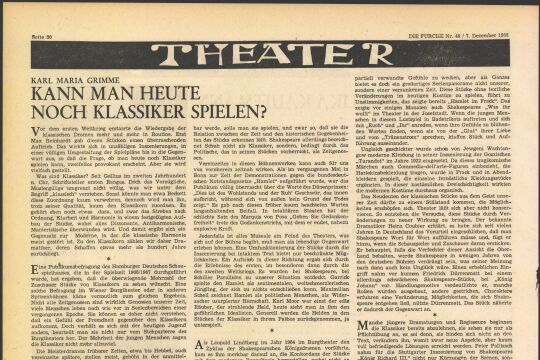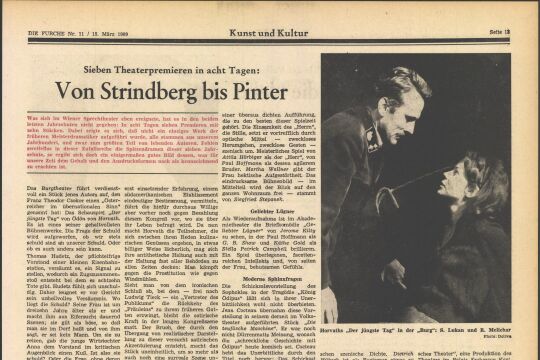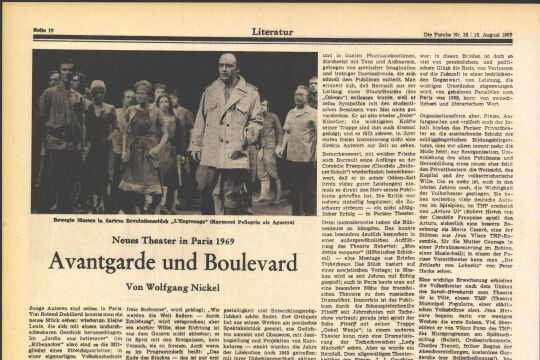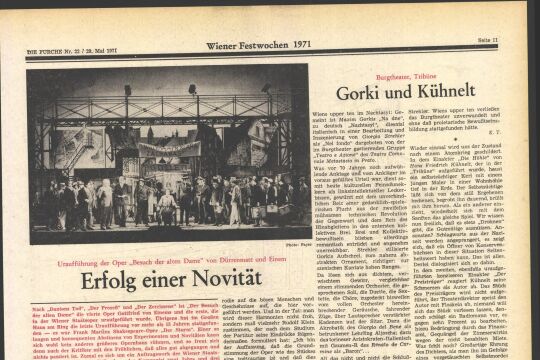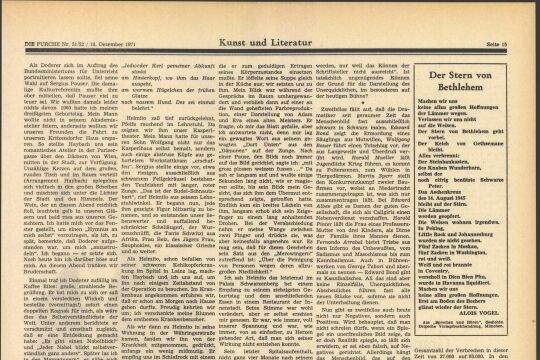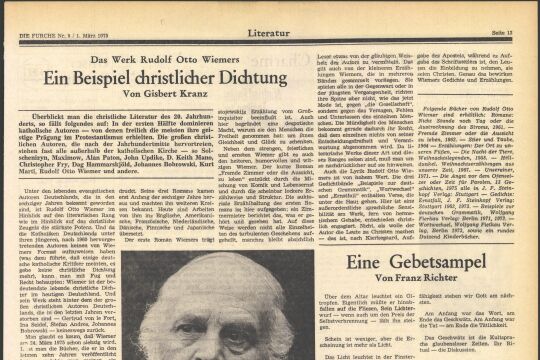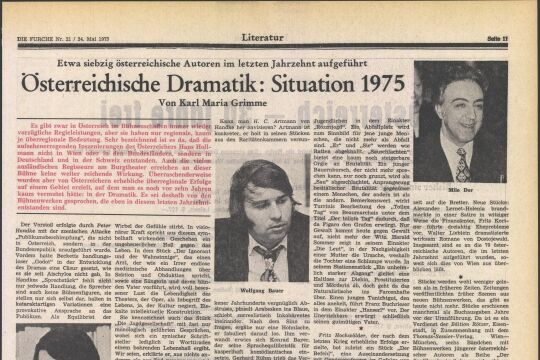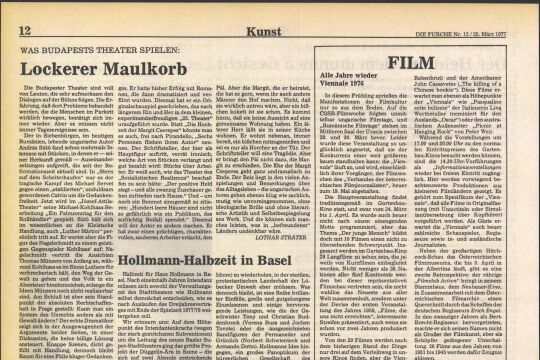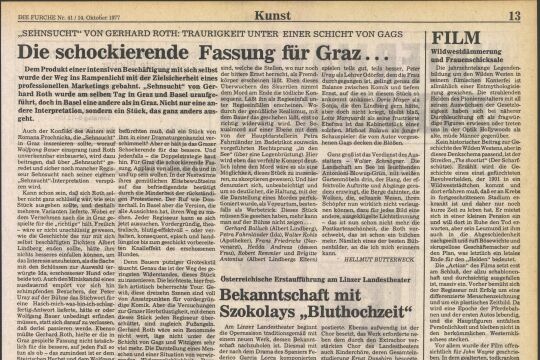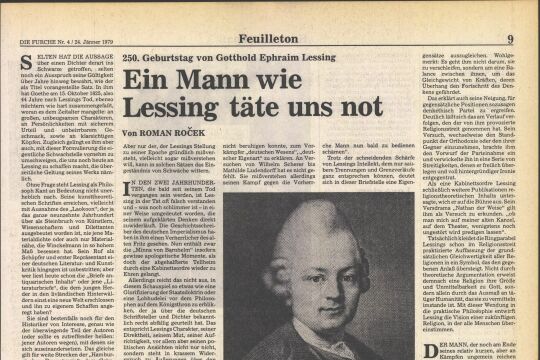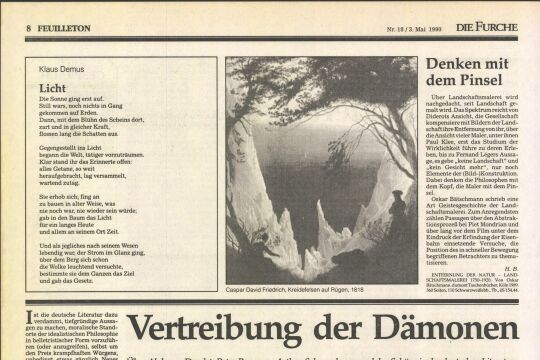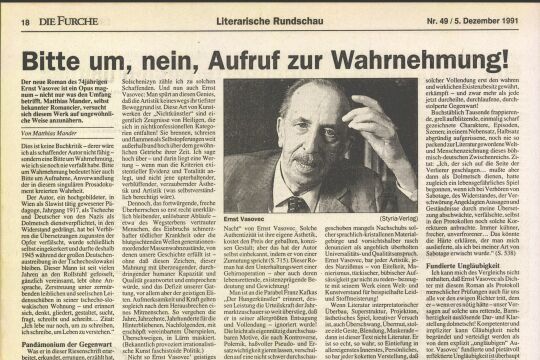Teuflische Wahrheiten
Michail Bulgakows epochaler Roman „Der Meister und Margarita“ ist nun im Wiener Akademietheater zu sehen – in einer Bühnenfassung, die sich zu sehr auf existentialphilosophische Fragen konzentriert.
Michail Bulgakows epochaler Roman „Der Meister und Margarita“ ist nun im Wiener Akademietheater zu sehen – in einer Bühnenfassung, die sich zu sehr auf existentialphilosophische Fragen konzentriert.
Unter all den Romanen, die dramatisiert den Weg auf die Theaterbühnen finden, gehört Michail Bulgakows Opus magnum „Der Meister und Margarita“, an dem der Autor von 1928 bis kurz vor seinem Tod 1940 geschrieben hat, wohl zu den beliebtesten.
Dies obwohl die labyrinthische Komposition mit einer Vielzahl von Erzählebenen und Stilformen, die von der beißenden Satire über lyrische Formen, den magischen Realismus bis zum schwarzen Humor und der poetischen Halluzination reichen, dem eigentlich entgegenzustehen scheint. Aber Bulgakov selbst hat, um nach seinem fast vollständigen Publikationsverbot 1925 in der Sowjetunion unter Stalin ein Auskommen zu finden, so manchen Roman für das Theater dramatisiert, darunter Gogols „Tote Seelen“ und „Don Quichotte“. So betrachtet hätte das estnische Regie-Duo Ene-Liis Semper und Tiit Ojasoo für die Bearbeitung des Romans zu einem, wie sie es nennen, „gesellschaftlichen Poem“ gewiss mit der Zustimmung des Maestros selbst rechnen dürfen.
Ihre Adaption, die sie am Wiener Akademietheater auch selbst in Szene setzten, wird dem selbst gesetzten Anspruch allerdings kaum gerecht, denn Hiebe auf aktuelle Zustände, wie sie die Vorlage zuhauf enthält, oder gar ein Sittenbild unserer Gegenwart fehlen. Auf das Groteske, Satirische und Phantastische des handlungsprallen Romans wird weitgehend verzichtet.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!