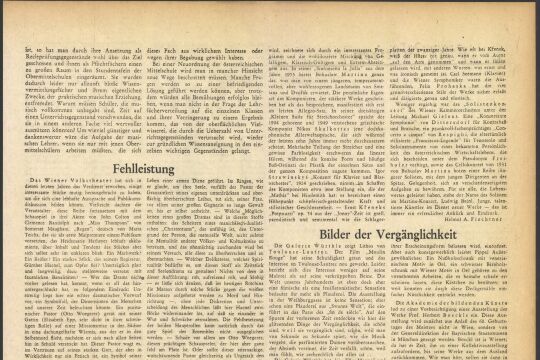Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Uraufführung der „Bassariden“
Hans Wener Herne, der vor kurzem seinen 40. Geburtstag begehen konnte, hat innerhalb von elf Monaten während der Jahre 1964 und 1965 die Opera šeria „Die Bassariden“ geschrieben. Es ist — nach „Boulevard Solitude“, „König Hirsch“, „Der Prinz von Homburg“, „Elegie für junge Liebende“ und „Der junge Lord“ — seine sechste große abendfüllende Oper. Sie wurde im Auftrag der Direktion der Salz burger Festspiele komponiert, unter der Regie von Gustav Rudolf Sellner größtenteils in Berlin einstudiert und am 6. August im Großen Festspielhaus uraüfgeführt. Darnach wird sie im Rahmen der Berliner Festwochen diesen Herbst in der „Deutschen Oper“ gezeigt und dann wohl von einigen wenigen großen Bühnen nachgespielt werden.
Unter den deutschen Komponisten der mittleren Generation ist Hans Wener Henze nicht nur der talentierteste, sondern auch der erfolgreichste. Eine Reihe von Balletten, Funkopern, fünf Symphonien, andere Orchesterwerke, Chor- und Kammermusik bilden ein Opus von Imponierendem Umfang (insgesamt achtzig Werke) und faszinierender Vielfältigkeit, das trotz des hohen Anspruchs, den jedes einzelne Werk stellt, heute bereits ein Publikum hat.
Der von W. H. Auden und Chester Kallman geschriebene Operntext basiert auf den „Bakchen“ des Euri- pides, die vor mehr als 30 Jahren übrigens auch der österreichische Komponist Egon Wellesz vertont hat. Nur lehnt sich Wellesz enger an den Urtext an, und der Chor spielt musikalisch und szenisch eine dominierende Rolle, während die neuen Textdichter versucht haben, die einzelnen Gestalten der antiken Tragödie stärker zu individualisieren und psychologisch zu differenzieren: ein ebenso interessantes wie gewagtes Unternehmen, da letzten Endes Psychologie und Mythus verschiedenen ethischen Kategorien und künstlerischen Sphären angehören — die freilich schon seit geraumer Zeit von Dramatikern und Epikern, oft durch das Medium der Ironie, in Verbindung gebracht wurden. (Sehr aufschlußreich ist in dieser Hinsicht der Briefwechsel mit Thomas Mann und dem großen Mythenforscher Karl Kerėnyi.)
Auden und Chester Kallman gehen noch einen Schritt weiter in der „Modernisierung“, indem sie, von dem originellen und kühnen Bühnenbildner und Kostümzeichner Filippo Sanjust unterstützt, die Akteure der antiken Tragödie verschiedenartig stilisieren und in die verschiedensten Kostüme stecken, so daß die Antike nicht als eine in sich abgeschlossene Epoche erscheint, sondern, im Rückblick, alle Zivilisationsstufen, einschließlich der Gegenwart, umfaßt. Das „Zeitlose“, worum es den Textautoren — und ohne Zweifel auch dem Komponisten Henze — geht, ist am greifbarsten in Pentheus, dem jungen König von Theben, personifiziert, der als ein Schüler ionischer Philosophen gedacht werden kann, dem Polytheismus entsagt hat und von den The- banem als „Atheist“ angesehen werden muß. Als er sich dem aus Asien hereinbrechenden Dionysoskult widersetzt, dem alle verfallen — auch seine Mutter Agaue, deren Schwester Autonoe, ja sogar der blinde Seher Teiresias — wird er von den Bassariden zerrissen. (Bei Euripides waren nur die Frauen vom Geist des Dionysos besessen, daher der Name „Die Bakchantinnen“, hier sind es Männer und Frauen: die Bassariden.) Die tiefenpsychologische Deutung der Autoren geht dahin, daß Pentheus durch den Versuch, die instinktiven Regungen zu unterdrücken, statt sie Verstandes -
mäßig zu integrieren, zu „domestizieren“, zu Fall gebracht wird.
Auf weitere Details des Textes, so interessant er ist, kann an dieser Stelle leider nicht eingegangen werden, denn in dem dreiflngerdicken Klavierauszug der Oper nehmen die Kommentare der Librettisten über den Stammbaum der Hauptpersonen, den mythologischen Hintergrund, die religiöse Einstellung der Personen und eine interpretierende Inhalts-
angabe vier große, engbedruckte Seiten ein. Im Programmheft sind es deren sechs! Doch seien zur Verdeutlichung einige „Kostümproben“ mitgeteilt: Agaue und ihre Schwester Autonoe sind kunstvoll im Stil des zweiten Empire gekleidet und frisiert, mit reichverzierten bunten Sonnenschirmen und Ridi- oules; Teiresias erscheint als anglikanischer Archidiakonus in Gehrock, mit schwarzer Brille und Stab; der Hauptmann der Wache, der allen gleichermaßen getreu ergeben ist und um den es in dem Intermezzo „Das Urteil der Kalliope“ geht, wo er als Adonis erscheint, trägt die lackglänzende Eisenrüstung eines fränkischen Ritters aus dem 14. Jahrhundert, er redet den König mit „Sire' an; Dionysos „der Fremde“ —- erscheint zunächst als Halbwüchsiger in offenem Hemd und schmalen Hosen („wie sie sein Vorbild zu einem Picknick in der Romagna hätte tragen können“), er hat die schwermütige Mine Lord Byrons und benutzt seinen Thyrsos- stab wie ein Spazierstöckchen; im „Intermezzo“, dessen Bühnenbild in Bouchers Manier gemalt ist und das mit seinen kleinen Proszeniumslogen an ein Rokokotheaterchen erinnert, erscheinen Agaue und Autonoe (als Venus und Proserpina) wie Schäferinnen ä la Marie Antoinette gekleidet; die Mänaden schließlich tragen schwarze, kurze Röcke, rote Strümpfe, gemusterte Blusen und „Haar wie Brigitte Bardot“, wie die Librettisten ausdrücklich vermerken ...
Von diesen Kostümierungen muß so ausführlich die Rede sein, weil der Text, von einigen salopp-modernen Wendungen abgesehen, die Zeitlosig- keit des Geschehens, insbesondere des Massenwahns, nicht so deutlich exemplifiziert und die Musik in dieser Hinsicht nicht mehr als Anspielungen geben will, die aber von so eklektischer Art sind, daß sie nur der vorgewamte und genau hinhörende Musiker bemerkt: ein Gustav-Mahler-Zitat, ein paar Takte Debussy und Strauss („Salome“), da und dort Anklänge an „The Rakęs’ Progress“ von Strawinskij (dessen Text gleichfalls von Auden und Kallman stammt), ein wenig Rameau, Lully und Offenbach, das ist schon alles. Denn als Musiker spricht Henze seine eigene Sprache, und zwar die der vorausgegangenen großen Opern (mit Ausnahme des „Jungen Lord“), seiner Ballette und Orchesterwerke. Es ist ein Idiom von betörendem orchestralem Wohllaut, faszinierend im steten Wechsel aparter, opalisierender Farben, bewunderungswürdig im ökonomischen Einsatz des enormen Apparats. (Im Orchester: drei- bis vierfach besetzte Holzbläser, 15 Blechbläser, zwei Harfen, zwei Klaviere und Celesta, mehr als zwei Dutzend verschiedene Schlaginstrumente, Vibraphon, Marimbaphon, Röhrendglocken, Maracas, drei Almglocken, Mandolinen und Gitarren, dazu natürlich der obligate große Streicherchor ...).
Die Musik — eine zweieinhalb Stunden dauernde, pausenlos durchgespielte viersätzige Symphonie, ist von vollkommener stilistischer Geschlossenheit, aber ohne eigentlichen dramatischen Atem — den man vor allem in einigen Dionysos- Partien und beim Auftreten der Mänaden vermißt. Laut, ja laut geht es zuweilen zu, aber die rhythmische Durchschlagskraft ist gering. Der Eindruck der „Länge“ .entsteht auch durch die vorwiegend getragene Zeitmasse — und durch die Pausen- losigkeit. Hier ließ sich Henze leider nicht beraten — und er wird es wahrscheinlich bald einsehen müssen, daß man einem unvorbereiteten Publikum nicht zweieinhalb Stunden Musik dieser Art und eine so komplizierte Aktion zumuten kann... Also: eine Pause vor dem „Intermezzo“ oder vor dem letzten Bild, der großen Klage um den von den Mänaden zerrissenen Pentheus, mit dessen Haupt, wie weiland Salome, Agaue erscheint, es triumphierend emporhebend und herumzeigend, bis sie aus ihrem bacchischen Rausch erwacht und bemerkt, daß es nicht das Haupt eines jungen Löwen ist, wie sie meinte, sondern das des eigenen Sohnes. — Ein großartiger, dramatischer Augenblick auch, wenn Pentheus, selbst von Bacchus verführt, als Frau verkleidet, zwischen den riesigen Säulen der Palastfront erscheint und sich gegen den brandroten Himmel der Wolkenkratzer von Los Angeles mit ihren Fernsehantennen abzeichnet...
Überhaupt gibt es in dieser Oper viel zu sehen, und Filippo Sanjust hat sich mit diesen Bildern (Felsgebirgen, mächtigen Säulenfronten, dazwischenmontierten Photos antiker Götterbilder u. a.) als phantasievoller Manierist ersten Ranges erwiesen. Gustav Rudolf Sellners Regie ist gut und wirkungsvoll in der Personenführung, weniger glücklich — merkwürdigerweise — in der Bewegung der Chöre. Freilich gehen so ausgefallene Ideen, wie die, daß sich die Fackeln der Bakchantinnen in grünblitzende Taschenlampen verwandeln, nicht auf seine Rechnung, wohl aber das peinlich sinnlose Hin- und Herrennen des ganzen Mänadenensembles über die Bühne.
Die Ausführenden unter der bewundernswert souveränen Leitung des jungen, auch in Wien wohlbekannten Dirigenten Christoph von Dohnanyi können wir leider nur nennen, und zwar in der ungefähren Reihenfolge ihrer Leistungen: Kostas Paskalis als Pentheus, Kerstin Meyer und Ingeborg Hallstein als Agaue und Autonoe, Helmut Melcher — Teiresias, Peter Lagger — Kadmos, William Dooley — Hauptmann,. Loreri Discoll — Dionysos, und, in einer kleineren Rolle, aber ausgezeichnet, Vera Little als Amme. — Das Solistenensemble kam fast zur Gänze aus Berlin, den von Wagner Hagen-Groll vorzüglich einstudierten Ohor stellte die Wiener Staatsoper; mit vollem Einsatz, präzis und klangschön, spielten die Wiener Philharmoniker.
Hier wurde, unter der Aufsicht des Komponisten, ein großes Stück Gemeinschaftsarbeit geleistet, das als solches bereits Respekt verdient und bei der spannenden Premiere den entsprechenden Achtungserfolg gefunden hat. Als „luxuriös, phantastisch und monumental“ hat ein deutscher Kritikerkollege seinen Gesamteindruck zusammengefaßt. Mit einem Wort also: eine Festspieloper! Und die interessanteste, wertvollste, wenn auch schwierigste, die es seit vielen Jahren in Salzburg gegeben hat.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!