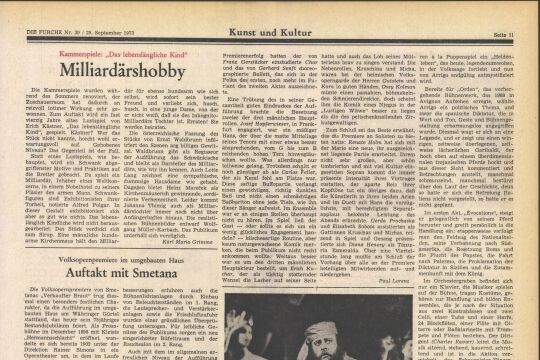Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Verdi-Oper als Lehrstück
Die krause Unlogik wilder Schauerromantik, wie sie für das Libretto von Verdis „Macht des Schicksals“ charakteristisch ist, war dem neuen Oberspielleiter der Grazer Oper, Karl-Heinz Haberland, ein Dorn im Auge. So machte er sich denn bei seiner Inszenierung des Werkes daran, ein wenig Ordnung in die ungereimte Kolportagegeschichte zu bringen und das Dickicht der Handlung zu lichten. Dies versuchte er durch Umstellen einiger Szenen zu bewerkstelligen und durch Verbannen realistischer Dekorationen von der Bühne. So weit, so gut. Was aber schließlich bei solch puritanischem Eifer herauskam, war eine im Szenischen recht karg und dürftig wirkende, ja phantasielose Aufführung, die in ihrem dunkel-faden Farbeneinerlei, den beiden Schrägwagen und den auf den Zwischenvorhang projizierten Schauplatzangaben eher an ein Brechtsches Lehrstück denn an eine blutvolle Verdi-Oper gemahnt. Bei solch krampfhafter Kühle des Optischen blieb einem immerhin noch die Musik. Gustav Czerny sorgte als Dirigent für Genauigkeit und Sauberkeit: Schwung und Sinn für elementare Spannung sind nicht seine Sache. So entsprach denn eine gewisse Trockenheit des musikalischen Anteils der Kargheit des szenischen. Der Tenor José Maria Perez verfügt über ein beachtliches Stimmaterial, hat aber technisch noch viel zu lernen, der Bariton Rudolf Constantins ist schön und klangvoll geführt, wirkt aber zuweilen noch etwas unausgeglichen, Boiena Ruks herbem Sopran gelingen leuchtende Höhen, während die Mittellage noch durch ein zu starkes Vibrato getrübt wird. Als Pater Guardian bestach der Japaner Kunikazu Ohashi durch seinen prachtvoll runden, samtenen Baß.
Ein interessanter, nicht alltäglicher Abend reihte in den Kammerspielen drei neuere Monologe unter dem Titel „Selbstgespräche“ aneinander. Rosso di San Secondos „Enthüllung“ arbeitet mit bescheidenen Pirandelloeffekten, Aldo Nico-
lajs kabarettistische Soloszene „Salz und Pfeffer“ ist eine köstliche, makaberwitzige Fundgrube für eine temperamentvolle Schauspielerin (Ruth Birk brillierte mit einem wahren mimischen Furioso), und Becketts „Letztes Band“ bildete den anspruchsvollen, ausweglos düsteren Abschluß des bemerkenswerten Abends. Anton Lehmann war ein großartiger, hinreißender Krapp — zum Clown gewordener Vertreter eines absurden Daseins. — Mit Widersprüchlichkeiten des Aufbaues und der Charakterzeichnung in Shakespeares ,Julius Cäsar“ wurde auch die Neuinszenierung des Werkes im Opernhaus nicht ganz fertig. Eine gewisse Statik und Kühle im ersten Teil, der nicht frei war von bloßer Rhetorik, machten einem das Mitgehen schwer. Um so besser gelangen dem Regisseur, Dr. Rolf Hassel- brink (Wiesbaden), die Szenen nach Cäsars Tod, zumal in Hans Kraßnitzer ein ausgezeichneter Brutus zur Verfügung stand, der in psychologisch überaus fein gezeichneter Darstellung zum Mittelpunkt des figurenreichen Stückes wurde. Das Beste an der gesamten Aufführung, in der der bekannte deutsche Schauspieler Malte Jaeger den Marc Anton gab, waren die grandiosen, stärkste Suggestion ausstrahlenden Dekorationen Wolfram Skalickis. Übrigens handelt es sich bei dieser Neuinszenierung um eine Uraufführung: das Werk wurde nämlich in der Übertragung durch den 1848 verstorbenen Österreicher Theodor von Zeynek gegeben, die zum erstenmal auf einer Bühne zu hören war. -Zeyneks Übersetzung: stellt etwa ein Mittelding dar zwischen der poetisierenden, modernem Empfinden nicht immer ganz gemäßen Version Schlegels und der überaus wirksamen, verdeutlichenden, aber manchmal etwas banalen Verdeutschung durch Richard Flatter. Zeyneks Text spricht sich gut, hebt gewisse Metaphern des Originals in ein deutlicheres Licht, weist aber dagegen zahlreiche, papieren klingende Formulierungen auf.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!