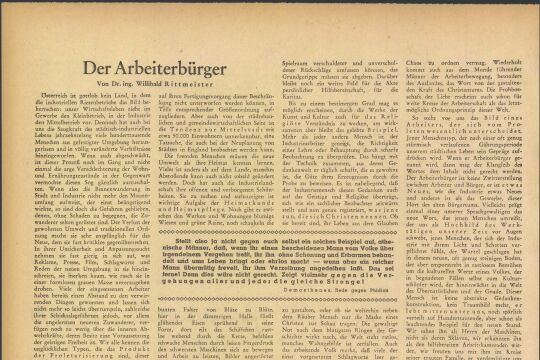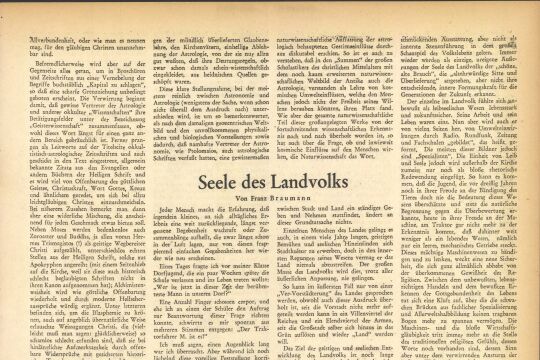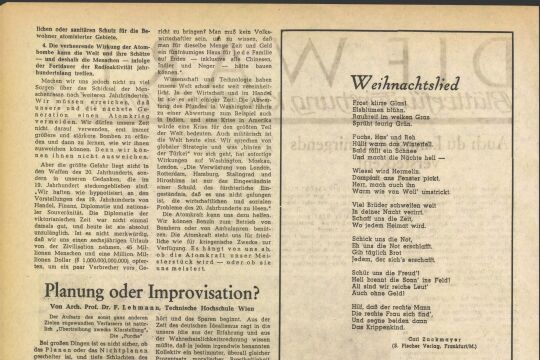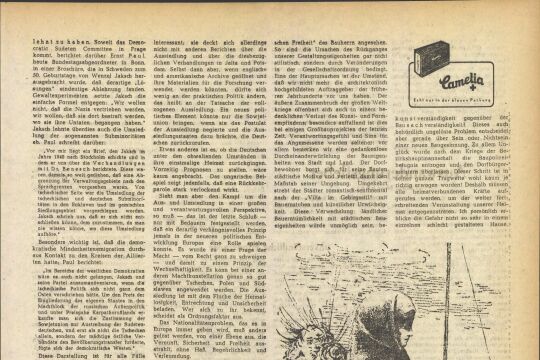Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
1978 - JdHR DER FfflMUE
Die vorherrschenden berüchtigten großflächigen Neubaugebiete kann man sehr gut als politische Ausbeutung eines menschlichen Grundbe-düfnisses, analysieren. Ihre Rechtfertigung mit „Baulandmangel“ ist gerade in Österreich recht dürftig, und die Kosten - wie die jüngsten Wiener Beispiele zeigen - zumindest nicht günstiger als die Kosten kleiner „feinkörniger“ Wohnbauprojekte. Den Großsiedlungen „aus der grünen Wiese heraus“ fehlt immer - auf Generationen - jene Vielfalt unwägbarer Faktoren, die für das Gefühl der Beheimatung unerläßlich sind. Sie führen auch konsequent zu riesigen Hochhausgebilden, deren Gefährlichkeit, deren physische, psychische, medizinische und soziologische Nachteile heute als weithin gesichertes Forschungsergebnis gelten können. Sie sind vom Grunde her familienfeindlich, auch w^nn die Einzelwohnung „innen“ komfortabel ist.
Es liegt auch auf der Hand, daß für Familien, die ihre Kinder nicht weitgehend „abgeben“ wollen, Gebäude ungeeignet sind, deren Höhe verhindert, daß ein Volksschüler allein vor das Haus spielen gehen kann. Viele derartige Gründe, nicht zuletzt die Kosten der „Sozialbauwohnungen“, bringen viele Familien dazu, „selber zu bauen“, oft mit _ eigenen Händen, und Nachbarschaftshilfe (sprich: „Pfusch“).
An sich ist dies eines der positivsten Phänomene unserer Zeit weil es Selbstverwirklichung und Wertschaffung ermöglicht Die moderne Architektur hält dafür viele gute Ideen bereit (verschiedene sinnvolle Siedlungsstrukturen, z. B. den „verdichteten Flachbau“), aber beim Gros der „Häuselbauer“ ist davon noch nichts angekommen. Sie zerbauen, mit knappem „freiem Schußfeld“ um die Mini-Villa, jeder für sich allein, die Gegend. Und werden von den meisten Planern und Institutionen allein gelassen, aber beschimpft Hier liegt ein wichtiges Ar-
beitsfeld für neue, die Initiativen so Vieler positiv integrierende Modelle der Verwirklichung familiengerechten Wohnbaus vor uns.
Es ist am Unmut der „Betroffenen“ erkennbar, daß der Komplex des „sozialen (geförderten) Wohnhausbaus“ immer mehr in eine Legalitätskrise hineinschlittert. Die Förderungsbestimmungen, die Bauträgerformen, die Herstellungsstrukturen funktionieren vielfach nicht mehr so recht zugunsten derer, die im Endprodukt wohnen. Von ihren Bedürfnissen existieren starre Klischeevorstellungen.
Befragungen des Verfassers bei Bewohnern anscheinend recht gut geplanter Wohnungen erwecken, große Zweifel an der gängigen funktionali-stischen Grundriß-Ideologie. Alles ist zu genau vom Architekten festgelegt: Küchenpult, Eß- und Fernsehplatz, das Kinder-Arbeitspult und -Bett, Schrank und Doppelbett des „Elternschlafzimmers“ ... Die allzu genau geplante Wohnung ist dann nicht Maßschneiderarbeit sondern Zwangsjak-ke, die für die persönlichsten Wünsche der konkreten Bewohner zu wenig Freiraum läßt (Gewünscht werden funktionsneutralere Räume, Möglichkeiten der Mitbestimmung, ein sinnvolles Maß an Veränderbarkeit, brauchbarere Größen: „Zimmer!“).
Wenn man die Ergebnisse solcher Befragungen kritisch analysiert, schlittert man aber bereits in eine weitere Grauzone hinein: Was weckt eigentlich Wohnwünsche? Welche Bedürfnisse sind objektivierbar? Wieweit bestimmt die „Werbewelt“ die allgemeinen Vorstellungen und Ansprüche?
Die Unkenntnis über den Wohntagesablauf der eigenen Famüie, die Unfähigkeit mit Plänen diesbezüglich etwas anzufangen, ist groß und macht viele Menschen zu Konsumsklaven der bunten TV-Spots und der Faltprospekte der Ausstattungsindustrie. Sie „lassen sich wohnen“: Ein Beispiel dafür ist die Tatsache, daß es - etwa seit dem 1. Weltkrieg-den „Designern“ gelungen ist, den „großen Tisch“, unersetzlich als Zentrum aktiver Wohnvorgänge, „den Leuten“ auszureden. Von mickrigen „Eßecken“ verdrängt, wurde er durch die zentrale „Sitzgruppe“ ersetzt, in deren Fauteuils man nur passiv hocken kann, und deren Hauptfunktion die eines Statussymbols ist.
Von mickrigen „Eßecken“ verdrängt
Ebenso in Frage zu stellen ist das allgemein propagierte „große Wohnzimmer“. Es verliert seine Familien-fuktion sofort, wenn das TV-Gerät eingeschaltet wird: dann herrscht Finsternis für das Familienleben, denn die anderen Räume der Wohnung sind zu seinen Gunsten ja zu Löchern ver-zwergt worden.
Die Aspekte des „Leistungsvermögens“ eines Wohnungsgrundrisses sind im Zusammenhang mit „familiengerechtem Wohnen“ vom Wohnvorgang her heu zu überdenken, zu-
sammen mit dem ganzen Komplex der bautechnischen Mindestanforderungen (Schallschutz, Energiebilanz, Langlebigkeit). Die substantielle Qualität und Reparaturfreiheit der Sozialwohnbauten sank bisher von Jahr zu Jahr. Das hat aber wenig mit der Intelligenz der Planer zu tun, viel jedoch mit dem Umstand, daß - bereits von den Förderungsbestimmungen her -die eigentliche Baustruktur möglichst billig sein soll, während man für die Einrichtung dann wieder recht viel auszugeben bereit ist. Gerade das, was sich an einem Bau später nicht mehr verbessern läßt, wird zu schnell, zu billig „hingestellt“.
Heute läuft, nur von wenigen bewußt reflektiert, eine ebenso schizophrene wie zwangshafte Entwicklung dahin, daß der technische Fortschritt auf dem Bauwesen sich fast ausschließlich auf die Rationalisierung des Herstellungsvorganges konzentriert, weü dieser wirtschaftlich und politisch so wichitg ist. Man nennt dies mit Recht „herstellerfreundliche Bauweisen“. Hieran etwas zu ändern, wäre sehr wichtig, setzt aber ein tiefgreifendes Umdenken voraus.
Wir addieren lieber Notbeschäftigungsprogramme für Fertigteüfirmen mit Arbeitslosenunterstützung für Bauarbeiter, als daß wir wieder mehr menschliche Arbeitskraft einsetzen und von den heute üblichen, primär herstellerfreundlichen zu benützer-freundlichen Bauweisen zurückkehren, etwa Häsuer bauen mit dickeren Mauern, schwereren Decken, besseren Fenstern, und einer Installation, deren Lebenserwartung nicht schon vom Hersteller mit 10 Jahren begrenzt ist. Hier würde die Forderung nach familiengerechtem Wohnbau lauten: Nicht was das Haus kostet, wenn man es baut, sondern was es wert ist, wenn es steht, sollte entscheidend sein. Es ist auszudiskutieren, wie lange es stehen soll, was uns Dauerhaftigkeit bedeutet, was „familiengerechtes Bauen“ kosten darf. Sicher mehr, als vielen lieb ist.
Nur dann hat es einen Sinn, wenn wir rufen: humanere Siedlungsstrukturen; höhere „solzialästhetische“ Ansprüche an Häuser und Siedlungen; höherer bautechnischer Standard. Langlebigkeit der Bauteile. Bessere Haus- und Grundrißstrukturen, geeignet für eine Beteiligung der Benutzer am Planungs- und Realisierungsprozeß durch Partizipation. Positive Kanalisierung der Eigeninitiativen.
Aber wir müssen gleichzeitig auch Klarheit schaffen, was Familie soll, wie weit ihre Funktionen gehen: Änderungen des Sozialverhaltens; stärkere Integration und Toleranz der Generationen stehen ebenso zur Debatte wie neues Überdenken unserer echten Wohnbedürfnisse und des Anspruchsniveaus (wieder reihen und warten lassen, denn: „Alles für alle auf einmal“ geht nicht!)
Die Architektur wird diese Grundprobleme nicht lösen, aber wenn sie gelöst sind, wird sich das in den Bauten abbilden; dann werden die Wohnungen familiengerecht gebaut werden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!