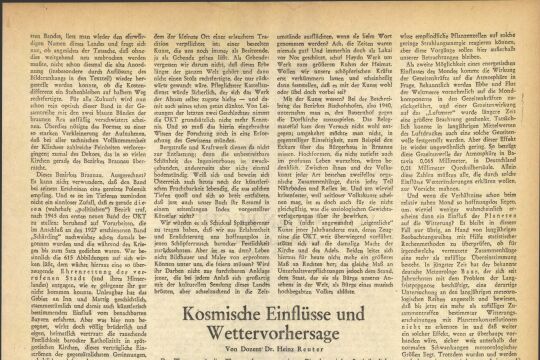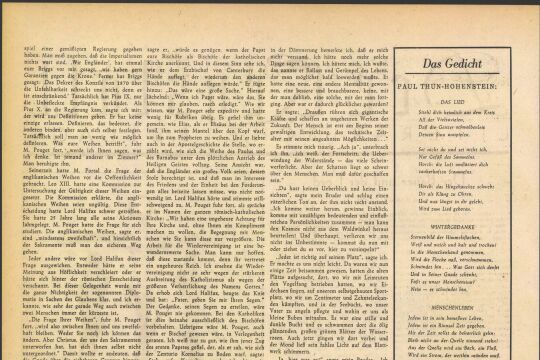Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ahnung und Wildnis
Jeannie Ebner hat einen neuen Roman abgeschlossen: „Aktäon“. Die FURCHE freut sich, das Buch, das demnächst im Verlag Styria, Graz, erscheinen wird, durch die Veröffentlichung eines Kapitels vorzustellen.
Jeannie Ebner hat einen neuen Roman abgeschlossen: „Aktäon“. Die FURCHE freut sich, das Buch, das demnächst im Verlag Styria, Graz, erscheinen wird, durch die Veröffentlichung eines Kapitels vorzustellen.
Von hier an“, sagte Aktäon, „wird mein Freund die weitere Führung übernehmen.“ „Ja, ich möchte Ihnen gern das Schloß Niederweiden zeigen, obwohl man nicht hinein kann, also nur von außen. Ich glaube, daß es Sie interessieren wird, meiner Meinung nach ist es das Modell für Schloß Schwarzsee in dem Roman ,Moos auf den Steinen . Sie waren doch mit dem Autor befreundet?“
„Ja“, sagte ich. „Gerhard Fritsch und ich haben in seinem letzten Lebensjahr gemeinsam in der Redaktion gearbeitet und einander fast täglich gesehen.“
Es ist ein sonderbarer Zufall, daß mich, kurz ehe die Fahrt ins Marchfeld zustande kam, eine fremde Frau angerufen und gefragt hat, ob ich ihr sagen könne, welches der Marchfeldschlösser der Dichter im Sinn gehabt habe. Ich konnte es ihr nicht sagen. Hinterher wunderte ich mich, wieso ich ihn nie gefragt hatte.
Auf dem schon zur Wiese gewordenen Weg, der von der Bezirksstraße abzweigt und neben der Seitenmauer des Parks hineinführt in eine feuchtgrün ver- wucherte Wildnis, ließen wir die Wagen stehen. Wir traten an das schwarze Gittertor mit seinen hohen Lanzenstäben und starrten hinein auf das Schloß. Ich erinnerte mich an das letzte Gespräch, das ich mit Gerhard Fritsch geführt hatte, drei Tage vor seinem Freitod. Ich erzählte ihm, daß unter seinen frühen Gedichten mindestens eines sei, das ich unbedingt dabei haben wolle, sollte ich jemals selbst eine Anthologie zusammenstellen dürfen.
Meine private, ganz subjektive Anthologie sollte es sein, nicht so wie die umfangreichen, fleißig erarbeiteten Groß-Anthologien, etwa „Die Lyra des Orpheus“ und „Der tausendjährige Rosenstrauch“ des Felix Braun oder die Ausgabe, die ich von meiner ältesten und treuesten Jugendfreundin Sophie „auf unbeschränkt lange Zeit“ geliehen bekam, als ich ein junges Mädchen war; und diese lange Zeit ist dann übergegangen in einen unbeschränkt langen Krieg, dessen Ende Sophie als Krankenschwester in einem Lazarett in Rußland erlebte.
Ich habe, als wir, um den Bomben zu entgehen, mit nur etwas Handgepäck aus meiner Heimatstadt westwärts zogen, das Buch mitgenommen, dieses und noch zwei andere, denn ganz ohne Bücher kann man nicht leben. Zwei Jahre später konnte ich es Sophie in vielbenütztem, aber noch brauchbarem Zustand zurückgeben: „Die schönsten Gedichte der Weltliteratur“, 1933 bei Phaidon erschienen.
Meine Anthologie sollte aber nur jene Gedichte enthalten, die ich besonders liebte. Geradezu entsetzt wehrte Gerhard ab, urtd das war keineswegs geheuchelte Bescheidenheit, es war da irgendeine innerliche Verwunderung, schien mir. Er befand sich offenbar in einer Phase der Verunsicherung. „Alles, was unsere Generation geschrieben hat, alles, was vor 1965 geschrieben wurde, ist schlecht“, sagte er.
Wir sprachen an jenem letzten Tag auch über Egon Friedell, und ich mußte den Freitod des Dichters, der aus dem Fenster sprang, als er unten die SS in sein Haus gehen sah, gegen Gerhard Fritsch verteidigen; das sei in einer solchen Lage nur zu berechtigt, sagte ich.
Er widersprach mit einer Entschiedenheit, die bei ihm selten war, meist entsprach es seinem Wesen, jedes Für und Wider, gewissenhaft abwägend, sehr genau in Betracht zu ziehen, ehe ein Urteil zustande kam. „Das darf man nicht!“ sagte er. „Nein. In keiner Situation.“ Wenige Tage später hat er es getan.
Gerüchte und Erklärungsversuche kreisen noch heute um diesen Tod. Freilich kann man manches erklären, gewissenhaft oder lieblos, wissenschaftlich, physiologisch und psychologisch. Für mich wird es trotzdem etwas tragisch Unverständliches bleiben, es bleibt im Schwarzwasser seiner Seele, im Geheimnis seines Wesens beschlossen, in das keine Metamorphose mir Eintritt verschafft.
Geblieben ist, was er geschrieben hat, in dem ohnmächtigen, hoffnungslosen, immer zum Scheitern verurteilten Versuch, ein Stück seines inneren Lebens und Denkens über den Zeitstrom hinauszureichen, ehe er selber darin versank. Ein Schloß aus Ziegeln und Steinen ließ ein inneres Luftschloß entstehen, bevölkert von seinen Geschöpfen, die er erschaffen hat. Was daran Wirklichkeit war, wird ein Geheimnis bleiben, er könnte es wohl selber nicht sagen. Und ich habe ihn auch nicht gefragt.
Wenn mich einer fragen sollte nach der Wirklichkeit dessen, was ich hier schreibe, ich würde sagen, die Wirklichkeit entsteht, wenn überhaupt, hinterher aus der Wirksamkeit dessen, was einer geschrieben hat. Und im übrigen würde ich mich mit einem Verweis auf die literarisch höchste Autorität begnügen und sagen: Es ist Dichtung und Wahrheit, wie immer.
Der stille Kollege ging uns voran, Christine, mein Mann und ich folgten im Gänsemarsch, denn dieser Weg, einst ein Promena-
denweg in die Auwildnis oder sogar ein mit Kutschen und Pferden befahrbarer Weg, mußte sehr lang nicht benützt worden sein. Fast sah es aus, als sei Gerhard Fritsch der letzte gewesen, der hier in den Auwald eingetreten war. Wir wateten bis an die Knie im nassen Gras, unter den Schuhen knirschte zertretener Breitwegerich, und hie und da, unangenehm knackend, ein Schneckenhaus. Brennesseln schlugen uns gegen die Beine. An manchen Stellen waren sie so hoch, daß sie mir heiße Striemen über die bloßen Arme zogen, denn es war übergangslos wieder so warm geworden, daß ich den Regenmantel ausgezogen hatte. Die Sonne stach, und etwas totenstill Lauerndes schien, in der verschlungenen Dichte der Pflanzenwelt verborgen, seinen dumpfen Atem in unsere Gesichter zu blasen.
Der Professor und Helga waren weit zurückgeblieben. Aktäon folgte uns zögernd und mahnte nach einer Weile zur Umkehr.
Zuletzt gab es kein Weiterkommen mehr durch die Stauden und Büsche. Der stille Kollege blieb stehen und deutet hinauf. Uber den Kronen der Götterbäume, deren Samenbüschel noch lichtgrün waren, ohne den wundervoll scharfen Gegensatz hellen Feuerrots, den sie beim Ausreifen annehmen, sah man über den Resten einer Ziegelmauer ein Stück des Holzdachs, schwankend und schief, an einer Stelle schon so stark überhängend, als wolle es sich hinter dem längst abgerissenen anderen Teil des Daches in die Tiefe stürzen. Und ein geknickter Sparren starrte, vor dem schwarz bewölkten Himmel, wie ein Galgen.
„Kehren Sie um, meine Damen“, sagte Aktäon. „Der Himmel sieht bedrohlich aus.“
„Wir gehen zurück“, meinte der stille Kollege, nun ebenfalls etwas besorgt. „Wir sagen den anderen, daß sie gleich umkehren sollen. Hier vorn an der Parkmauer ist zwar ein Weg, der eine große Abkürzung wäre, aber alles ist hier schon so verwachsen…“
Ich wäre jetzt gern eine Weile allein gewesen. Das Unbegreifliche und das Heillose dieser Welt, es hatte mich wieder eingeholt, selbst an diesem so hellen, heiteren, leichtfertig machenden Tag. „Kannst Du’s denn nicht lassen?!“ sagte ich zu Gott. „Mußt Du immer gleich wieder die Komplementärfarbe dagegensetzen?! Was liegt mir daran, ob es Dein Werk ist, so wie es Dir gefällt! Ich möchte ein Bild ganz in Glück, ganz in Blau und Gold …“ Entschlossen arbeitete ich mich durch die Sträucher auf die Parkmauer zu, aber Christine und mein Mann folgten mir. Mehr mit den Füßen als mit den Augen fand ich den Pfad, der dort entlangführte. Wir stolperten über die unterm Unkraut verborgenen Baumwurzeln und lachten, wir versuchten, dem ganzen den Reiz eines Kinderabenteuers zu geben, aber mir war es unangenehm, daß ich mich immer wieder in die lianendicken Stränge der Waldrebe verstrickte, die selbst hohe Bäume abwürgt.
Die anderen saßen bereits trocken und gesichert hinter Glas und Blech, wir zupften uns noch die kleinen, mit Widerhaken versehenen Kügelchen des Hexenkrauts von den Strümpfen und aus den Haaren, als die ersten schweren Tropfen herunterklatschten. Etwas hatte sich an mich gehängt, daftraurig machte. Am liebsten wäre ich eine Weile im Regen stehengeblieben, bis der Gewitterdruck in der Luft nachließ und das Wasser weggewaschen hatte, was unter der Schichte aus Lachen und Lebenslust an die Oberfläche kommen wollte: die wohlbekannte, die altbekannte, die nahezu wie eine alte Freundin immer wiederkehrende Melancholie.
„War es also das Schloß, das Gerhard Fritsch gemeint hat?“ fragte mein Mann, als ich wieder hinter den beiden im Wagen saß. „Ich weiß es nicht.“
„Der verfallene Gutshof weist darauf hin, der muß damals schon nur noch die Ruine eines Gutshofs gewesen sein“, sagte Aktäon. „Dort hat sich das Liebespaar heimlich getroffen.“
„Die richtige Szenerie für eine Geschichte mit tragischem Ausgang“, sagte ich. „Möglich, daß er sie deshalb gewählt hat. Mir ist es lieber, wenn das ein Geheimnis bleibt.“
„Was sich nicht mit dem rationalen Verstand aufschließen, errechnen oder beweisen läßt, danach soll man nicht fragen“, sagte mein Mann. „Manchmal ist es überhaupt besser, wenn man etwas nicht ganz genau weiß.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!