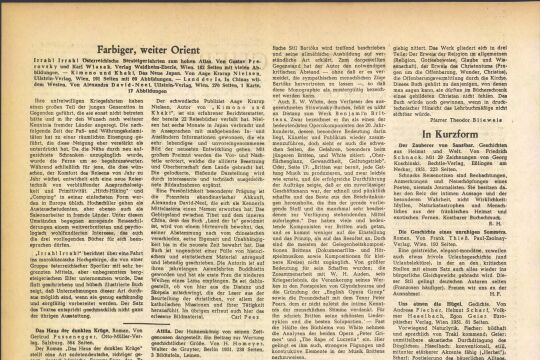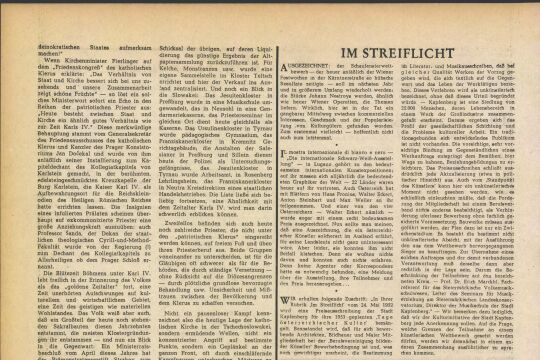Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Alban Bergs Vermächtnis
Als vor wenigen Wochen Salzburgs Landestheaterchef Federik Mirdita mit seinem Spielplan der Saison 1984/85 auch Alban Bergs „Wozzeck” anläßlich der 100. Wiederkehr des Geburtstags des Komponisten am 9. Februar ankündigte, kam es zum Krach zwischen dem Intendanten einerseits, der versucht hatte, in Salzburgs Musiktheaterleben auch außerhalb der Festspiele Bezüge zum 20. Jahrhundert spürbar zu machen, und Abonnenten und ein paar ewig gestrigen Politikern andererseits. Man kann's kaum glauben, aber es sollen im Fall „Wozzeck” sogar manche von „Mist” und „Entartetem” gesprochen haben.
Natürlich könnte man solche — reichlich verspäteten — Reaktionen als Provinzialismus oder „kleinstädtische Engstirnigkeit” abtun, wären sie nicht charakteristisch für die mehr oder minder offene Ablehnung, die das Schaffen der Meister der Wiener Schule
— also Arnold Schönbergs und seiner Schüler Alban Berg und Anton von Webern — lange Jahre erfuhr und mitunter heute noch erfährt. Wobei man diese Reaktionen nur als Zeichen für die Kluft deuten kann, die sich seit Gustav Mahlers Tagen zwischen den Anliegen der Komponisten und dem vorherrschenden Musikbetrieb mit seinen zunehmend rückwärtsgewandten Interessen immer weiter vertieft hat.
Dabei konnte man eigentlich nie sagen, daß Alban Berg Zeit seines kurzen Lebens von fünfzig Jahren — geboren am 9. Februar 1885 in Wien als Kind wohlhabender Handelsleute, gestorben am 24. Dezember 1935 — ein „verkanntes Genie” oder ein am Rande der Kulturszene seiner Zeit Vegetierender gewesen wäre. Im Gegenteil. Die Werke des ursprünglich als Rechtspraktikant in der Statthalterei arbeitenden Alban, der den Dienst freilich 1906 quittiert hatte, um sich ganz seinem Studium bei Arnold Schönberg zu widmen, wurden immer mehr beachtet, von avancierten Kreisen geschätzt, ab den zwanziger Jahren immer häufiger bei Avantgardefesten von bedeutenden Künstlern gespielt.
Sein Hauptwerk, die 1917 bis 1925 nach Georg Büchners dramatischem Fragment entstandene Oper „Wozzeck”, wurde 1925 in der Berliner Oper Unter den Linden mit sensationellem Erfolg uraufgeführt und in den folgenden Jahren — wenn auch unter manchen Protesten — immer wieder gespielt. Sie galt bereits zu Lebzeiten Alban Bergs als „Kultwerk” der Zwischenkriegszeit, das, wie keine zweite Oper „aus dem expressionistischen künstlerischen Willen geboren, ein erschütterndes, den Menschen im tiefsten berührendes Erlebnis vermitteln” konnte (Karl H. Wör-ner).
Ja, es stand selbst für die meisten der Gegner dieser musikalischen Entwicklung — ich meine, der ernsthaft Kritik übenden Gegner - stets fest, daß sich mit dem in freier Atonalität komponierten „Wozzeck” und mit der streng zwölftönig entwickelten Wedekind-Oper „Lulu” (1928/35)
— die erst in den siebziger Jahren vom Wiener Avantgardekomponisten Friedrich Cerha zur dreiaktigen Fassung vollendet und von Pierre Boulez in Paris mit sensationellem Erfolg uraufgeführt wurde - eine in der Geschichte der Oper vorher nie erreichte künstlerische Kongruenz von Drama und eigengesetzlicher Musik realisiert hatte.
Was im Schaffen Alban Bergs, das eigentlich sehr klein an Umfang ist, immer wieder provozierte, waren der exzessive Aus-drucksgestus, der bohrende Expressionismus, das schonungslose Aufdecken der menschlichen Gefühle, der Triebe — als ob der Analytiker Freud mitgearbeitet hätte.
Die Besessenheit, mit der Berg etwa die Triebwelt und Getriebenheit Wozzecks Schichte für Schichte aufdeckt, ließ ultrakonservative Kritiker nach der Berliner Uraufführung von „Irrenhaus” und „Verbrechen an der Musik” sprechen, während andere bereits dem genialen Werk seinen Siegeszug voraussagten.
So stand es um Bergs Werke zu Lebzeiten: hier begeisterte Aufnahme für „Wozzeck”, das Kammerkonzert (1925), die „Lulu”-Sinfonie (1934), kurz: der ganze Werkbogen von der Klaviersonate (op. 1) bis zum Violinkonzert (1935), das zum Requiem für die verstorbene Manon Gropius wurde, dort radikale Ablehnung.
Der Mittelweg war im Fall Berg undenkbar, das Ubersehen und Uberhören dieser Werke unmöglich: Berg verabscheute künstlerische Kompromisse und strebte in allen seinen Werken mit höchster Konsequenz nach der idealen Verbindung von Konstruktion und Ausdruck. Doch sollte diese Verbindung einer Idee dienen:
„Mag einem noch soviel davon bekannt sein, was sich im Rahmen dieser Oper an musikalischen Formen findet, wie das alles streng und logisch gearbeitet ist, welche Kunstfertigkeit selbst in allen Einzelheiten steckt”, schreibt Berg selbst über „Wozzeck”, „von dem Augenblick an, wo sich der Vorhang öffnet, bis zu dem, wo er sich zum letzten Male schließt, darf es im Publikum keinen geben, der etwas von diesen Fugen und Inventionen, Suiten und Sonatensätzen, Variationen und Passacaglien bemerkt, keinen, der von etwas anderem erfüllt ist, als von der weit über das Einzelschicksal Wozzecks hinausgehenden Idee”.
Ein Berg-Bekenntnis, das im Grunde durch jede Partitur des Komponisten zu belegen ist — und das man gerade in den kommenden Jahren, wenn nun endlich zum 100. Geburtstag auch die kritische Alban-Berg-Werkausgabe vorgelegt werden wird, aus der Edition vieler Skizzen besonders deutlich wird ablesen können.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!