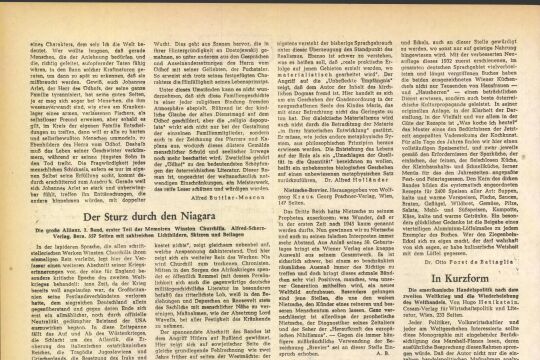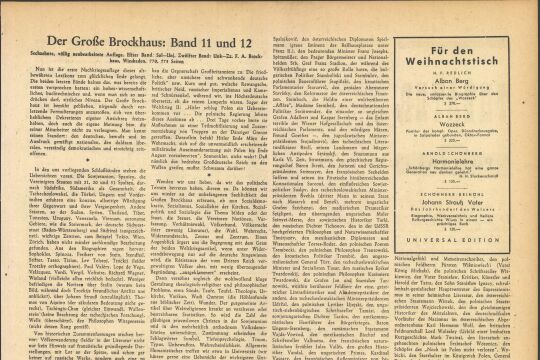Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Alexander Solschenizyn: „August 1914“
Zwei Nobelpreisträger schrieben bisher über das Thema 1914. Zuerst der Franzose Roger Martin du.Gard, der für „Sommer 1914“ den Literaturpreis 1937 bekam. Dieses Buch ist der Abschluß eines großangelegten Familienromans und reflektiert auf die Spätkrise jener aristokratischbürgerlichen Welt, die sich ihrer selbst nicht mehr gewiß ist: Epigonen dieser Ära kämpfen bereits in der sozialen Revolution mit, während „der Rest“, die Unpolitischen, mit seltsamer Gelassenheit ihren „natürlichen Widerwillen gegen das Politische“ im subtilen Genuß verfeinerter Lebensformen ausleben. Für die letzteren gibt es den Tod im Massaker der Materialschlacht, für die Revolutionäre die Existenz im Morgenrot des Neuen. Du Gard, der Herkunft nach bürgerlich, liberal und dergleichen mehr, umgibt seinen Roman vom Leben, Lieben, Sterben mit jener behaupteten historischen Sachgerechtigkeit, die die Mentalität der Entente 1914/18 und die Revolution für sich beanspruchen. Das Buch, das kurz vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges mit der Stigmatisierung des Nobelpreises dem Hitlerismus entgegengehalten wurde, war sozusagen zeitgemäß.
Licht aus dem Osten
Nichts dergleichen 1970/71 bei Solschenizyn. Nur kurz geht der Autor auf jene bürgerlichen Typen, Modell 1914, ein, für die „der Sozialismus durchaus denkbar wäre“, wenn er nur nicht „gar so sehr mit Enteignung verbunden“ wäre; die für Maxim Gorki schwärmen; und die den Revolutionären vorsichtshalber unter der Hand Kampfspenden entrichten. Neben diesen blutarmen Figuranten stellt Solschenizyn eine brennende Jugend, in der schon „Jahrzehnte politischer Literatur“ präsent sind, die angetrieben ist von Idealen der Intelligenzia und dem Aufbegehren gegen ein autokrati- sches System. Pazifistische Anhänger Tolstois, intellektuelle Linksliberale, Marxisten, Anarchisten und Nihilisten. Den Bürgerlichen und den Revolutionären hält der Autor vor, daß sie zu jener „wahnwitzigen russischen Gesellschaft“ gehörten, die sich wie ein Kind über die Niederlage Rußlands im Krieg gegen Japan (1905) freuten. So wie sich ein unvernünftiges Kind über seine Krankheit freut, wenn es deswegen irgend etwas nicht zu tun oder nicht zu essen braucht. Ohne zu begreifen, daß diese Krankheit es für alle Zeiten zum Krüppel zu machen droht. In diesem Jahr 1971 ist es das Anliegen der katholischen Amerikanerin Mary McCarty und Konsorten, ihrem Land die Niederlage in Ostasien zu wünschen.
Solschenizyn übersieht nicht den großen Exodus der Jungen, der 1914 in allen kriegsführenden Ländern stattfand. Aber er wertet ihn nicht ab, wie jene deutschsprachigen Autoren, die damit nicht fertig werden, daß in diesem Exodus Hitler und Toller marschierten, Zuckmayer und Renn, Marc und Kokoschka usw. Und daß hinter diesen Jungen jene Großen der zwanziger Jahre standen, die wie Thomas Mann ihren „Geist von 1914“ später unter Verschluß nahmen. Nicht die Jungen klagt der Russe an, sondern besagte intellektuelle Versager, die nach dem Krieg jene erste „verlorene Generation" produzierten, der bis dato noch mehrere folgen sollten. Überhaupt: der russische Nobelpreisträger recht- fertig oder verdammt nicht die Ideologien, er beschreibt Menschen in der äußersten Geworfenheit.
Es gibt noch Soldaten
Solschenizyn kennt und anerkennt Sodaten: den Feldwebel, der „nicht hüstelt oder murmelt wie zuweilen Offiziere“, der aufbrüllt im Gefecht wie ein Löwe und das Murren, Wiehern und Knirschen überschreit. Infanteristen, die sich „vordienstlich, verständisch, vorstaatlich, vorbeam- tenhaft“ verhalten in der „unbefangenen Einfachheit“ der Natur. Der intellektuelle Nihilist in Fähnrichsuniform kann nicht verstehen, daß diese Soldaten, die ihm gründlich mißtrauen, ihren verwundeten Oberleutnant aus der Schlacht schleppen; keuchend, atemlos, mit letzter Kraft; einen Menschen, der Karten spielt, den Mutterfluch im Munde führt und dreckige Witze erzählt.
Solche Soldaten wußten, was Solschenizyn weiß: daß „die deutsche Armee (1914) die derzeit stärkste der Welt war, daß es eine von einem allumfassenden patriotischen Gefühl erfüllte Armee war, eine Armee mit einem vorzüglichen Führungsapparat, eine Armee, die das Unvereinbare vereinigt hat; die ‘ widerspruchslos preußische Disziplin und die flexible europäische Eigeninitiative“. Solche Ansichten legt der Autor den reformfreudigen „Jungtürken“ der kaiserlich-russischen Armee von 1914 in den Sinn.. Vor allem einem Häuflein von Generalstäblern, die von der Art waren, die es „im deutschen Heer in Überfluß“ gab und die dort „bis hinauf zum Armeeoberkommando“ an der Macht waren. Und an anderer Stelle: „Zu Bismarcks Zeiten hätte es ein Dreikaiserbündnis gegeben, das östliche Europa hatte ein halbes Jahrhundert lang in Ruhe gelebt. Der russisch-deutsche Frieden war nützlicher gewesen als diese Kundgebungen mit den Pariser Zirkusleuten.“ Gemeint waren Staatsbesuche aus Paris in St. Petersburg von 1914.
Ein unzeitgemäßes Buch
Unter den arrivierten Schriftstellern, die derzeit in Deutschland und Österreich in deutscher Sprache schreiben, würde sich wohl kaum einer finden, der sein berufliches
Renommee als Autor von Bestsellern aufs Spiel setzen würde, um Derartiges im Hinblick auf das deutsche Heer oder die österreichische Armee von 1914 zu Papier zu bringen. Derzeit reicht der Wortschatz der deutschen Sprache nicht aus, um jene Kaskaden von Sottisen zu verfassen, mit denen die bodenlose Verachtung der ehemaligen Mittel-
Und also tut sich jetzt eine auf derlei Literatur abgestellte Buchkritik zuweilen schwer, dem neuesten Werk eines Nobelpreisträgers, der nicht nur Kommunist ist, sondern Russe und Soldat, die gewohnten Honneurs zu machen. Man quält sich mit Vergleichen ab: die früheren Anklagen Solschenizyns gegen den Stalinismus erführen jetzt im Falle der Generalität ihre Fortsetzung; hier wie dort Verschleiß „billigen Menschenmaterials“; wie unter Stalin so auch hier „Schreibtischtäter“ und deren „Schreibtischopfer“; kein Sachbuch, was soviel heißen soll, daß das auf 765 Seiten beschriebene militärische Geschehen nur romanhaft und nicht „sachgerecht“ ist; jedenfalls, und damit resümiert man, kein nationalistisches Buch.
Nein, Solschenizyn schreibt keine Bücher nach dem Motiv: Mit Gott für Zar und Vaterland, wie solche in der russischen Emigrantenliteratur auftauchten. Er produziert keinen Spätnationalismus und keinen Nationalbolschewismus. Und vor allem: Solschenizyn produziert keine Bücher mit Schwarzweißzeichnungen wie Heinrich Böll, neuerdings Präsident des internationalen PEN, in „Gruppenbild mit Dame“. Der Russe, im Gegensatz zur Prominenz unter den engagierten Literaten deutschen Linken, nach Krieg, Verschickung und Diskriminierung im eigenen Land immer noch Mensch ohne Scheuklappen, enthält sich jener betulichen Situationsschilderungen, in denen oft jene groß sind, denen manchmal die „Unmittelbarkeit eigener Erlebnisse“ stark abgeht. Und weil dem so ist, möchte man wissen, daß dieses Buch auch nicht in andere Maschinerien der Propaganda gerät, deren Produkte zuweilen auf den. Schmuck der Größe anderer angewiesen sind. Etwa mit dem Hinweis: Er ist unser.
Gott ist nicht tot
Viele Fernsehteilnehmer ln der vom bürgerlichen und sozialistischen Atheismus erfüllten freien Welt des Westens werden sich über die sowjetische Verfilmung von Tolstois „Krieg und Frieden“ gewundert haben. Der Ausdruck individueller Frömmigkeit, der offenbar macht, was dem Westen bereits vielfach abgeht, war nicht zu übersehen. Solschenizyn schreibt in seinen Büchern oft über Gott, über das Gebet des Menschen zu Gott, über eine oft ergreifende Frömmigkeit. Er übersieht dabei keineswegs gewisse Popen, die in diesen Dingen nichts zu sagen haben; aber er kennt und erkennt jenen priesterlichen Typus, der, „wenn es auf Leben und Tod geht“, mit dabei ist. Das christliche Begräbnis, das russische Infanteristen bei Fehlen eines Popen ihrem Obersten bereiten, ist zweifellos Vorbild für manche routinemäßige konfessionelle „Verabschiedung“. Und da ist das Gebet des unglücklichen Verlierers in der Schlacht von Tannenberg, des russischen Oberbefehlshabers Samssonow, am Tag von Mariä Himmelfahrt und angesichts des Todes.
Manche bringen das jetzige Werk Solschenizyns mit besagtem Werk Tolstois in Verbindung. Aber Solschenizyn wird andere Wege gehen, wenn er das, was er „Hauptvorhaben seines Lebens“ nennt, richtig zu Ende bringen will. In seinem letzten Werk, in dieser Legierung so vieler Elemente, taucht die Figur des Gene- ralstabsobersten Worotnyzew auf, wie ein Katalysator. Diese Personifikation der Kriterien des Autors über lebt die Katastrophe von Tannenberg. Dem Obersten ist geweissagt worden, er werde erst 1945 als Soldat sterben. Seine Kriterien angesichts der Revolution von 1917 und des zweiten Weltkriegs werden wohl erst den Querschnitt des Ganzen sichtbar machen. Sie werden Maßstab dafür sein, ob Solschenizyn die ses bereits 1936 begonnene Hauptwerk seines Lebens auf der Höhe der Zeit beschließen wird.
„AUGUST NEUNZEHNHUNDERTVIERZEHN.“ Von Alexander Solschenizyn. Langen-Müller-Verlag, München. 765 Seiten. S 226.50.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!