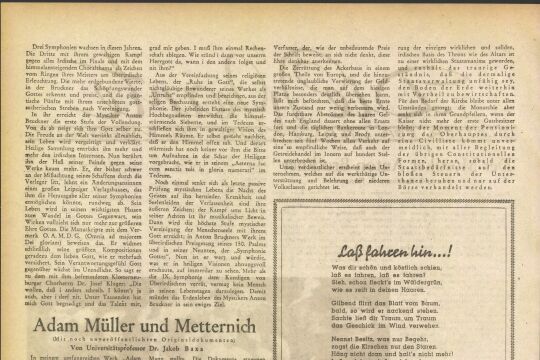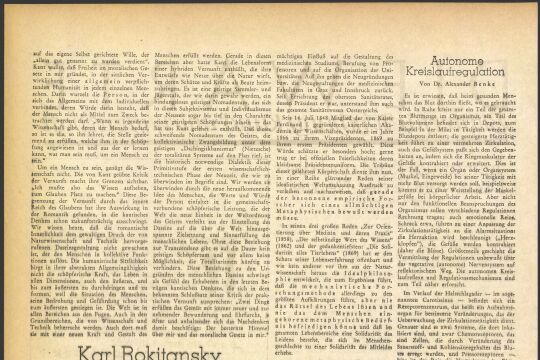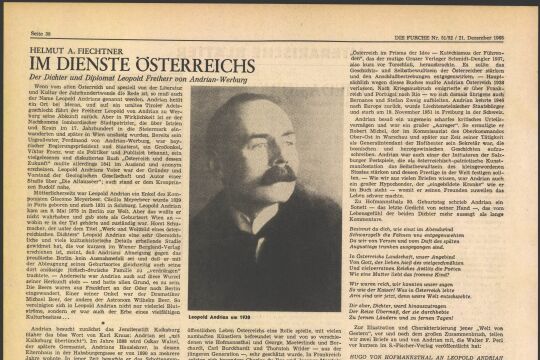Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Armer Astronom auf Brautschau
Der Pferdewagen mit Kepler und seinem Vetter traf am 11. April 1594 im steiermärkischen Graz ein. Der künftige Astronom beeilte sich, seinen neuen Wirkungskreis kennenzulernen: den Rektor der kaum 20 Jahre alten protestantischen Stiftsschule, das zwölfköpfige Lehrerkollegium, die Herren vom Schulausschuß, alles Adelige, schließlich die Inspektoren. Wer in der obersten Klasse lehrte, wurde als Professor bezeichnet. Der 23jährige Kepler gehörte zu ihnen.
Hier war nun aber nicht alles so, wie Kepler gehofft hatte. Nach 14 Tagen schon packte ihn das „Ungarische Fieber“ und warf ihn für zwei Wochen aufs Krankenlager. Erst eineinhalb Monate nach seiner Ankunft konnte er mit dem Unterricht beginnen. Zwar waren die Inspektoren und Kollegen freundlich zu ihm, und die Stadt als Ganzes konnte Kepler wohl behagen, aber es gab für die Schüler die verführerische Möglichkeit, dem Mathematikunterricht fernzubleiben. Die Teilnahme war freiwillig. Dies kam den meisten sehr gelegen. Die Mathematik hätte ihnen „schmackhaft“ gemacht werden müssen, sofern dies überhaupt möglich ist. Doch Keplers pädagogische Fähigkeiten sollten sich ja hier erst entwik- keln. Dazu kam es nicht. Zunächst war die Teilnahme schwach. Im Jahre darauf blieben die Schülei; fast ganz weg. Richtig erkannten die Inspektoren: „ weyl Mathematicum Studium nit jedermanns thuen ist.“
Kepler allerdings gab sich selber auch einen Teil der Schuld. Er habe während des Unterrichts, da ihm ständig etwas Neues einfalle, vieles überstürzt und angefangene Gedanken nicht zu Ende geführt. Es falle ihm immer alles auf einmal ein. Als Ausgleich für den gescheiterten Mathematikunterricht behandelte Kepler dann, was der römische Dichter Vergil gelehrt und geschrieben hatte. Dabei war Kepler wohl am meisten an der Frage gelegen, wie sich ein mythologischer Stoff mit dem geschichtlichen verbinden ließe.
Neben der Ethik nahm er dann auch in der Rhetorik den Unterricht auf, jener Kunst, eine Rede logisch perfekt und formvollendet zu gestalten.
Ärgerlich war, daß die damals in der Steiermark führende Schicht der Adeligen, deren Kinder die Stiftsschule besuchten, für die Wissenschaften kaum Verständnis aufbrachten. Sie kümmerten sich um niemand weniger, wurde Kepler zugeflüstert, als um Gelehrte und wissenschaftliche Koryphäen. Dagegen war ihnen an astrologischen Prophezeiungen sehr gelegen. Die Frage, wann die Ländereien bestellt werden sollten — im Grunde eine Frage nach dem Wetter —, wie in diesem Jahr die Ernte ausfallen werde, auch die politischen Aussichten^ rund ob mit Seuchen zu rechnen sei, sollten unbedingt an den Sternen abgelesen und im Jahreskalender veröffentlicht werden.
Keplers. Professur schloß die Tätigkeit eifies Landschaftsmathematikers und Kalendermachers ein. Noch war kein halbes Jahr seit seiner Ankunft in Graz vergangen, hatte er schon den Kalender für 1595 herausgebracht — er war ein voller Erfolg. Das Bändchen mußte, wie es auch Keplers Vorgänger getan hatte, mit den „Prognostica“ versehen sein, mit den Vorhersagen also. Kepler erinnerte sich an seine Tübinger Erfolge auf diesem Gebiet. Schon damals hieß es, daß er sich in den Horoskopen gut auskenne.
Es ist schwer zu sagen, ob er zu der bekannten Methode der Astrologen griff, Wahrscheinliches als Vorhergesagtes anzubieten, um die verlangten „Prognostica“ drucken zu lassen, oder ob er ernsthaft auf die Himmelszeichen vertraute. Offenbar befand er sich bald in einem zermürbenden Zwiespalt: Einerseits warnte er davor, sich auf seine astrologischen Deutungen zu verlassen, andererseits boten sie ihm Gelegenheit, weit und breit auf sich aufmerksam zu machen. Damit verband er die Hoffnung, „den ungeordneten und verderblichen Begierden der Menge geeignete Mahnungen einzuträufeln, was auf andere Weise kaum erreicht werden kann“. Das war Astrologie als Mittel zum guten Zweck.
Der Kalender für 1595 ist zwar nicht erhalten geblieben, aber wir wissen aus Briefen, daß Türkeneinfälle und eine grimmige Winterkälte darin vorhergesagt worden waren. Beides traf ein. Die Türken brandschatzten das Land vor allem südlich von Wien, auf den Höhen erfroren einige Sennen, die nicht rechtzeitig in die Dörfer abgestiegen waren. Ferner hatte Kepler Unruhen unter den Bauern Oberösterreichs vorhergesagt. Wie zu erwarten war, trat auch dieses Ereignis ein.
Der „Einstand“ Keplers mit Hilfe des Jahreskalenders ebnete ihm die Wege in die Gesellschaft. Jetzt war er auch beim Adel bestens angesehen. Bald fand er Zugang zu deren Familien, obwohl er selber nicht von Adel war, wie es damals noch schien. Die Gespräche drehten sich in den Adelshäusern auch um Politik und Kriegsgefahr. Kepler sah sich von Fragestellern bedrängt. Doch in seinen Prognosen für 1598 bekannte er: „Dem Stärkeren unter zwei Feinden kann der Himmel — gemeint waren die Gestirnstellungen — nicht viel schaden, dem Schwächeren nicht viel nutzen. Wer sich mit gutem Rat stärkt, mit Volk und Waffen, mit Tapferkeit, der bringt auch den Himmel auf seine Seite. Und wenn jener ihm zuwider, überwindet er jene und alles Unglück.“ (Man sieht, es war ihm wirklich auch an den menschlichen Eigenschaften und der Vernunft gelegen und nicht nur an astrologischer Abhängigkeit von den Planetenstellungen zwischen den Sternbildern.)
Seinen letzten Grazer Kalender, den für 1600, schrieb er nur noch mit Widerwillen. In einem Brief an den bayerischen Kanzler Herwart von Hohenburg, seinem Gönner, mit dem er entfernt verwandt war, nennt er seine Prognostica „eine höchst lästige Sklavenarbeit, aber eine notwendige .... um also das jährliche Gehalt, meinen Titel und Wohnort zu halten, muß ich törichtem Vorwitz willfahren“. Kepler hat in den Grazer Jahren sechs Kalender mit Voraussagen veröffentlicht, im ganzen aber sind 17 Prognostica von der Keplerfor schung erfaßt. Er erlag auch später immer wieder den drängenden Forderungen seiner Brotherren — und der Möglichkeit eines so notwendigen Nebenverdienstes.
Nebeneinkünfte waren um so mehr erwünscht, als eine Ehefrau für ihn gesucht wurde und ein Hausstand gegründet werden sollte. Bevor es jedoch zur Hochzeit kam, mußte noch manche Schwierigkeit behoben werden. Zwar bemühten sich nach damaliger Sitte einige Freunde darum, eine möglichst wohlhabende Braut zu finden, indessen war Kepler aber, intensiv mit seinen Studien beschäftigt.
Als künftige Braut war von Freunden die Tochter des Mühlenbesitzers Jobst Müller vorgeschlagen worden. Dieser besaß südlich von Graz zu Gössendorf das Schlößchen Mühleck mit einigen Ländereien und war ein wohlhabender Mann. Seine Tochter Barbara, noch keine 23 Jahre alt, etwas rundlich geraten, wie ein Bild zeigt, war bereits zum zweiten Mal Witwe. Schon mit 16 Jahren hatte sie, wenn auch ungern, den 40jährigen Hoftischler Wolf Lorenz geheiratet und von diesem die Tochter Regina. Der Tischler kränkelte sofort und starb nach zwei Jahren. Ein Bauzahlmeister Marx Müller, ebenfalls 40 Jahre alt, wurde ihr zweiter Mann. Er brachte aus einer früheren Ehe mehrere mißratene Kinder mit und starb 1595. Es stellte sich her aus, daß er umfangreiche Unterschlagungen begangen hatte.
Kein Zweifel, die dritte Ehe mußte sorgfältiger geplant werden. Bei dem Mühlenbesitzer galten vor allem wirtschaftliche Gesichtspunkte. Gelehrte waren ihm unsympathisch. Und nun auch noch dieser Kepler mit nur 150 Gulden im Jahr? Nicht einmal ein Adeliger!
Jobst Müller war zwar selbst nicht von Adel (sein Sohn wurde später geadelt), doch nannte er wenigstens ein Schlößchen sein eigen, und in der steiermärkischen Gesellschaft galt damals ein Adeliger immer als ein bevorzugter Schwiegersohn.
Keplers Heiratsvermittler waren ein Arzt, Johann Oberndorfer, zugleich Inspektor an der Stiftsschule, und Professor Osius, Diakon an der Stiftskirche. Auf der Gegenseite agierten des Mühlenbesitzers Sippenangehörige, darunter ein gewisser Zeiler.
Man kann sich leicht vorstellen, was die verhandelnden Parteien auch im persönlichen Gespräch beim Wein im Hinterstübchen einer Schenke vorbrachten. Kepler sei doch mit seinen Prognosen erfolgreich, mögen seine Brautwerber hervorgehoben haben. Und was das niedrige Professorengehalt betreffe, so sei doch anzunehmen, daß es nach der Eheschließung auf mindestens 200 Gulden jährlich erhöht werde.
Aus dem soeben im Styria-Verlag, Graz, erschienenen Werk „Johannes Kepler - Er veränderte das Weltbild“ von Günter Doebel.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!