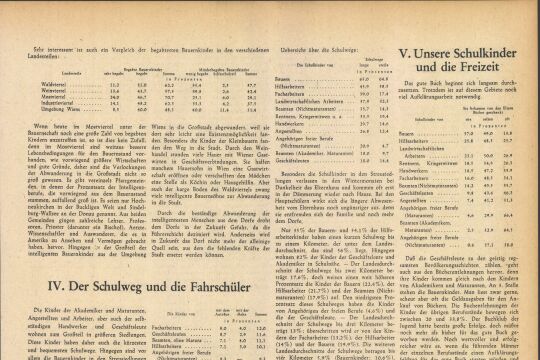Auch das beste Heim kann kein Ersatz für die Familie sein
Der Polizeibericht sprach von zwei Toten, von Totalschaden. Der Lokalredakteur baute die Meldung mit mehreren ähnlichen zu einem Einspalter zusammen. Der tägliche Tribut an den Moloch Verkehr.
Der Polizeibericht sprach von zwei Toten, von Totalschaden. Der Lokalredakteur baute die Meldung mit mehreren ähnlichen zu einem Einspalter zusammen. Der tägliche Tribut an den Moloch Verkehr.
Zurück blieben zwei Kinder, vier und sechs Jahre. Keine Verwandten, die sie hätten aufnehmen können (oder wollen). Endstation Waisenhaus? Für sie wie für alle jene, die aus tristen Familienverhältnissen einen Ausweg finden sollen?
Ende 1976 lebten mehr als 8000 Jugendliche in Fürsorgeheimen, fast 36.000 standen unter Aufsicht der Jugendämter.
Heime sind eine Sackgasse für die jungen Menschen, eine Fortsetzung ihrer schlechten Familienerfahrungen, ein Teufelskreis, dem sie nicht mehr entrinnen können. Daher zielt die Sozialarbeit immer mehr auf eine vorbeugende Betreuung der Familien, um die Aufnahme von Kindern in Heime nur noch als letzten Ausweg in Anspruch nehmen zu müssen.
Kürzlich kamen in Wien bei einem europäischen Symposion über Probleme der Heimerzieherausbildung Pädagogen, Psychologen, Soziologen, Sozialarbeiter und Mediziner zusammen, um Modelle für eine moderne Erzieherausbildung zu entwickeln. Der künftige „Sozialpädagoge“ soll nicht nur Heimerzieher sein, sondern auch in Kindergärten, Jugendzentren und Familienberatungen, bei der Betreuung alter und behinderter Menschen tätig sein und ebenso für Jugendliche, die nach einem Heimaufenthalt ins „normale“ Leben zurückkehren.
Auch die vorsorglichste Familienbetreuung kann die Notwendigkeit von Heimen nicht aufheben, die modernste und beste Heimerziehung jedoch eine funktionierende Familie nicht ersetzen. Das können am ehesten noch Pflege- oder Adoptiveltern. Das wissen alle jene sehr gut, die sich bemühen, Kindern statt einem Erziehungsheim eine Familienalte mative anzubieten, denn es kann sich dabei im besten Fall um eine Alternative zum Heim handeln. Die Gesellschaft, die Familien zerstört, können sie kaum verändern.
Langjährige Erfahrungen und breiten Einsatz liefern hier die SOS-Kirb- derdörfer. Ausgehend von Österreich hat dje Idee Hermann Gmeiners schon in der ganzen Welt Fuß gefaßt; das Kinderdorf in der Hinterbrühl bei Mödling hat unlängst seinen 20. Geburtstag gefeiert. Die Prinzipien der Kinderdörfer sind bis heute gleichgeblieben: Die Kinder sollen eine Mutter haben, mit ihren Geschwistern zusammenbleiben, in einem eigenen Haushalt mit Mutter und Geschwistern eine selbständige Einheit bilden und darüber hinaus die Dorfgemeinschaft als sozialen, überfamiliären Bereich erleben. Ein wesentliches Element des Kinderdorfes ist die religiöse Erziehung, gleich, um welche Konfession es sich dabei handelt.
Lange Jahre hindurch hat der Vater im Kinderdorf gefehlt, denn Ehepaare für ein Kinderdorf zu finden, ist unmöglich. Die Notwendigkeit männlicher Bezugs personen hat dazu geführt, daß als pädagogische Mitarbeiter im Dorf in erster Linie Männer eingesetzt werden. Aufgenommen werden Kinder nur bis zum zehnten Lebensjahr, eine Ausnahme wird gemacht, wenn Geschwister getrennt werden müßten. Die Mehrzahl der SOS-Kinderdorfkinder sind Vollwaisen. Bei Halbwaisen ist es immer die Mutter, die gestorben ist; Väter behalten auch Schulkinder nur äußerst selten.
In Österreich bewerben sich pro Jahr rund hundert Frauen als Kinderdorfmütter. Die Auslese ist sehr streng, und es bleiben meistens nicht mehr als fünf übrig. Sie werden vier Semester lang in einer Mutterschule in der Bundesrepublik Deutschland ausgebildet, sind aber weder ausgebildete Pädagogen noch Psychologen. Wesentlich ist die Mütterlichkeit, für Erziehungsprobleme stehen ihnen männliche Therapeuten und Pädagogen zur Seite. Frauen, die sich für eine Kinderdorf-Laufbahn entscheiden, verzichten freiwillig auf eine eigene Familie. Nicht einmal mit einem Ehemann ohne Kinder läßt sich diese Aufgabe verbinden. Da sie Angestellte mit einem Gehalt und Pensions- und Krankenversicherung sind, steht es ihnen frei, ihren „Arbeitsplatz“ zu verlassen; das kommt allerdings nur sehr selten vor.
In einem Kinderdorf-Haus lebt eine Mutter mit durchschnittlich acht Buben und Mädchen im Alter von einigen Monaten bis zu 20 Jahren. Jede Mutter hat ein Haushaltsbudget, zu dem sie ihren Anteil für die laufenden Ausgaben beisteuert. Sie führt ein Wirtschaftsbuch, das kontrolliert wird, wirtschaftet jedoch nach ihrem Gutdünken, kauft ein, wo und was sie will. Die Kinder bekommen ihrem Alter entsprechend Taschengeld, über das sie frei verfügen können. Hat eine Kinderdorf-Mutter das 50. Lebensjahr erreicht, werden ihr keine Kleinkinder mehr zugeteilt. Damit wird eine Unterbrechung in der Beziehung zum Kind vermieden, wenn die Mutter in Pension geht. Die meisten tun dies schpn mit 55; ständige Kindererziehung mit Engagement und totalem Einsatz ist ein befriedigender, aber sehr harter Beruf.
Für pensionierte Mütter entstehen Mütterhäuser. So bleiben sie im Dorf integriert und fühlen sich nicht abgeschoben. Ehemalige Kinderdorf-Angehörige kommen oft auf Besuch, auch mit ihren Familien. Dann übernimmt die Kinderdorf-Mutter auch Großmutterfunktion, wenn die jungen Eltern einmal Zeit für sich haben wollen. Der Kontakt mit den anderen Müttern und Kindern im Dorf ist sehr gut; viele Kinderdorf-„Kinder“ heiraten untereinander.
Da sie in öffentliche Schulen gehen und später Berufe ergreifen, können im Kinderdorf nur Kinder aufgenommen werden, die die Voraussetzungen dafür mitbringen. Besonders schwierige, psychisch und sozial gestörte Kinder müssen in Heimen untergebracht werden. Nach der Pflichtschule können Burschen ins Kinderdorf-Jugendhaus übersiedeln. Mädchen haben diese Möglichkeit noch nicht, aber es werden bereits Mädchenwohnheime gebaut. Die Entscheidung, ins Jugendhaus zu ziehen, steht den jungen Leuten frei, die meisten von ihnen tun es jedoch wie alle Jungen, die anfangen, ihr eigenes Leben zu leben. Sie besuchen ihre Mutter und Geschwister aber regelmäßig. Im Jugendhaus arbeiten Erzieher mit einer regelmäßigen wechselnden Diensteinteilung.
Die Erziehung im Kinderdorf ist im allgemeinen noch traditioneller als dies sonst heute üblich ist, und die Richtlinien werden nur langsam modernisiert. Aber alles in allem wachsen dort junge Menschen heran, die ihr Leben bewußt in die Hand nehmen und ihren Kindern etwas weitergeben können, was sie in Fülle empfangen haben: Liebe und Wärme.
Den Versuch, mehreren Kindern mit Mutter und Vater ein Zuhause zu geben, unternimmt die Kinderdorfvereinigung Pro Juventute schon seit dreißig Jahren. Es handelt sich hier aber nicht um „Dörfer“, sondern um Einzelhäuser in Salzburg, Nieder- und Oberösterreich, in denen Pflegeeltem mit zehn bis vierzehn Kindern leben. Voraussetzung ist, daß die Pflegeeltem eigene Kinder haben, der Vater einen Beruf ausübt und die Mutter ohne Gehalt die Pflege von Kindern übernimmt, die sonst in einem Heim aufwachsen müßten. Die Erhaltung des Hauses bezahlt die Vereinigung, die Großfamilie lebt - von der Fürsorgeunterstützung abgesehen - vom Gehalt des Vaters und von den Kinderbeihilfen. Auch hier bleiben die Kinder, die oft als Säuglinge in Pflege kommen, bis zum Abschluß, ihrer Berufsausbildung. Im Vergleich zu den SOS-Kinderdörfern ist die Organisation Pro Juventute sehr klein: derzeit werden 200 Kinder betreut, 200 weitere haben ihre Berufsausbildung beendet und sind bereits fortgezogen. Das hat nicht nur finanzielle Gründe. Ist es schon für die Kinderdörfer schwer, geeignete Mütter auszuwählen, so ist es noch schwieriger, Ehepaare mit eigenen Kindern als Pflegeeltern für eine solche Großfamilie zu finden.
Nach einem völlig, anderen Konzept ist die „Stadt des Kindes“ in Wien angelegt. Ähnlich wie im SOS-Kinderdorf, leben dort jeweils zehn Buben und Mädchen im Alter zwischen drei und fünfzehn Jahren in einem Haus; wie dort, wird darauf geachtet, daß Geschwister zusammenbleiben. Die Auswahl der Kinder erfolgt gleichfalls unter der Voraussetzung, außerhalb der „Stadt“ öffentliche Schulen besuchen und arbeiten zu können. Nach der Pflichtschule verlassen die Jugendlichen ihr Haus. Die Mädchen leben von da an in zwei Lehrlingsheimen zu je 30, die männlichen Lehrlinge in Wohngruppen zu je zehn; dieser Unterschied kommt daher, daß mehr Mädchen in die „Stadt des Kindes“ kommen. Wie im Kinderdorf verlassen sie nach Abschluß ihrer Berufsausbildung die „Stadt“.
Im Unterschied zum Kinderdorf ist es hier das oberste Ziel, die Kinder in Ihre Familien zurückzuführen. Daher werden in die „Stadt des Kindes“ auch keine Waisen, sondern meistens Fürsorgekinder aufgenommen. Abgesehen vom ständigen Kontakt mit Schulen und Arbeitsplätzen, wird heute der Zusammenarbeit mit den Eltern große Bedeutung beigemessen. Insgesamt leben in der „Stadt“ 180 Kinder und 80 Jugendliche. Jede Gruppe hat ihr eigenes Budget, eine Großküche liefert unter der Woche das Essen, am Wochenende wird selbst gekocht. Psychologen und eine Fürsorgerin stehen ständig zur Verfügung.
Der wesentliche Unterschied zum Kinderdorf ist jedoch das Erzieher- Prinzip. Ausgehend davon, daß Mütter oder Eltern besser für einen Pflegeoder Adoptionsplatz geeignet sind, werden die Gruppen in der „Stadt des Kindes“ von je drei Erziehern und Erzieherinnen betreut, die im Turnus Dienst machen. Diese Erzieher sind speziell für schwierige Kinder und für die Gruppensituation ausgebildet und nehmen ihre Aufgabe sehr ernst. Probleme aus der Erzieherfunktion - verglichen mit der Kinderdorf-Mutter oder den Pro-Juventute-Eltem - treten natürlich immer wieder auf. Nicht nur durch den wechselnden Dienst, sondern auch durch den Austausch von Erziehern, die ihre Tätigkeit nicht mit einer eigenen Familie verbinden können. Das Bestreben, die Jugendlichen zu ihren Familien zurückzuführen, kann diesen Mangel sehr oft wettmachen.
Eine Mischung aus SOS-Kinderdorf und „Stadt des Kindes“ ist die „Gesellschaft österreichischer Kinderdörfer“, die in vier Dörfern mit Erziehern Kinder aus gestörten Familien und Waisen betreut.
Als Alternative zwischen Heim und Familie im Stadtbereich sind kürzlich in Wien Wohngemeinschaften entstanden, deren Konzept und Tagesablauf der „Stadt des Kindes“ sehr ähnlich ist. Jeweils acht Buben und Mädchen, auch Geschwister, leben in einer Großwohnung mit drei Erziehern, die einander turnusmäßig abwechseln. Auch diese Erzieher(innen) sind speziell ausgebildet und werden von einer Psychologin unterstützt, weil es sich vorwiegend um Fürsorgekinder handelt. Die Kinder besuchen öffentliche Schulen und bleiben bis zum Abschluß ihrer Berufsausbildung im Wohnungsverband.
Ziel der Wohngemeinschaften ist es, den Kindern trotz ihres schlechten Starts durch die gestörte Familiensituation in einer möglichst realen Umgebung den Einstieg in ein ihrer Persönlichkeit entsprechendes Leben zu ermöglichen. Dabei wird auf die individuellen Begabungen und Neigungen der Kinder Rücksicht genommen. Auch hier werden nur Kinder aufgenommen, die imstande sind, öffentliche Schulen zu besuchen und in einer Gruppe zurechtzukommen; ihre Familienverhältnisse machen aber eine Rückführung zu den Eltern meistens unmöglich. Die Erzieher(innen) sind sich im klaren darüber, daß sie den Kindern die Eltern nicht ersetzen können, sie versuchen jedoch, durch viel Zuwendung einiges gutzumachen.
Obwohl diese Modelle kein Ersatz für eine Familie sein können, verbindet sie bei all ihrer Verschiedenheit ein Wunsch und ein Ziel: alles zu tun, um diesen Kindern und Jugendlichen eine Chance zu geben.