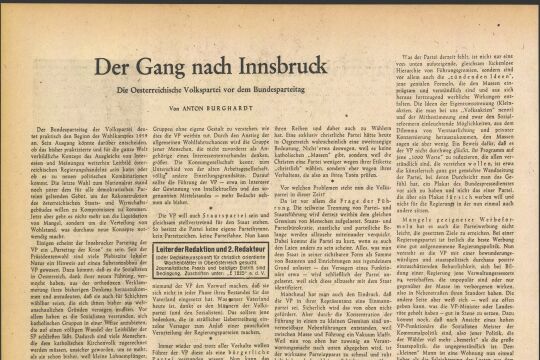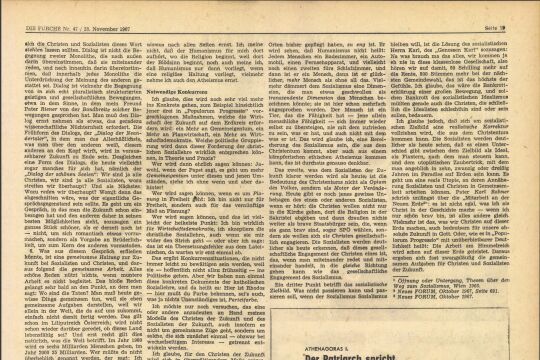Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Auch ohne Partei sind wir etwas!
Die Wiener Sozialisten haben bei der Nationalrats-wahl starke Stimmeneinbußen hinnehmen müssen. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Parteiarbeit?
Die Wiener Sozialisten haben bei der Nationalrats-wahl starke Stimmeneinbußen hinnehmen müssen. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Parteiarbeit?
FURCHE: Die SPÖ hat bei den Nationalratswahlen am 23. November allein in Wien fast 80.000 Stimmen gegenüber 1983 verloren. Die Wahlbeteiligung lag in der Bundeshauptstadt weit unter dem österreichischen Durchschnitt. Welche Ursachen hat diese Demobilisierung im „roten Wien“?
HANNES SWOBODA: Zwei Entwicklungen treffen die SPÖ. Einmal geht der Anteil der Arbeiter — der Kernschicht der Partei — in der Gesellschaft zurück. Und selbst unter den Arbeitern wird die Bindung an die Partei, aber auch die Selbstverständlichkeit, SPÖ zu wählen, immer geringer.
Andererseits ist es uns nicht gelungen, in der wachsenden sogenannten neuen Mittelschicht stärker Fuß zu fassen.
FURCHE: Gerade die Wiener SPÖ verfügt doch über ein dichtes Organisationsnetz. Warum kommen die Sektionen nicht mehr so recht an die Menschen heran?
SWOBODA: Der Zugang der Partei zu den Menschen über den Wohnbereich wird immer schwieriger. Ich will diese Möglichkeit zwar nicht aufgeben, aber wir müssen stärker als bisher in die verschiedenen Berufsgruppen hinein wirken. Ärzte, Künstler und Architekten zum Beispiel haben heute durch ihre Dominanz in den Medien eine wichtige Meinungsführerrolle in der Gesellschaft. In diesen Gruppen werden wir aber unter unserem Wert gehandelt — auch weü wir uns zu wenig um sie bemühen.
FURCHE: Die Zuspitzung der Programmatik auf Köpfe und Personen schlägt auch in der SPÖ immer mehr durch. Stört Sie diese Entwicklung?
SWOBODA: Am 23. November haben sicher viele Menschen gesagt, die SPÖ wähle ich nicht mehr, aber dem Vranitzky gebe ich meine Stimme. Dagegen habe ich dann nichts einzuwenden, wenn zwei Dinge feststehen:
Der Spitzenkandidat muß durch seine Person die wesentlichen Inhalte und Zielsetzungen der Partei zum Ausdruck bringen. Und zweitens sollte die Personalisierung in diesem Sinn auf allen Funktionärsebenen durchgesetzt werden - nicht in Form irgendwelcher hübscher und redegewandter Demagogen, die dann den übertrumpfen, der brav und treu für die Menschen arbeitet, sondern in der Form, daß sich die Personen, die politische Inhalte vertreten, nicht hinter der Partei oder dem Apparat verstecken.
Franz Vranitzky kommt ja auch deshalb so gut an, weil die Leute bei ihm das Gefühl haben, daß er nicht einer ist, der nur durch die Partei das geworden ist, was er ist
FURCHE: Ein Plädoyer gegen den Satz „Ohne Partei bin ich nichts“?
SWOBODA: Die Partei muß in Zukunft viel mehr von Leuten leben, die selbständig denken, ihre eigenen Gedanken in den Meinungsbildungsprozeß einbringen und die vielleicht nicht ihr ganzes Leben in der Partei gearbeitet haben. Das ist kein Vorwurf an die, die ihren politischen Weg über die Partei gehen. Aber die Belebung einer Organisation vollzieht sich eben auch dadurch, daß Leute von außen dazustoßen, Personen, die einen Berufsweg hinter sich haben.
FURCHE: Einer der großen Brocken in den laufenden Koalitionsverhandlungen ist die zukünftige Finanzierung unseres Sozialsystems. Die ö VP will mehr Eigenvorsorge. Was will die SPÖ ?
SWOBODA: Die schwierigsten Finanzierungsprobleme liegen im Pensionsbereich. Für mich persönlich gibt's da nur die Alternative einer Volkspension verbunden mit einer freiwilligen Höherversicherung. Für den einzelnen verteuert sich die Altersvorsorge dadurch ja nicht wesentlich, weil er schon jetzt durch seine Steuerleistung den Staatszuschuß zur Pensionsversicherung finanziert.
FURCHE:Die ÖVP will das Sozialsystem überhaupt mehr in Richtung ,ßilfe zur Selbsthilfe“ umkrempeln.
SWOBODA: Die bürokratisier-te - nicht im negativen Sinn gemeint — Form der sozialen Sicherheit bleibt die Basis. Darauf aufbauend können wir aber das System nicht mehr verbessern, wenn wir zusätzliche bürokratische Regelungen treffen, sondern nur durch die Schaffung individueller und flexibler Möglichkeiten.
Ich will keine Ersatzlösungen zur derzeit bestehenden sozialen Vorsorge, sondern sinnvolle, sogar notwendige Ergänzungen. Das ist für mich die nächste Stufe im sozialen Wohlfahrtsstaat. Der Rechtsanspruch auf soziale Grundabsicherung steht außer Diskussion, aber es kann zum Beispiel keinen rechtlichen Anspruch auf psychische Unterstützung von Krebskranken geben. Dafür eignet sich das Instrument der Selbsthilfegruppen besser.
FURCHE: All das deutet auf eine gewisse ideologische Ernüchterung. Hat die SPÖ unter den
Mühen des Regierungsalltags den langen Atem für ursprüngliche gesellschaftspolitische Utopien verloren?
SWOBODA: Ist es nicht eine schönere Utopie, wenn wir eine gewisse soziale Basissicherung garantieren und darüber hinaus helfen sich die Menschen untereinander in einem größeren Ausmaß von Solidarität, als wenn jeder ab einem gewissen Alter eine Krankenschwester zugeteilt bekommt?
Jede Utopie ist die Projektion einer bestimmten gesellschaftlichen Entwicklung. Insofern greift aber die Utopie auch zu kurz, weil in der gesellschaftlichen Entwicklung Brüche vorkommen. Und ab einem gewissen Niveau einer Entwicklung treten ihre negativen Tendenzen deutlicher hervor. Dann muß ich versuchen, dieser Entwicklung eine andere Richtung zu geben, die durchaus wieder etwas mit einer Vision zu tun hat.
FURCHE: Dahinter steht wohl auch ein neues Verständnis von Politik?
SWOBODA: Lange Zeit waren wir von einem großen Mißtrauen gegenüber dem „Bürger“ und seinen Aktivitäten geprägt — gewissermaßen nach der Devise: Was wir nicht für den Bürger tun, ist nicht optimal. Wir wissen, was für die Menschen gut ist.
Heute stehen wir in der Situation, wo wir immer mehr anerkennen müssen, was der betroffene Bürger wünscht. Wir können zwar versuchen, zu argumentieren, wenn wir eine politische Entscheidung für richtig halten. Tatsächlich entscheiden muß aber der Bürger selbst.
Alle Lösungen, die von oben kommen und nicht überzeugen, werden von den Betroffenen vielleicht entgegengenommen, nicht aber wirklich akzeptiert.
Solange der, den wir vertreten, unterdrückt, ausgebeutet und wehrlos war, solange ist die Politik von oben eine Grundvoraussetzung dafür, daß überhaupt etwas passiert. Aber in dem Moment, in dem wir ein gewisses Niveau von Befreiung und Wohlstand erreicht haben, ist diese Politik von oben nicht mehr machbar und auch nicht sinnvoll.
Denn dann tun wir nichts mehr für die Menschen, sondern nur noch etwas für die Parteifunktionäre. Und das kann ja nicht der Sinn der Politik sein.
Mit Hannes Swoboda sprach Tino Teller.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!