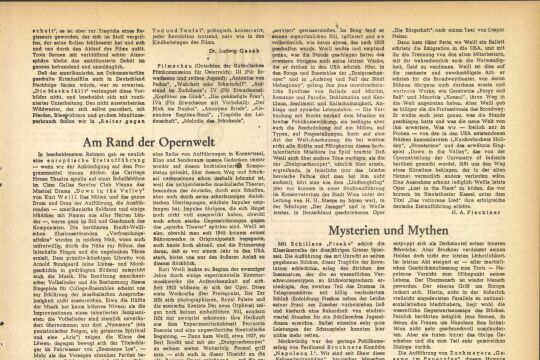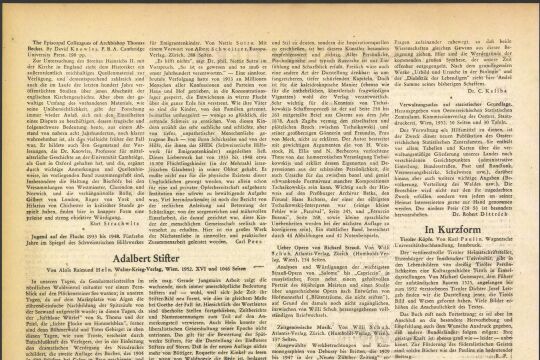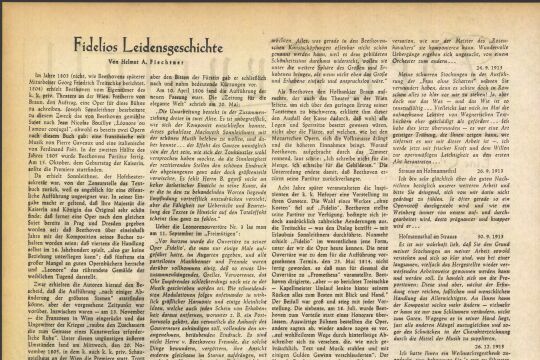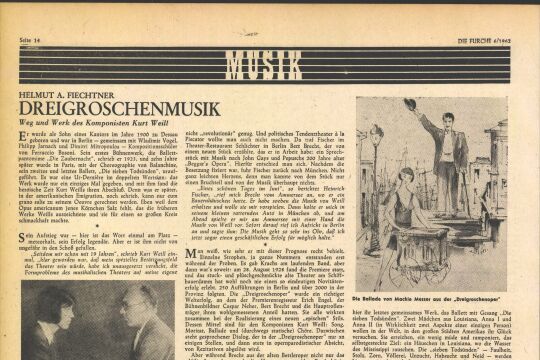Auf dem Weg zur Dreigroschenoper
Im Herbst des Jahres 1923 veranstaltete das Bauhaus, die modernste Kunstschule Europas, in Weimar die erste große Ausstellung mit Arbeiten der an diesem Institut wirkenden Lehrer Gropius, Klee, Kandinsky, Feinihger, Schlemmer und einiger anderer, die — wie wir heute wissen -— die Entwicklung der bildenden Kunst während der folgenden Jahrzehnte entscheidend mitbestimmt, ja eigentlich in ganz neue Bahnen gelenkt haben. In diese Darbietungen sollten auch die Ton- und die Bewegungskunst, also Musik und Ballett, einbezogen werden. Gewissermaßen als Repräsentant der musikalischen Moderne und Ehrengast würde Ferruccio B u s o n i nach Weimar gebeten, der die Reise dorthin in Begleitung zweier seiner Schüler antrat, die er seinerseits großzügig eingeladfen hatte. Diese beiden waren Kurt Weill und Wladimir Vogel.
Im Herbst des Jahres 1923 veranstaltete das Bauhaus, die modernste Kunstschule Europas, in Weimar die erste große Ausstellung mit Arbeiten der an diesem Institut wirkenden Lehrer Gropius, Klee, Kandinsky, Feinihger, Schlemmer und einiger anderer, die — wie wir heute wissen -— die Entwicklung der bildenden Kunst während der folgenden Jahrzehnte entscheidend mitbestimmt, ja eigentlich in ganz neue Bahnen gelenkt haben. In diese Darbietungen sollten auch die Ton- und die Bewegungskunst, also Musik und Ballett, einbezogen werden. Gewissermaßen als Repräsentant der musikalischen Moderne und Ehrengast würde Ferruccio B u s o n i nach Weimar gebeten, der die Reise dorthin in Begleitung zweier seiner Schüler antrat, die er seinerseits großzügig eingeladfen hatte. Diese beiden waren Kurt Weill und Wladimir Vogel.
Im Jahre 1907 war eine kleine Schrift, eine Broschüre von ganzen 48 Seiten Umfang mit dem Titel „Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst“ zunächst in Triest, dann 1910 im Insel-Verlag erschienen, und zwar in dessen kleiner Reihe, der Insel-Bücherei, wodurch sie sehr verbreitet, wenn auch nicht gerade „populär“ wurde. Wer heute dieses Büchlein liest, wird erkennen, daß alles oder fast alles, was sich während der letzten 50 Jahre auf dem Gebiet der neuen Musik ereignet hat, hier vorausgesagt, zumindest vorausgeahnt war. Das zentrale Thema dieser kleinen Schrift Busonis ist die Musik der Zukunft, bzw. die Zukunft der Musik. Hier finden wir nicht nur die erste Forderung nach obertonreihenfreien, also „farblosen“ Tönen,
Weill: Nicht nur Dreigroschenmusik die erst Jahrzehnte später mit elektronischen Geräten verwirklicht wurden, sondern auch den Begriff einer „jungen Klassizität“, wohl zu unterscheiden vom Neoklassizismus. Darunter versteht Busoni „die Meisterung, die Sichtung und Ausbeutung aller Errungenschaften vorausgegangener Experimente: ihre Hineintragung in feste und schöne Formen. Diese Kunst wird alt und neu zugleich sein“.
Busoni meint auch, daß es Abschied zu nehmen gilt vom Thematischen, d. h. von der thematischen Arbeit. Hingegen befürwortet er das Wiederaufgreifen der Melodie als Beherrscherin aller Stimmen, aller Regungen, als Trägerin der Idee und Erzeugerin der Harmonie. Scheinbar im Gegensatz hierzu steht eine andere Forderung Busonis: die höchst entwickelte, aber nicht komplizierte Polyphonie. Ein drittes nicht minder Wichtiges ist die Abstreifung des
Sinnlichen und die Entsagung gegenüber dem Subjektivismus. Das Zurücktreten des Autors hinter dem Werk sei „ein reinigender Weg, ein harter Gang, eine Feuer- und Wasserprobe: die Wiedereroberung der Serenitas: „nicht die Mundwinkel Beethovens und auch nicht das befreiende Lachen Zarathustras“, sondern echte Heiterkeit und Helligkeit. Nicht Tiefsinn und Gesinnung und Metaphysik, sondern Musik durchaus, destilliert, und niemals unter der Maske von Begriffen und Figuren, die anderen Bezirken entlehnt sind.
Überblickt man das Gesamtwerk des Lehrers und des Schülers, so mag einem scheinen, daß der letztere die hier auf gezählten Forderungen besser, d. h. zwangloser erfüllt habe als der Verkünder der neuen Lehre selbst.
Diese wurde übrigens von Hans Pfitzner heftig angegriffen, in einer kleinen ebenfalls nur 48 Seiten umfassenden Schrift mit. dem Titel „Futuristerigefahf". Sie erschien erst 1917, wär damals schon braun broschiert und, natürlich, in gotischen Lettern gedruckt. Auf sie einzugehen ist hier nicht der Ort. Pfitzner wandte sich vor allem gegen die Idee einer Zukunftsmusik, und auch der unübersehbare kosmopolitische Zug in der Persönlichkeit und in den Anschauungen Busonis mag seinen Ärger erregt haben.
Ferruccio Busoni, 1866 in Empoli in der Nähe von Florenz geboren, stammte aus einer deutsch-italienischen Familie, hatte die Kindheit in Triest verbracht und als musikalisches Wunderkind bereits mit zehn Jahren sein erstes Auslandskonzert, und zwar in Wien, gegeben. In Graz, wohin die Eltern übersiedelt waren, wurde er von dem gleichen Dr. Wilhelm Mayer unterrichtet, der auch Wilhelm Kienzl, Heuberger und Weingartner ausgebildet hatte. In späteren Jahren lebte er konzertierend und lehrend in den USA, in Helsinki, in Moskau, die meiste Zeit in Berlin, während des ersten Weltkrieges ging er nach Zürich und kehrte erst 1920 wieder nach Berlin zurück, wo ihn Kurt Weill kennenlernte.
Busoni war seinen Schülern ein idealer Lehrer und Berater, weil er sie nicht zu einem bestimmten Stil erziehen wollte und mit traditionellen Tabus schreckte, sondern das Individuelle, ihre persönliche Eigenart und Begabung zu entwickeln trachtete. Statt starrer Lehren gab er ihnen etwas mit, was man im Französischen mit „formation d’esprit“ bezeichnet und wofür es im Deutschen keinen genau entsprechenden Ausdruck gibt — wahrscheinlich, weil es mit der Sache, die er bezeichnet, nicht gerade zum Besten bestellt ist. Busonis Schüler zeigen keinerlei gemeinsame Züge. Die talentiertesten waren der gegenwärtig in der Schweiz lebende Deutschrusse Wladimir Vogel, der Katalane Philipp darnach, der, wie Busoni, an der Preußischen Akademie der Künste in Berlin lehrte, Dimitri Mitropoulos, dem Busoni riet, das Komponieren zu lassen und Dirigent zu werden, und schließlich Kurt Weill, der Busoni fast alles verdankt — außer seinem angeborenen Talent.
Dieses manifestierte sich sehr früh, wie wir das bei Musikern häufig beobachten. Kurt Weill wurde am 2. März 1900 in Dessau als Sohn eines Kantors geboren, komponierte am Klavier, bevor er noch den ersten Unterricht empfing, trat mit 15 Jahren als Liedbegleiter auf und war mit 18 Jahren Theaterkapellmeister in Lüdersdorf, das auf der Landkarte nicht ganz leicht zu finden ist und in Odernähe auf halbem Weg zwischen Berlin und Stettin liegt. Gleichzeitig studierte ?r Theorie und Komposition an der Hochschule für Musik in Berlin, pikanterweise bei Engelbert Humperdinck, wo er es aber nur zwei Jahre aushielt. Dann traf er Busoni, mit dem er bis zu dessen frühen Tod im Jahr 1924 eng befreundet war. Kurt Weill selbst wurde ebenfalls nur 50 Jahre alt und ist 1950 in New York gestorben. Im vergangenen Jahr gedachte man seines 70. Geburts- und 20. Todestages …
Die Entfaltung des eigenartigen Talentes seines Schülers hat Busoni nicht mehr erlebt, ja man sagt, er habe dessen spezielle musikdramatische Begabung noch nicht erkannt, beziehungsweise erkennen können. Denn zu Busonis Lebzeiten schrieb Weill nur ein Streichquartett und ein Divertimento für Kammerorchester sowie, 1923, eine BaHettpantomime mit dem Titel „Die Zaubernacht“. Die Fachwelt wurde auf Weill erst durch ein Kammermusikwerk aufmerksam, das im Sommer 1924 in Salzburg uraufgeführt wurde: „Frauentanz“ für Sopran und fünf Bläser auf Gedichte des Mittelalters. Mit den Einaktern „Der Zar läßt sich photographieren“ und „Der Protagonist“ nach Georg Kaiser sowie „Royal Palace“, nach Iwan Goll, durchlief Weill alle Phasen des musikalischen und literarischen Modernismus der zwanziger Jahre. Aber erst in dem 1927 beim Musikfest in Baden-Baden uraufgeführten Songspiel „Mahagonny“, nach einem Gedichtzyklus von Bert Brecht, fand Weill zu seinem eigentlichen Stil. An jenem denkwürdigen Abend standen noch folgende Werke auf dem Programm: Hindemiths Sketch „Hin und zurück“, Tochs „Prinzessin auf der Erbse“ und zwei „opéra minutes“ von Darius Milhaud, und man kann sich vorstellen, wie schockierend neben diesen avancierten und artistischen Werken die melodiösen und volkstümlichen Songs von Kurt
Weill wirkten. Schockwirkung ging auch von der zweiten Fassung der Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ aus, die am 9. März 1930 unter starkem Polizeiaufgebot in Leipzig uraufgeführt wurde. Nach jener turbulenten Premiere wurde ein Mann beobachtet, der gleichzeitig applaudierte und „Pfui“ rief. Dieser Zeitgenosse drückte genau jene ambivalente Wirkung aus, die das Werk auf das Publikum übte.
Zwischen diesen beiden Fassungen lag dle „Dreigroschenoper“ von 1928, deren Entstehungsgeschichte sehr unterhaltsam von Heinrich Fischer erzählt wurde. Zu Beginn des Jahres 1928 nämlich hatte ein junger Schauspieler, Emst Josef Aufricht, ganze 27 Jahre alt, das Theater am Schiffbauerdamm übernommen und dem damaligen Münchner Chefdramaturgen Heinrich Fischer angeboten, sein Mitdirektor zu werden. Aber womit sollte man beginnen? Zwar wollte man mit einem neuen, womöglich revolutionären Werk starten, aber man wollte auch kein politisches Tendenztheater ä la Piscator machen. Da traf Fischer im Theaterrestaurant Schlichter in Berlin Bert Brecht, der von einem neuen Stück erzählte, das er in Arbeit habe: ein Sprech stück mit Musik nach John Gays und Pepuschs 200 Jahre alter „Beggar’s Opera“. Hiefür entschied man sich, und nachdem die Besetzung fixiert war, begann man mit den Proben. Die Partitur entstand so nach und nach, es gab „Krache“ am laufenden Band, aber dann war es soweit: Am 28. August 1928 fand die Premiere statt, und. das stuck- und plüschgeschmückte alte Theater am Schiffbauerdamm hat wohl noch nie einen so eindeutigen Novitätenerfolg erlebt. 250 Aufführungen in Berlin und über 2000 in der Provinz folgten. Die „Dreigroschenoper“ wurde ein richtiger Weltschlager, an dem der Premierenregisseur Erich Engel, der Bühnenbildner Caspar Neher, Bert Brecht und die Hauptrollenträger ihren wohlgemessenen Anteil hatten, allen voran Lotte Lenya, die im Jahr vorher Kurt Weills Frau geworden war.
Sie alle wirkten zusammen bei der Realisierung eines absolut neuartigen Kunstwerks, eines neuen „epischen Stils“ des Musiktheaters, dessen Mittel für den Komponisten Kurt Weill Song, Moritat, Ballade und einfach-lapidare Chorsätze waren. Ebenso originell wie Weills melodische Erfindung war auch seine Rhythmik, die vorwiegend auf den Formen der Tanzmusik der zwanziger Jahre basierte: Tango, Foxtrott, Shimmy, Slowfox und English- Waltz. Originell war auch der Klang des Weill-Orchesters, in dem es keine Streichinstrumente gibt und der auf der Verwendung von Blasinstrumenten und einer Rhythmusgruppe beruht, die aus Klavier, Banjo und Schlagwerk besteht. Auch das sentimentale Harmonium, Lieblingsinstrument des damaligen Stummfilms, fehlte nicht Diese ganz spezifische Mischung von sozialer Aggression und Sentimentalität hat sehr wesentlich zum Erfolg von Weills erstem Meisterwerk beigetragen. Doch hat er sich damit nicht zufrieden gegeben. Uber seine späteren Werke wird in einer zweiten Folge zu berichten sein.
• Am 24. Jänner findet in Hamburg die Uraufführung eines Auftragswerkes statt, das Marcel Marceau und der vor kurzem verstorbene Kritiker Claude Rostand nach der philosophischen Erzählung „C a n- di d e“ von Voltaire geschrieben haben. Die Musik stammt von Marius Constant.
• Wolfgang Fortner schreibt in Zusammenarbeit mit Wilfried Steinbrenner ein „Carmen“-Ballett für John Cranko mit collageartiger Verwendung von Musik aus Bizets Oper. Die Uraufführung an der Württem- bergischen Staatsoper ist für den 27. Februar 1971 vorgesehen.