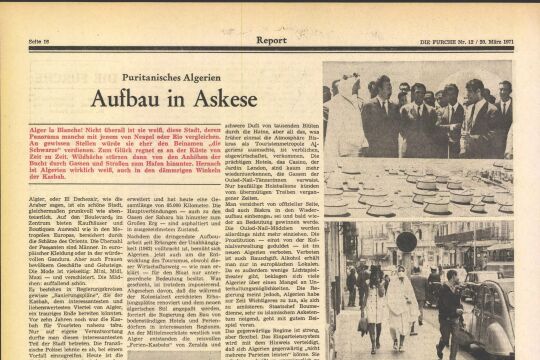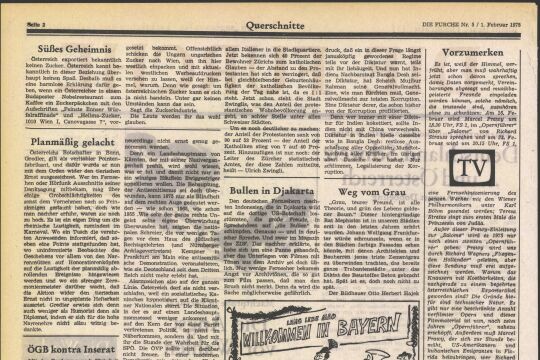Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Auf verlorenem Posten
In der Kathedrale von Tunis heißen Faltblätter in Französisch, Englisch und Deutsch den Besucher herzlich willkommen. Der neo-romanische Kirchbau, so liest man, steht an der Stelle eines alten Christenfriedhofs, auf einem Grundstück, das der Bey von Tunis im 18. Jahrhundert der christlichen Gemeinde schenkte.
Die Kathedrale steht am „Platz der Unabhängigkeit“. Zu den Samstagabend- und Sonntagmessen finden sich in der Regel vierzig, fünfzig Gottesdienstbesucher ein, darunter Vinzentine- rinnen in ihrer schlichten Ordenskleidung, aber nur ganz wenige Tunesier. Die Faltblätter weisen auch auf katholische Gottesdienste in Bizerta, Hammamet, Sous- se, Monastir, Sfax, Gafsa, Gabės und auf Djerba hin: „Gläubige und Klerus stehen bereit, Ihnen in all Ihren geistigen Bedürfnissen zu Hilfe zu kommen“.
Angėsprochen sind alle, die sich nicht zum Islam bekennen. In Tunesien, wie auch in Algerien und Marokko, ist der Islam Staatsreligion. 96 Prozent der sieben Millionen Tunesier sind Muslime. Die Vorbeter und Gebetsrufer in den Moscheen sind Staatsbeamte.
Aber nicht der Freitag, sondern der Sonntag ist Feiertag. Unter Habib Bourguiba, dem Unabhängigkeitsführer, Erneuerer der De- stour-Partei und Präsident auf Lebenszeit, wurde die mohammedanische Vielehe abgeschafft und für die Eheschließung ein Mindestalter festgesetzt. Von vielen seiner westlich orientierten Landes kinder werden die Gebote des Ramadan, der islamischen Fastenzeit, weniger streng befolgt als in orthodoxen arabischen Bruderländern.
Es herrscht Religionsfreiheit. In Tunis halten nicht nur Katholiken, Protestanten, Anglikaner, Griechisch-Orthodoxe, Russisch- Orthodoxe und Armenisch-Orthodoxe, sondern auch Juden ihre Gottesdienste ab. Rund 30.000 Christen und etwa 10.000 Juden leben in Tunesien.
In diesem relativ liberal-toleranten Land ist es Nicht-Muslimen allerdings untersagt, unter Muslimen für eine nicht-islamische Religion zu werben. Es dürfen keine Kirchenglocken geläutet werden, Kirchenprozessionen müssen unterbleiben, christliche Kulthandlungen dürfen nur in geschlossenen Räumen stattfinden.
Tunesien freilich macht Christen das Leben weit weniger schwer als der religiöse Eiferer Oberst Ghaddafi im Nachbarland Libyen. Dort ist das christliche Kreuz aus der Öffentlichkeit verbannt, die Kathedrale von Tripolis heißt heute Nasser-Mosdiee, und geradeso wie in Saudi-Arabien, dem Stammland des Propheten Mohammed, können christliche Geistliche, die unter den ausländischen Facharbeitern seelsorgerisch wirken wollen, bestenfalls als „Lehrer“ eine Aufenthaltserlaubnis erhalten.
Die doppelte Moral, die islamischer Puritanismus erzeugt, wird den Tunesiern von zechfreudigen, vergnügungssüchtigen Besuchern aus den ebenso reichen wie sittenstrengen Ölländern vor Augen geführt. In der tunesischen Atmosphäre von Fremdenfreund- lichkeit und Laisser-faire sonnen sich alljährlich mehrere hunderttausend Touristen. Das Kirchenblatt bedenkt sie mit dem frommen Wunsch: „Möge Ihre Fühlungnahme mit dem Volk stets von Hochachtung und christlicher Liebe geprägt sein.“
Leider werden solche Worte wenig beherzigt. Tunesien, das den Zustrom ausländischer Touristen nach besten Kräften fördert, um die defizitäre Handelsbilanz auszugleichen, bekommt nicht nur den Devisensegen, sondern auch den korrumpierenden Einfluß des Tourismus zu spüren.
Allerdings melden sich zunehmend Stimmen, die Tunesiens starke Verwestlichung kritisieren und für eine Rückbesinnung auf arabisch-islamische Werte ein- treten. Seit einjger Zeit rühren sich auch in Tunesien fundamentalistische Gruppen; sie sehen das Heil in den Lehren des Koran und wenden sich gegen Bourguibas säkularistische Reformen.
Es kam zu Übergriffen radikaler Muslime gegen Ferieneinrichtungen und gegen Landsleute, die nicht die strengen islamischen
Fastenregeln einhielten.
Oftmals ist es das schlechte Beispiel westlicher Besucher, das in Nordafrika einerseits Nachahmung findet, andererseits Verachtung und Ausländerfeindlichkeit auslöst. „Tourismus“, heißt es in einer Unesco-Studie über Tunesien, „kann eine Pilgerfahrt sein, aber auch ein Hunnensturm“.
98,5 Prozent der 20 Millionen Algerier sind Muselmanen. Nach dem blutigen Unabhängigkeitskampf verschrieb sich Algerien einem vom Osten inspirierten, islamisch verbrämten Sozialismus. Die Führer der Nationalen Befreiungsfront (FLN) machten den Koran zur Richtschnur ihrer Ideologie; den atheistischen Kommunismus lehnen sie ab.
Nicht „Klassenkampf“ und „Diktatur des Proletariats“ wird den Algeriern gepredigt, vielmehr behält der Prophet Mohammed das letzte Wort. Der christliche Sonntag wurde abgeschafft und der Freitag zum Feiertag bestimmt. Im Jahre 1983 nach Christus schreibt man in der Volksrepublik Algerien das Jahr 1403/04 nach der Hajira, der Flucht Mohammeds aus Mekka.
Aus religiösen Gründen ist das Thema Familienplanung, Geburtenkontrolle in dem von Massenarbeitslosigkeit und rapidem Bevölkerungszuwachs geplagten Land tabu. Überall wurden neue Moscheen und Koranschulen ge baut, immer mehr wird das Französische als Schul- und Umgangssprache zurückgedrängt.
Auch in Algerien können die imposanten Kirchbauten nicht darüber hinwegtäuschen, daß das Christentum hier auf verlorenem Posten steht. Die’ Cathėdrale Sa- cre Coeur in Algier, die futuristisch anmutende Kirche Notre Dame d’ Af rique, der Temple Protestant und die Eglise Anglicaine - sie sind Kulturorte der Ausländerkolonie; ihre Glocken läuten nicht mehr.
Noch gibt es in Algerien fünf katholische Bischöfe und einen päpstlichen Nuntius. Kardinal Duval, gebürtiger Franzose und nationalisierter Algerier, ist Vorsitzender der Nordafrikanischen Bischofskonferenz.
Noch wirken, vor allem auf Krankenstationen, katholische Ordensschwestern in Algerien. Die Ordensschulen der Weißen Väter und der Weißen Schwestern wurden geschlossen. Dorfkirchen, Friedhofskapellen wurden mit Brettern vernagelt oder in Lageräume umgewandelt. Der Niedergang des christlichen Lebens wird dem Besucher nicht zuletzt in den zellenartigen Räumen der bundesdeutschen Botschaft bewußt; sie befindet sich einem ehemaligen Dominikanerkloster.
In der Millionenstadt Casablanca, wo immer noch der größte Teil der rund 60.000 Europäer in Marokko lebt, steht die im Jahre 1930 erbaute Kathedrale Sacre Couer heute leer. Eine Zeitlang hat sie als Hörsaal der Universität gedient. In Marokkos Handels- und Industriemetropole werden nur noch einige kleinere Kirchen für christliche Gottesdienste benutzt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!