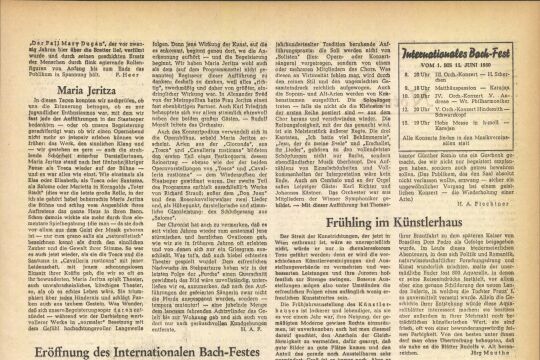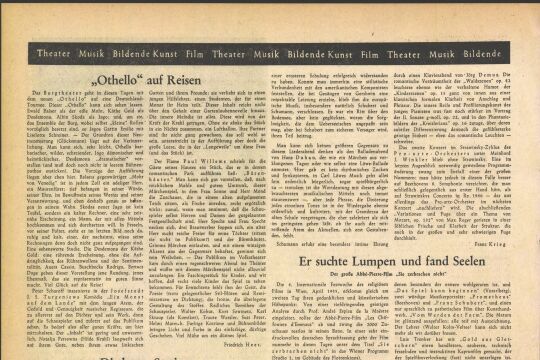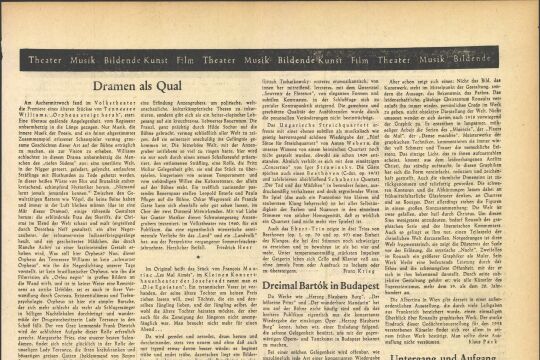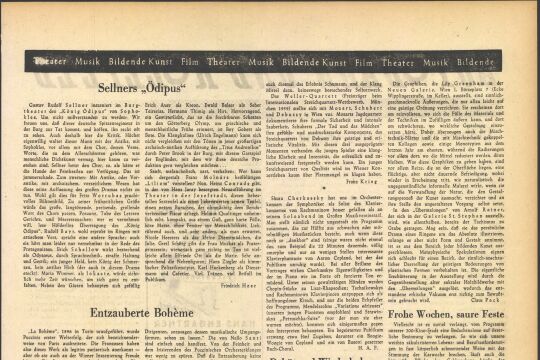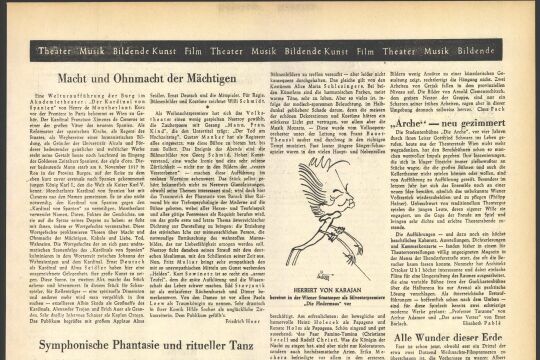Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Aus dem Konzertsaal
„Nicht Bach sollte er heißen, sondern Strom!“ Dieses Wort geht einem besonders beim Anhören der Hohen Messe h-Moll durch den Kopf. 1733 begonnen und bis 1738 durch weitere Teile ergänzt, wurde das Werk zu Bachs Lebzeiten nie vollständig aufgeführt, obwohl es zu den größten Schöpfungen der deutschen Musik gehört. Zu der h-Moll-Messe hat Karl Richter, der sie am vergangenen Samstag und Sonntag im Großen Musikvereinssaal dirigierte, ein ganz unmittelbares Verhältnis, das ihn vor jeder Gewalttätigkeit oder Manier bewahrt. Als ehemaliger Angehöriger des Dresdener Kreuzchores, später als Ramin-und Straube-Schüler mag er unzählige Male an ihrer Aufführung mitgewirkt haben. Obwohl er den von Hellmuth Froschauer wohleinstu-dierten Singverein mit etwa 180 Mann aufmarschieren und die Philharmoniker sotto voce spielen läßt, findet keine romantische Übersteigerung des Klanges oder des Ausdrucks statt. Alles ist richtig, die Tempi sind angemessen, alles fließt und rundet sich, im einzelnen wie im ganzen. Bessere Vokalsolisten waren wohl kaum aufzutreiben: Ileane Co-trubas und Marga Schiml, Peter Schreier, Ernst G. Schramm und Theo Adam. Mit Ausnahme des Baritons kommen sie alle von der Oper her, aber man merkte es nicht, es gab nirgends einen Stilbruch. — Marga Schimls schönen Mezzo hoffen wir bald wiederzuhören. Neben den Solisten sind besonders die drei Trompeter und der Soloflötist hervorzuheben. Ein Detail der Aufführung: das Miserere läßt Richter vom sitzenden Chor singen, was sehr gut wirkt. H. A. F.
Daß das Spiel Karl Richters von persönlicher Aussage stark beeinflußt ist und romantische Züge aufweist, ist insofern nicht verwunderlich, als der Künstler einen seelisch bewegten Vortrag anstrebt. — Liszts „Präludium und Fuge über den Namen Bach“, mit virtuoser Lauftechnik im Pedal und in den Manualen ausgestattet, kam dieser romantischen Einstellung Richters sehr entgegen, Messiaens „Nativite du seigneur“ verwandelte sich unter den Händen Richters im Abschnitt „Dieu parmi nous“ zu einem Konzertstück, das von einem leutseligen Verweilen des Herrn unter den Menschen zu künden scheint. In Regers „Fantasie und Fuge d-Moll“ waren Anschlag, Artikulation und Agogik auf deutliche Herausarbeitung der Architektur ausgerichtet, Vorzüge, denen zu abrupte dynamische Gegensätze in der Fuge wertmindernd gegenüberstanden. Am schönsten offenbarte sich der Vortrag des Künstlers bei Bachs „Pas-sacaglia c-Moll“, die, in majestätischer Ruhe ausgebreitet, zu einem Glanzstück des Konzertes mit voli-strömendem Plenum ausreifte. In gelöst reizvollem Musizieren und durchsichtiger Klarheit des Stimmgewebes wurde Bachs „Triosonate G-Dur“ dargeboten. Daß Richters Manual- und Pedaltechnik klaglos wie immer funktionierte, bedarf keiner besonderen Erwähnung. Zahlreiche Zugaben waren selbstverständlich. — Wiewohl vergleichsweise bei Anton Heillers geistig verhaltener, objektivierender und werkgetreuer Bach-Ausdeutung und bei Richters freier, oft allzu freier Gestaltung sich die Geister scheiden und die Anhängerschaft der beiden Künstler sich teilt, so ist jedem der beiden doch ein hohes Wertungsmaß ihrer Leistungen zuzuerkennen, das bei einer Verschmelzung der Vorzüge der beiden Orgelmeister noch gewinnen könnte.
In einem von der Hochschule für Musik in Wien und der österrei-chisch-Bulgarischen Gesellschaft arrangierten Konzert unter dem Titel „Slawische Musik“ kamen hauptsächlich Kompositionen bulgarischer Tonsetzer neben einigen Liedern und Klavierstücken Tschaikowskys und
Chopins zur Aufführung. Die in Sofia und Varna engagierten Sopranistinnen Popangelowa und Dimi-trowa zeigten schönes, in guter Technik gebildetes Material in Gesängen von Goleminov, Slatev-Tscherkin und Tschaikowsky sowie in zwed Opernarien. Der Geiger Nikolay Tur-tow spielte mit dem auch die Sängerinnen begleitenden Pianisten Asmanov als Klavierpartner eine Sonate von Raitschev, der unter den anderen im Programm vertretenen bulgarischen Komponisten am stärksten zur Modernität gravitiert und sich stellenweise einer verschämten Bitonalität verschreibt. Mtmi Di-tschewa präsentierte sich als gute Tschaikowsky- und Chopin-Interpretin.
*
Für sein Wiener Debüt hatte der junge Budapester Pianist Deszö Ranki Werke von Mozart, Schumann und Chopin gewählt. Mozarts B-Dur-Sonate, KV 333, enttäuschte in seiner Interpretation der Ecksätze durch die Sachlichkeit, mit der er dieses von Einstein als eines der „seligsten Mozart-Werke“ bezeichnete Opus abfertigte. Um so erstaunlicher gelang Rankt dann die Umwandlung zum guten Musikalischen hin in Schumanns „Carnaval“, in welchem die technische Leistung mit ihrer hervorragend funktionierenden Mechanik der Finger seiner Auffassung dieser lyrischen und dramatischen „großen Kleinigkeiten“ gleichkam. Einzig die zeitweilige Überfütterung mit Pedal wäre zu unterlassen.
Ganz in seinem Element befand sich der Pianist bei Chopins g-Moll-und E-Dur-Ballade, die er mit manchmal wie neu wirkenden Akzenten versah, desgleichen bei sechs Etüden aus Opus 10, wo ihm die gerechte Verbindung musikalischer Werte mit gemeisterten technischen Schwierigkeiten tadellos glückte.
Paul Lorenz
Margaret Price, ab Oktober Pamina und Constanze der Wiener Staatsoper, sang im Mozartsaal ausgewählte Lieder von Schubert. Ein schöner, rund klingender, weich timbrierter Sopran ist ihre Stärke. Ihre Schwäche: Schuberts deklamatorischer Linienfluß, wie er in den späten Liedern auftritt, liegt ihrer Stimme wenig. Was um so mehr auffällt, als sie obendrein offenbar kaum einen Satz der Liedtexte versteht und im Ausdruck alles über einen Leisten schlägt. Sprachliche Differenzierung, ein wesentliches Merkmal für die Gestaltung von Schuberts Liedern, bleibt ihr fremd. Überdies garniert sie ihre Wiedergaben mit neckisch-naiver Verniedlichung; peinlich, wenn die Stimmung eines Lieds dem entgegensteht. James Lockhart begleitete trostlos grau, fand oft nicht einmal die richtigen Tempi.
*
Der Abend des La-Salle-Quartetts bestätigte erneut den hervorragenden Ruf dieses Streicherteams. Wie sie Hans Erich Apostels 1935 komponiertes 1. Streichquartett (op. 7) aufführen, zeigt die virtuosen Kenner dieser Musik. Von Anfang an atmet ihre Wiedergabe etwas vom Spezialistentum in Sachen Moderne: Man staunt, wie sie dem Hörer musizierend klarmachen, was theoretisch eher kompliziert ist, nämlich die Verbindung von Zwölftontechnik, im Ausdruck streng kalkulierten Formen und strengen Symmetrien mit einer lebendigen thematischen Arbeit als Ausdruck einer kunstvollen Kontrapunktik. Apostels Opus 7 ist im Grunde ein Werk des Besinnens, Resümierens, kritischen Nachdenkens des Schülers. Dem Lehrer Alban Berg zum „Fünfziger“ gewidmet, ist es vor allem im zweiten Satz ein verklausuliertes Variationenwerk über das Thema der Kammermusik aus dem 2. Akt des „Wozzeck“. Wie Berg musikalische Scharaden liebte, zitiert auch Apostel im Scherzo, und zwar die Initialen AB und HEA. Der ursprünglich geplante fünfte Satz ist nach Bergs Tod nicht komponiert worden. — Außerdem hörte man Debussys g-Moll-Quartett und Beethovens Opus 95 (f-Moll): das erste elysisch leicht und klanglich ungemein locker, das zweite eher zu forciert und intellektuell unterkühlt. Es war einer der eindrucksvollsten Abende des Zyklus „Internationale Quartette“.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!