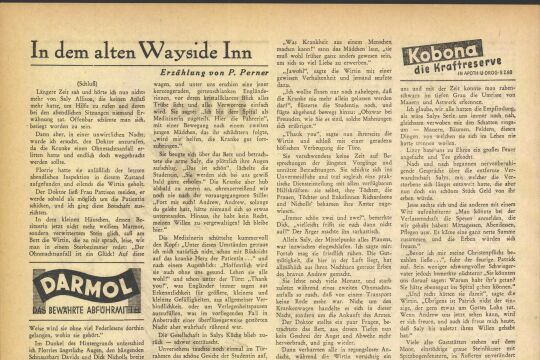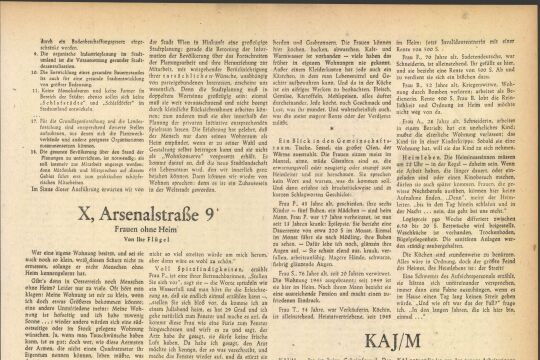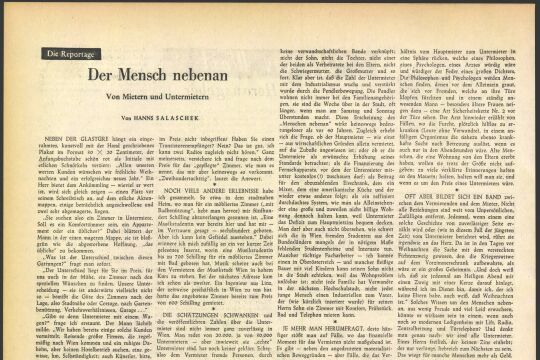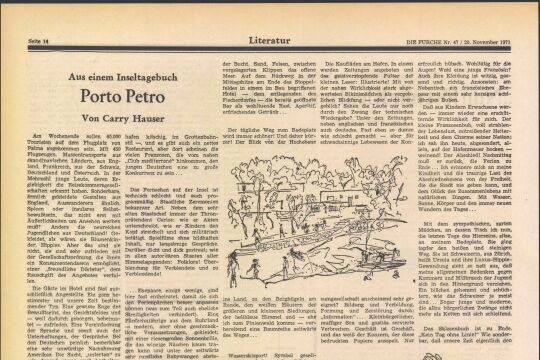Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Bei den „Homeless“ in New York
Wer von uns kennt schon das Gefühl, kein Zuhause zu haben: kein Bett zu haben, kein Bad, keine Toilette, keine Küche zu haben und kein Essen kochen zu können, durch irgendwelche Umstände gezwungen zu sein, nicht mehr zu besitzen, als das, was man mit sich tragen kann?
In New York City gibt es erschreckend viele Menschen, die ganz genau wissen, was das bedeutet, was es heißt, keine Tür zu haben, die man hinter sich zumachen und damit die Welt ausschließen kann.
Es ist die Welt der „streetpeo-ple“, der „shoppingbag-ladies“, die all ihr Hab und Gut mit sich tragen und schon so unweigerlich zum Stadtbild gehören, wie das Empire State Building, die Freiheitsstatue und Tiffanies.
Ein paar nüchterne Fakten: unter den rund 7,5 Millionen Einwohnern von New York gibt es 40.000-60.000 homeless, davon sind etwa 20.000 Jugendliche unter 21 Jahren, sogenannte „streetkids“. Die Ursachen sind vielfältig, es läßt sich auch kein Prototyp eines homeless konstruieren, die graue Masse der streetpeople besteht aus einer Unmenge von Einzelschicksalen.
Eines ist ihnen jedoch allen gemeinsam—fast durchwegs sind es erschütternde Geschichten von Menschen, die aus verschiedensten Gründen durch die Maschen des amerikanischen Sozialnetzes gefallen sind. Es ist ein sehr grobmaschiges Netz, lose geknüpft und oft weniger als wirkungslos, wenn es gut, auf- oder abzufangen, zu schützen und vor dem Absturz zu bewahren.
Arbeitslosigkeit, unverhältnismäßig hohe Wohnungsmieten und ständiges Kürzen der Sozialleistungen (so im Zuge der Reago-nomics, um zum Beispiel SDI-Projekte zu finanzieren!) sind die Hauptursachen für die ständig wachsende Zahl von Obdachlosen in den USA. Daß dies nicht durchwegs „Sandler“ „Tippelbrüder“, „arbeitsscheues Gesindel“ sind, können vielleicht folgende, selbsterlebte Eindrücke veranschaulichen:
Der Keller einer Kirche in „Fort Washington Heights“, in einem der verrufensten Viertel Manhattans; es ist Abend, die Lichter der Stadt spiegeln sich schon im Hudson — und hier beginnt lebhafte Geschäftigkeit: eine der unzähligen privaten Hilfsorganisationen ist diese Gruppe von Frauen, die
abwechselnd Abend für Abend für 10-12 homeless kocht.
Ein Bus fährt dazu jeden Tag nach Midtown-Manhattan, sammelt dort eine Handvoll Männer ein, die sonst die Nacht in einem Hauseingang oder ähnliches verbracht hätten, und bringt sie in die Kirche, wo sie verköstigt werden und auch übernachten können.
Meine Nervosität und Beklommenheit war sehr groß, zugegeben, ein bißchen Angst vor der Konfrontation war auch dabei, aber es war dann alles ganz anders ... alles hätte ich nämlich erwartet, nur nicht diese Gruppe von dankbaren, herzlichen, teilweise korrekt mit Anzug und Krawatte gekleideten Menschen,
die sich da müde, aber größtenteils freundlich und mit einem Lächeln an die Klapptische zu einer Portion Eintopf auf Papptellern setzt.
In unkomplizierten und herzlichen Gesprächen stellt sich dann heraus, daß viele dieser Männer (hier durchwegs Schwarze und Hispanics) teilweise sogar Jobs haben, Geld verdienen, aber sich keine fixe Unterkunft in der Stadt leisten können.
Einige der Männer sind geschieden, ein Spieler mit treuherzigem Blick ist darunter, Menschen, die durch Krankheit Job und Wohnung verloren haben,...
Szenenwechsel. Zwei alte Chinesinnen sitzen, einige Meter voneinander entfernt, auf den Stufen zu einem der wolkenkratzenden Geschäftsgebäuden; beide haben einen großen Plastiksack über die Schulter geworfen, beinahe voll mit leeren Alu-Getränkedosen.
Eine typische business-woman (uniformiert in Kostüm, Turnschuhen, weißen Socken und Aktenkoffer) beendet im Vorübergehen ihren „lunch“ und wirft ihre leere Dose in einen Abfallkübel.
Darauf haben die beiden Dosensammlerinnen nur gewartet; blitzschnell stürzen beide zum Mistkübel, und ein erbitterter, lautstark in Chinesisch geführter Streit entbrennt. Fünf Cent Einsatz gibt es für jede Dose — als Umweltschutzmaßnahme.
Dagegen ist nichts einzuwenden. Wie absurd und grotesk nimmt sich aber die Tatsache aus, daß sich Menschen darum strei-
ten müssen — weil von staatlicher Seite zu wenig getan wird, Um ihr Elend zu lindern. Ein weiterer „Fall“ (eher im Sinne von „Absturz“) ist der des Indianers Monroe Pohocsucut, eines Komanchen.
Ständig bemüht, etwas Konkretes für sein untergehendes Volk zu tun, schaffte er es, im „Secretary for Indian Affairs“, einer Art Indianerministerium, angestellt zu werden — als einziger Indianer! Was er dort an Frustration, Ignoranz, Gehässigkeit und Desinteresse erlebte, konnte ihn wahrscheinlich gar nicht ruhig seinen Dienst verrichten lassen.
Jedenfalls wurde er bei der erstbesten Gelegenheit, das heißt im Zuge der nächsten Arbeitsplatzkürzung, entlassen. So landete er auf der Straße, Job weg, Wohnung weg, Erspartes aufgebraucht, ... in die Reservation zurück kam nicht in Frage, das hätte resignieren, verbittern, aufgeben geheißen.
Ironie des Schicksals: der Indianer Monroe engagiert sich heute für sein Volk, indem er in der noblen 5th Avenue traditionelle Tänze in der Tracht seines Stammes vorführt — zum Gaudium von Touristen und Kindern.
Doch es gibt auch Initiativen, private Hilfsorganisationen, Ansätze, ... So bringt zum Beispiel ein Bus jede Nacht Essen, Decken, simple Gegenstände des täglichen Gebrauches wie Zahnbürsten und ähnliches an bestimmte Verteilungspunkte in den nächtlichen Hexenkessel Manhattan; Kirchengemeinden veranstalten Flohmärkte und Picknicks, die „homeless“ organisieren sich selbst, geben eine Zeitschrift heraus, in der auf Hilfsaktionen aufmerksam gemacht wird.
Hier im Land der krassesten Gegensätze und Extreme ist es ohne fremde Hilfe fast unmöglich, aus dem Teufelskreis: ohne Wohnung und Auto keine Arbeit/ ohne Arbeit keine Wohnung, auszubrechen. Wer bereits „nach Armut stinkt“, wem man erst einmal seine elende Situation ansieht, hat sich bereits selbst aufgegeben. So sind auch die eingangs erwähnten homeless und ihre verzweifelten Bemühungen, korrekt gekleidet zu sein, zu verstehen, einer von ihnen faßte es in folgende Worte: „Look at us, we do want to change our Situation! Thank you so much for helping!“
Die Autorin studiert Germanistik an der Universität in Klagenfurt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!