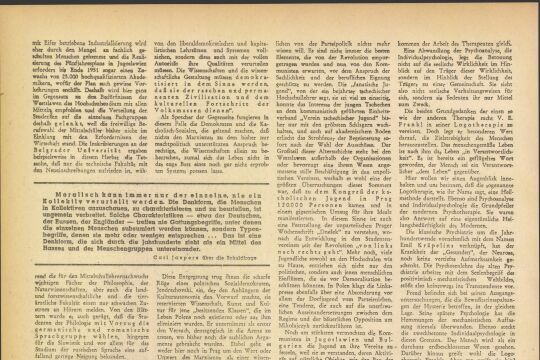Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Beim, aber nicht zum Sterben helfen
Vor etlichen Jahren wurde ich von einer Verwandten gefragt, was sie mit ihrem Mann tun solle, der an Krebs litt. Die Krankheit war weit fortgeschritten, das Ende war abzusehen.Selbstverständlich kam ihr jene Lösung nicht in den Sinn, die für manche Ärzte und manche Pfleger eine Versuchung ist, die „Endlösung“, über die uns der Fall Lainz und ähnliche Nachrichten aus dem Ausland erschrecken lassen, die sogenannte aktive Euthanasie: Man verhilft dem Kranken zum Sterben, man tötet ihn. Gegen diese angebliche Lösung spricht ja das
Recht eines jeden Menschen auf sein Leben und seine Pflicht, im Leben auszuharren, solange es ihm gegeben ist.
Dieses Recht und diese Pflicht zählen zur Würde des Menschen, die unbedingt zu achten ist. In einer Schrift, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erschienen ist, weist Romano Guardini darauf hin, daß das Personsein des Menschen verschiedene Verwirklichungsformen haben und in vielen Fällen verhüllt sein kann; dennoch: „Das Leben des Menschen darf nicht angetastet werden, weil er Person ist“ („Das Recht des werdenden menschlichen Lebens“).
Wenn wir anfingen, zwischen zu achtendem und nicht zu achtendem menschlichen Leben zu unterscheiden, kämen wir ja auch auf die schiefe Ebene. Wer kann die Grenze ziehen, wo ist sie zu ziehen? Wie die Erfahrung zeigt, wurde mit Recht befürchtet, daß die zugelassene Tötung ungeborenen menschlichen Lebens eine Signalwirkung in Richtung auf dieTötung des mehr und mehr sich reduzierenden Lebens alter Menschen ausübt: Wenn das eine nicht zu achten ist, warum soll dann das andere zu achten sein?
Bei dem zu Ende gehenden menschlichen Leben kann man allerdings vor die Frage gestellt sein, welche Behandlung man ihm weiter angedeihen lassen soll. Ich wurde einmal eingeladen, in eine Klinik zu kommen, um bei einer Beratung mitzuhelfen. Man zeigte mir einen Patienten, der nach einem Unfall
schon mehrere Monate bewußtlos lag; man hatte alles Menschenmögliche getan, um seinen Zustand zu bessern, aber ohne Erfolg. Man stand nun vor der Frage, ob man die aufwendige Behandlung des Patienten, den man zwar im notwendigen Ausmaß weiter ernähren wollte, ohne Erfolgsaussicht fortsetzen solle.
Bei der nachfolgenden Besprechung mit dem Klinikvorstand, den Ärzten und den Pflegern sagte ich ihnen, daß ich ihnen die Entscheidung nicht abnehmen könne, daß man ihnen aber keinen vernünftigen Vorwurf machen könne, wenn sie unter diesen Umständen die mühsame Behandlung, die ja nur der Verlängerung des Sterbezustandes diene, nicht fortsetzen wollten, sondern der natürlichen Entwicklung ihren Lauf ließen. Interessanterweise tat es den Krankenschwestern leid, daß sie mit der intensiven Behandlung des Patienten aufhören sollten, auf den sie schon so viel Mühe aufgewandt hatten.
Schon Papst Pius XII. hat am 24. November 19 5 7 vor Ärzten über die sogenannte passive Euthanasie erklärt, die Angehörigen eines Kranken und der Arzt seien zur Anwendung der üblichen Mittel verpflichtet, dürften aber Versuche der Wiederbelebung abbrechen, wenn diese zu einer unzumutbaren Belastung würden. In einem bestimmten Sinn kann man von einem Recht des Menschen auf seinen natürlichen Tod sprechen. Weltbekannte warnende Beispiele sind Franco und Tito, die man monatelang am Sterben gehindert hat.
Aber kehren wir zur Frage meiner Verwandten zurück, was sie mit ihrem sterbenskranken Mann tun solle; im besonderen ging es darum, ob sie ihn zu Hause behalten oder in ein Krankenhaus geben solle. Ich sagte ihr, daß die Pflege zu Hause für sie sehr schwer sein würde; wenn sie aber dazu fähig sei, würde sie dem Sterbenden die größte Wohltat erweisen, wenn sie ihn zu Hause lasse. Sie hat ihn zu Hause behalten, natürlich unter Betreuung durch den Hausarzt. Sie war über diese Entscheidung sehr froh, und der Kranke war über diese letzten Tage in seiner gewohnten Umgebung froh.
Ich übersehe nicht, daß bei weitem nicht alle die Möglichkeit ha-
ben, in solcher Weise ihren Kranken und Sterbenden zu helfen. Es bleibt aber die Pflicht, den Sterbenden bis zur letzten Stunde in geeigneter Weise beizustehen (Sterbebeistand = Hilfe beim Sterben, nicht Hilfe zum Sterben = Tötung).
Die Aufgabe liegt auf Ärzten und Pflegern. Das Anliegen an sie geht dahin, daß sie den Sterbenden nicht bloß medizinisch-technisch versorgen, sondern ihm nach Möglichkeit auch menschlich nahe bleiben und ihn besonders in der letzten Stunde nicht in die Einsamkeit einer Sterbekammer abschieben.
Die Aufgabe liegt auf den Angehörigen. Sie dürfen den Kranken und Sterbenden nicht dem Gefühl aussetzen, daß sie ihn schon abgeschrieben haben. So müssen sie sich weiter für ihn Zeit nehmen, ihn besuchen, ihm kleine Dienste und Aufmerksamkeiten erweisen. Wenn sie ihm auch nicht mehr tun können, bedeutet doch schon ihre Anwesenheit einen Trost für ihn. Dem gläubigen Menschen sollen sie auch die Stärkung durch die Gnadenmittel, die die Kirche verwaltet, nicht vorenthalten.
Bei der Weihe des Öls für die Krankensalbung, die freilich nicht nur auf das Sterben, sondern auch auf die Genesung des Kranken ausgerichtet ist, bittet der Priester um Segen für den Kranken, „der durch diese heilige Salbung Stärkung und Linderung erfahren soll“. Bei der Salbung selbst spricht er: „Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen, er stehe dir bei mit der Kraft des heiligen Geistes“; und bei der Überreichung der Wegzehrung bittet er: „Christus bewahre dich und führe dich zum ewigen Leben“.
Die weltbekannte Mutter Teresa hat es nicht für verlorene Mühe gehalten, wenn sie verlassene Sterbende von der Straße aufgelesen und ihnen die Wohltat der Hilfe zu einem menschenwürdigen Sterben erwiesen hat. Ihr edles menschliches Tun hat im Nobelpreis hohe Anerkennung gefunden.
Der Autor war bis zu seiner Emeritierung Professor für Moraltheologie an der Universität Wien.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!