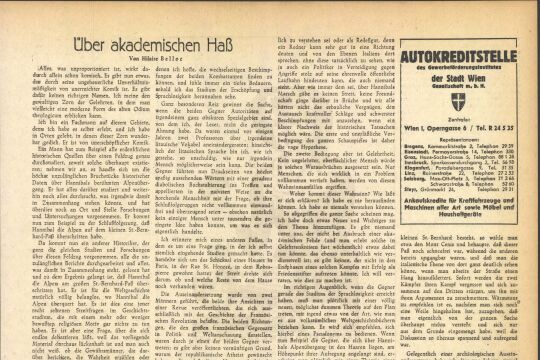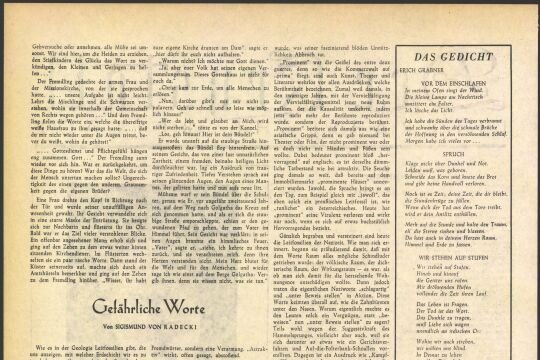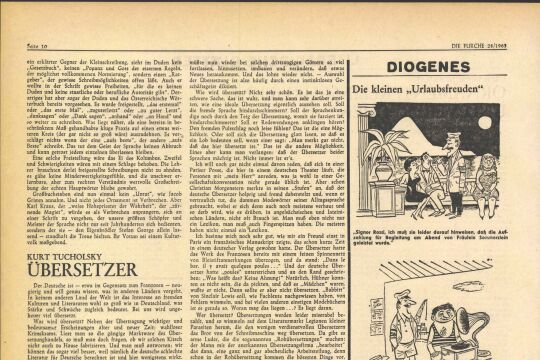Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Bekannte Namen
Vor einiger Zeit hielt ich an einer deutschen Universität einen Vortrag über österreichische Gegenwartsliteratur. Wieder daheim in Klagenfurt, bekam ich von jenem Veranstalter eine Besprechung meines Vortrages in einer der dortigen Zeitungen nachgeschickt. Der Rezensent fand an meinen Ausführungen nichts auszusetzen. Meine Freude wurde nur dadurch gemindert, daß die Namen der Kollegen, über die ich referiert hatte, falsch wiedergegeben, ja zum Teil bis zur Unkenntlichkeit entstellt waren. Das war schlecht an der „guten“ Besprechung ... Selbstverständlich war auch mein eigener Name ver-
schrieben. Nicht ich, Brandstet-ter, hatte über Innerhofer, nein, Brandstätter hatte über Immen-hofer gesprochen.
Nun enthält mein Name mit dem e statt des häufigen ä gewissermaßen eine Falle, und die boshafte Abweichung vom Normalen oder doch statistisch Vorwiegenden entschuldigt die Verschrei-ber. Ich weiß, wie ich dazukomme, wie aber kommt Innerhofer dazu.
Es gibt Namen, die sind so kompliziert, daß ihre Träger jeden Anspruch auf orthographische Wiedergabe verwirkt haben. In meinem Fall handelt es sich aber doch nur um eine Minimalabweichung und in der dreisilbigen oberösterreichischen Biederkeit liegt absolut nichts Besonderes. Doch macht es gerade der kleine Unterschied; ein solcher Name wird nie ganz falsch, aber auch selten ganz richtig geschrieben. Warum sollte es mir besser gehen als jenem österreichischen Autor, der in Seminararbeiten öfter Hoff-mannsthal als Hofmannsthal heißt? Ein Name wie meiner ist auch so geläufig, daß man ausgelacht wird, wenn man mit dem Telegrammalphabet zu buchstabieren beginnt, sagt man aber bloß „e statt ä“, so wundert man sich anschließend, wo und an welch falscher Stelle man das richtige e auch noch hinschreiben kann. Darauf wäre man nie gekommen.
Ein häufiger Name gehört einem eben nie allein. Der Name ist in jedem Fall bekannter als man selbst. Meyer ist der vielleicht verbreitetste Name. Er ist berühmter als Conrad Ferdinand.
Allmählich wird einem die richtige Schreibung des Namens zu einem Prüfstein, sozusagen zum Prüfbuchstaben, ob es jemand wirklich ernst mit einem meint, oder ob er sich mit einem nur approximativ und ungefähr und beiläufig beschäftigt. Lese ich etwa: „der bekannte österreichische Autor ä ...“, so hat in meinen Augen bereits die Schreibung den Satz als Phrase entlarvt. Der Satz läßt sich höchstens noch im Logikunterricht als ein Beispiel für eine „contradictio in adjecto“ verwenden.
Ich würde in meiner Pedanterie gern so weit gehen und sagen, daß jemand, der einen Eigennamen verschreibt, gegen das Menschenrecht der Integrität und Unverletzlichkeit der Person verstößt. Der Name bildet die Person ab. Man kann über mich sagen, was man will, aber das e muß man mir lassen, auch der. Neid der Kritiker, Mein lieber Progone und Landsmann Franz Stelzhamer hat einmal geschrieben, daß man ihm sein Lebtag lang vieles vorenthalten habe, nur, was seinen Namen betrifft, habe man ihm immer zuviel gegeben, nämlich die Geminata mm, er sei aber kein Hammer, sondern ein -hamer. Eine zweifelhafte Wiedergutmachung und Kompensation. Die Mühe, die sich ein Schreibender macht, hat also etwas mit einem Respekt zu tun. Darüber hat
schließlich bereits Goethe Herder belehrt, wie man in „Dichtung und Wahrheit“ nachlesen kann.
Wie muß ich es sehen und nehmen, wenn gerade einem philologischen Kollegen in einem Brief an mich nicht nur der eine verzeihliche, sondern noch zwei weitere unverzeihliche Fehler „unterlaufen“: Sehr verehrter Herr Prandtstätter? Das geht zu weit, Herr Kollege. Sie wollen wohl damit sagen und zum Ausdruck bringen, daß ein Vertreter meines Namens „hierorts“ in Ihrem, unserem, Fach nicht weiter bekannt sei, ich hätte mir also keinen Namen gemacht. Warum „verehren“ Sie mich dann? Doch warten Sie nur auf meine Antwort, auch Ihr Name bietet gewisse Möglichkeiten! Die Post wird Sie finden. Zu meiner Freude muß ich gestehen, daß ich es wirklich schon einmal einem heimgezahlt, habe, indem ich meinerseits den Namen des Ignoranten ignorierte.
Es gibt mildernde Umstände. Einer liegt darin, daß man sein eigenes Renommee gerne überschätzt und sich selbst zu wichtig nimmt. Es ist aber gar nicht leicht, über den Neumarkter Sattel, von der Rhein-Main-Linie ganz zu schweigen, hinauszuge-langen. Selbst die Römer hatten ihren Limes. Sogar ihre Berühmtheit war limitiert.
Schier unüberwindlich und un-durchdringbar sind natürlich die Sprachgrenzen. Einem Japaner würde ich zugestehen, daß er mich Brandenburg nennt, meinetwegen Brandstifter. Professor Albert Berger war vor kurzem zur Enthüllung einer Gedenktafel an Georg Trakl in Krakau. Er hat mir erzählt, daß in einem Zeitungsbericht über dieses Ereignis der Name Trakl als Traki erschien: Der berühmte österreichische Dichter Georg Traki... Bei slawischen Sprachen muß man freilich in Rechnung stellen, daß sie auch Personennamen ungeniert flektieren. Man muß dort also nicht gleich erschrecken, vielleicht steht man bloß im Genitiv oder in einem anderen Fall gebeugt.
Als ich nach meinem Vortrag an der deutschen Universität aber nicht bloß meinen eigenen Namen, sondern auch die Namen einiger Kollegen verschrieben und so die halbe österreichische Literaturgeschichte umgeschrieben
fand, mußte ich mir freilich auch Selbstvorwürfe wegen meiner Aussprache machen. Rede ich denn so undeutlich? Die Deutschen verstehen uns so schwer. In den unverständlichsten schwäbischen und sächsischen Stammesmundarten aber sagen sie uns Österreichern ständig, daß wir der hochdeutschen Schriftsprache nicht mächtig seien und fehlerhaft sprächen. Wir sind dumm genug, das zu glauben, das ist unser Fehler.
Rechthaberisch aber wie ich bin, lasse ich einen Zeitungsbericht wie jenen über meinen Vortrag noch lange nicht als Beweis für die deutsche Theorie gelten. Nicht ich habe undeutlich gesprochen, der Journalist hat schlecht gehört, die deutschen Ohren sind der österreichischen Aussprache nicht gewachsen. Davon gehe ich kein Jota ab. Natürlich weiß auch ich, daß oft der Setzer der Übeltäter ist, und man kann hinter ein etwas ausgefalleneres Wort noch so groß Sic! schreiben, ohne die geringste Chance, sich gegen den Besserwisser durchzusetzen.
Der Name aber, sagt Johann Wolf gang von Goethe, um nun ernsthaft zu reden, ist nicht bloß wie ein Mantel, den der Mensch anziehen oder ablegen kann. Von den vielen merkwürdigen maßgeschneiderten Künstlernamen heute hat Herr von Goethe noch nichts gewußt.
Meistens sind es Prüfungen, zu denen man mit Namen aufgerufen wird. Und oft hat einen der eigene Name wie ein Keulenschlag und tatsächlich unvorbereitet getroffen. Wenn der Lehrer das Notenbuch wie eine ganz gefährliche Waffe zückte, waren Spannung und Angst oft schwer erträglich. Und ähnlich wie in der Mittelschule ging es mir dann auch, als ich im Jahr 1957 an der Akademie der bildenden Künste in Wien die Aufnahmsprüfung ablegte. Manchmal kam, während wir Kopf zeichneten, ein Professor mit einem Zettel mit einigen Namen herein, deren Inhaber er dann an ihren Plätzen aufsuchte, um ihnen Ratschläge zu geben. Mich hatte leider keiner in seinen Papieren stehen. Ganz aufregend aber wurde es, als man uns nach der dreitägigen Prüfung mitteilte, daß nun die Jury zusammentreten würde und daß wir am darauffolgenden Tag am Schwarzen
Brett des Rektorats das Ergebnis angeschlagen fänden.
So bald als es nur ging und voll herzlicher Bangigkeit ging ich tags darauf in die Akademie. Von den achtzig Kandidaten hatten zwanzig die Prüfung bestanden. Alphabetisch standen die Namen der Erfolgreichen auf einem weißen Blatt des Schwarzen Brettes, meiner war nichtdarunter, ich las die Namen ein zweites Mal, vielleicht war ich wieder einmal verschrieben oder an eine falsche Stelle gerutscht, jedoch glich keiner der Namen dem meinen nur irgendwie. Ich war also durchgefallen, und obwohl damals noch niemand an den Datenschutz dachte, hatte das Rektorat höflicherweise nur die Namen der Reüssierten angegeben, die Todes-
fälle aber anonym gelassen.
Ich erlebte einen kohlschwarzen Augenblick vor jenem schwarzen Brett. Ein Landsmann hatte Galgenhumor und versuchte mich und sich zu trösten: An der Kunstakademie, sagte er, haben wir Oberösterreicher kein Glück...
Eine der schönsten Metaphern unseres Glaubens ist wohl die, wo es heißt, wir seien „Ihm in Seine Hand geschrieben“. Dem persönlichen Gott nämlich. Garantiert richtig geschrieben sozusagen. Jener Satz wird höchstens noch von diesem übertroffen: Er hat mich bei meinem Namen gerufen. Das bezieht sich vor allem auf das unfaßbare Eintreten ins Dasein. Einmal aber werden wir auch abberufen. Jedermann! Sic!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!